|
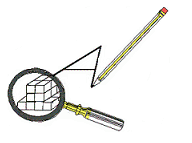 Gleichgültig was ich schreibe und gleichgültig, wie ich schreibe, wenn ich schreibe, stelle ich schreibend einen Gegenstand her, den ich als Text bezeichne. Bei jedem hergestellten Gegenstand unterscheide ich zwei Aspekte. Ich unterscheide das Artefakt und dessen Zweck. Durch diese Unterscheidung gesehen, forme ich einen materiellen Gegenstand so, dass er einen bestimmten Zweck erfüllt, den ich als Gegenstandsbedeutung bezeichne.(1) Texte bestehen beispielsweise aus geformtem Graphit, wenn ich sie mit einem Bleistift herstelle. Ich arbeite dann wie etwa ein Maurer, der mit Backsteinen eine Hausmauer baut, nur verwende ich anstelle der Backsteine Graphitteilchen. Und wie jede Mauer braucht auch jeder Text ein Fundament. Mit dem Bleistift baue ich typischerweise auf Papier. Der Text ist als Artefakt, also jenseits seiner Bedeutung, ein dreidimensionales materielles Produkt, das handwerklich hergestellt ist, wenn ich beim Schreiben einen Bleistift verwende. Gleichgültig was ich schreibe und gleichgültig, wie ich schreibe, wenn ich schreibe, stelle ich schreibend einen Gegenstand her, den ich als Text bezeichne. Bei jedem hergestellten Gegenstand unterscheide ich zwei Aspekte. Ich unterscheide das Artefakt und dessen Zweck. Durch diese Unterscheidung gesehen, forme ich einen materiellen Gegenstand so, dass er einen bestimmten Zweck erfüllt, den ich als Gegenstandsbedeutung bezeichne.(1) Texte bestehen beispielsweise aus geformtem Graphit, wenn ich sie mit einem Bleistift herstelle. Ich arbeite dann wie etwa ein Maurer, der mit Backsteinen eine Hausmauer baut, nur verwende ich anstelle der Backsteine Graphitteilchen. Und wie jede Mauer braucht auch jeder Text ein Fundament. Mit dem Bleistift baue ich typischerweise auf Papier. Der Text ist als Artefakt, also jenseits seiner Bedeutung, ein dreidimensionales materielles Produkt, das handwerklich hergestellt ist, wenn ich beim Schreiben einen Bleistift verwende.
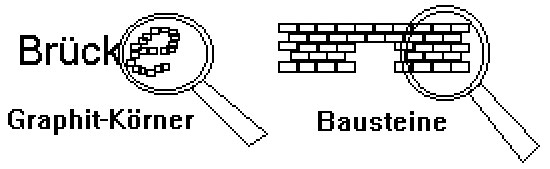 So wie ich bei einer Mauer anstelle von Backsteinen auch zunächst flüssigen Beton verwenden kann, kann ich Text auch mit Tinte, die hinreichend rasch kristallisiert, herstellen. Schreiben bleibt Schreiben, auch wenn ich keinen Bleistift mehr verwende, sondern auf einer Schreibmaschine tippe. Als Schreiben bezeichne ich in diesem Buch das Herstellen von Text jenseits davon, was im Text zu lesen ist oder wozu er dienen soll. Ich weiss, dass das Wort schreiben im Alltag sehr oft anders verwendet wird. So wie ich bei einer Mauer anstelle von Backsteinen auch zunächst flüssigen Beton verwenden kann, kann ich Text auch mit Tinte, die hinreichend rasch kristallisiert, herstellen. Schreiben bleibt Schreiben, auch wenn ich keinen Bleistift mehr verwende, sondern auf einer Schreibmaschine tippe. Als Schreiben bezeichne ich in diesem Buch das Herstellen von Text jenseits davon, was im Text zu lesen ist oder wozu er dienen soll. Ich weiss, dass das Wort schreiben im Alltag sehr oft anders verwendet wird.
 Dass ich Schreiben als Herstellen von Text beobachte, ist eine willkürliche Entscheidung, die ich als meine Theorie reflektiere, in welcher ich das Herstellen als primäre Kategorie verwende.(2) Als Herstellen bezeichne ich Tätigkeiten, durch welche ich Gegenstände herstelle, indem ich Material forme. Wenn ich schreibe, stelle ich ein Gegenstände her. Dass ich das Schreiben so beobachte, erlaubt mir, nach dem Zweck von Text zu fragen. Alltagssprachlich werden bei Vereinbarungen von Wortbedeutungen meistens funktionale Bestimmungen verwendet. Schreiben und Texte erfüllen dann die Funktion des Mitteilens von Informationen an nicht gerade anwesende Menschen. Texte gelten so als schriftliche Form von kommunikativen Handlungen. Hier geht es aber nicht um fiktive Funktionen des Schreibens, sondern darum, was ich beim Schreiben mache.(3) Dass ich Schreiben als Herstellen von Text beobachte, ist eine willkürliche Entscheidung, die ich als meine Theorie reflektiere, in welcher ich das Herstellen als primäre Kategorie verwende.(2) Als Herstellen bezeichne ich Tätigkeiten, durch welche ich Gegenstände herstelle, indem ich Material forme. Wenn ich schreibe, stelle ich ein Gegenstände her. Dass ich das Schreiben so beobachte, erlaubt mir, nach dem Zweck von Text zu fragen. Alltagssprachlich werden bei Vereinbarungen von Wortbedeutungen meistens funktionale Bestimmungen verwendet. Schreiben und Texte erfüllen dann die Funktion des Mitteilens von Informationen an nicht gerade anwesende Menschen. Texte gelten so als schriftliche Form von kommunikativen Handlungen. Hier geht es aber nicht um fiktive Funktionen des Schreibens, sondern darum, was ich beim Schreiben mache.(3)
Umgangssprachlich verwende ich den Ausdruck herstellen quasi synonym mit den Ausdrücken produzieren, arbeiten, erzeugen, hervorbringen, machen, erschaffen, fabrizieren, anfertigen, anbauen, kochen, usw. Herstellen fungiert dabei als menschliche Tätigkeit schlechthin. Hier ist dagegen eine bestimmte Tätigkeit gemeint. Das, was Mensch und Tier tun, um den natürlichen Prozess der Aneignug aufrecht zu erhalten, bezeichne ich als Arbeit oder umgangssprachlich als "Herstellen" für Ver-Brauch. Als Herstellen bezeichne ich dagegen das, was im Ausdruck Homo faber anklingt, das eigentliche Herstellen für den Ge-Brauch. In der Umgangssprache sind viele Unterscheidungen aufgehoben. Insbesondere verwende ich dort herstellen auch für Halbfabrikate, die als Waren gehandelt werden und in diesem Sinne Produkte sind, aber Halbfabrikate sind natürlich zum Verbrauch bestimmt.
Als Tätigkeit bezeichne ich schreiben, wenn ich das Schreiben als solches meine. Ich spreche dagegen von Handlungen, wenn ich einen Brief oder ein Buch schreibe. Als Tätigkeiten bezeichne ich Handlungsweisen. Als Tätigkeit bezeichne ich, was ich in Handlungen jenseits des jeweiligen Ziels mache. Ich schreibe eigentlich nie ohne Ziel, ich schreibe immer etwas. In der Volksschule habe ich schreiben quasi unabhängig davon gelernt, wozu ich es brauchen kann. Dort ging es um die Tätigkeit, aber in einem sehr spezifischen Sinn, der hier wieder erscheint. Es spielte keine Rolle, was geschrieben wurde. Dafür wurde aber auch der Umgang mit den Schreibwerkzeugen geübt, wobei auch die Grammatik keine Rolle spielte.
Die Tätigkeit hat im Unterschied zu einer Handlung weder Anfang noch Ende.
Durch bestimmte Tätigkeiten stelle ich materielle Gegenstände her, beispielsweise Brücken oder Texte. Bei diesen Tätigkeiten verwende ich normalerweise Werkzeuge. Diese herstellenden Tätigkeiten beziehe ich auf die darin angelegte Gegenstandsbedeutung, die den hergestellten Gegenständen als Intention des Herstellers als Zweck innewohnt. Verschiedene Herstellungsverfahren, die dieselbe Gegenstandsbedeutung aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Werkzeugen herstellen, bezeichne ich als dieselbe Tätigkeit. Schreiben bleibt Textherstellen, gleichgültig mit welchen Werkzeugen ich das tue. Lesen und Sprechen sind Tätigkeiten, durch welche nichts hergestellt wird.
Archäologen sprechen von Artefakten, wenn sie erkennen, dass beispielsweise ein ausgegrabener Gegenstand von Menschen hergestellt ist, sie aber nicht wissen, wozu er hergestellt wurde, also wenn sie dessen Gegenstandsbedeutung nicht erkennen können. Ich bezeichne hergestellte Gegenstände als Artefakte, wenn ich von deren Bedeutung absehe, weil es mir um deren Beschaffenheit und um deren Herstellung geht.(4) Ich beobachte hier die Textherstellung also nicht unter dem Gesichtspunkt, was in den Texten gelesen oder verstanden werden kann, sondern unter dem Gesichtspunkt, wie der Text im engeren Sinne zunächst handwerklich und später in einem hochautomatisierten Produktionsprozess hergestellt wird. Gleichgültig auf welchem technologischen Niveau Text hergestellt wird, es muss dabei immer einem gewählten Material eine gewählte Form gegeben werden. Am Anfang jeder technischen Entwicklungen steht das Handwerk im Sinne einer Handarbeit.
Wenn ich ein Gegenstände herstelle, verfolge ich ein Ziel, das im Gegenstand als dessen Gegenstandsbedeutung erscheint. Ich stelle beispielsweise eine Brücke her, wenn ich mit weniger Aufwand auf die andere Seite des überbrückten Hindernisses kommen will. Als Maurer kann ich beispielsweise Steine so anordnen, dass eine Brücke entsteht. Der Zweck der Brücke besteht darin, ein Hindernis, etwa einen Fluss zu überbrücken. Sinn macht diese Brücke für mich, wenn ich über diesen Fluss gehen will. Verallgemeinert macht die Brücke für all jene Sinn, die auf die andere Seite des Flusses wollen. Und noch allgemeiner machen Brücken überhaupt Sinn, wenn jemand auf die je andere Seite will.
Der Gegenstand, das ich herstelle, muss den Zweck erfüllen. Eine Brücke muss beispielsweise stabil genug sein, dass sie nicht einstürzt, wenn sie benutzt wird. Ob die Brücke je benutzt wird oder warum jemand auf die andere Seite des Flusses will, ist für den Zweck der Brücke ohne Relevanz. Damit die Brücke ihren Zweck erfüllt, muss sie richtig konstruiert sein, sie muss unter anderem das ihr zugetraute Gewicht tragen können. Wenn ich als Handwerker eine Brücke baue, kann ich die Backsteine nicht zufällig oder nach Belieben anordnen. Plato bedauerte Handwerker, weil sie nicht bauen können, wie sie wollen, sondern die Bedingungen des Gebrauchs erfüllen müssen. Ich glaube nicht, dass er das Schreiben als Handwerk begriffen hat, aber das Herstellen von Text unterliegt auch solchen Bedingungen. Vielleicht hat der Sklavenhalter Plato ohnehin mehr diktiert als geschrieben – falls Plato nicht nur eine Erfindung jener Sklaven war, die so ihre Texte aufwerten wollten.
Wenn ich Text herstelle, stelle ich Zeichenkörper her, die ich als Artefakt auffassen kann, ohne mich dafür zu interessieren, worauf der Text als Symbol verweisen soll. Wenn ich Text herstelle, ist mein Ziel unabhängig davon, was ich schreibe, dass der Text auch noch nach längerer Zeit gelesen werden kann - mithin als Artefakt seine Form behält.
Beim Lesen kommt nicht der Text in meine Augen, sondern durch den Text strukturiertes Licht, also etwa am Graphitpixelmuster gebrochenes Licht einer Lampe. 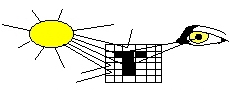 Das ist Grund dafür, dass ich im Dunklen oder etwa weissen Text auf weissem Hintergrund nicht lesen kann. Als Artefakt fungiert Text als Menge von Schaltstellen, mit welchen ich Signale steuere, die ins Auge, respektive auf die Retina des geneigten Lesers kommen sollen. Als Leser eines Textes sehe ich aber nicht Lichtstrahlen, sondern den Text. Das ist Grund dafür, dass ich im Dunklen oder etwa weissen Text auf weissem Hintergrund nicht lesen kann. Als Artefakt fungiert Text als Menge von Schaltstellen, mit welchen ich Signale steuere, die ins Auge, respektive auf die Retina des geneigten Lesers kommen sollen. Als Leser eines Textes sehe ich aber nicht Lichtstrahlen, sondern den Text.
Natürlich sehe ich jeden hergestellten Gegenstand, weil er Licht bricht. Aber einen Hammer stelle ich nicht her, damit ich ihn sehen kann. Fensterglas stelle ich her, damit ich es nicht sehen kann, und einen Spiegel stelle ich her, dass das am Gegenstand gebrochne Licht nochmals gebrochen wird. Gegenstände, die dazu hergestellt werden, dass sie bei Bedarf gesehen werden können, sind Bilder, Zeichnungen und Zeichen. Da sie dem Gesehenwerden dienen, werden sie funktional als visuelle Medien bezeichnet. Wenn ich in einen aktiven Scheinwerfer schaue, sehe ich das Licht, nicht den Gegenstand. Ein Leuchtturm soll eigentlich auch nicht gesehen werden. Und schliesslich gibt es Text auf Bildschirmen, den ich auch im Dunklen sehen kann. Ich werde später darauf zurückkommen, hier geht es vorerst nur darum, dass Texte einen Zweck haben, der darin liegt, unterscheidbare Objekt - beispielsweise verschiedene Wörter - sichtbar zu machen.
Der gegenständliche Aspekt des Textes entzieht sich der oberflächlichen Wahrnehmung, die sich nur auf den Inhalt der Texte konzentriert aus zwei Gründen. Zum einen erfüllen die Textartefakte ihre Funktion quasi flach oder zweidimensional, weshalb ihre dritte Dimension und damit ihre Materialität in der Wahrnehmung normalerweise vernachlässigt werden. Text wird dann als etwas Immaterielles beobachtet, was mit einer geistig-ideellen Kopfarbeit verbunden wird. Text erscheint so als eine Information, die weder Materie noch Energie sein soll. Kopfarbeiter neigen überdies dazu, geistige Aspekte der Textherstellung zu betonen und die materielle Herstellung von Text als Banalität zu betrachten, die eben einer Sekretärin oder schliesslich einer Maschine überlassen werden kann. V. Flusser etwa, der sieht, dass herstellende Arbeit, also die Produktion von Artefakten darin besteht, dass Menschen „Materie“ in eine bestimmte Form bringen, unterscheidet dabei eine erste Phase, in welcher die Form entworfen, und eine zweite Phase, in welcher diese Form dann nur noch auf die Materie angewandt werde.(5) Auch K. Marx schrieb, dass sich der menschliche Baumeister von der Biene dadurch unterscheide, dass er beim Bauen die Form vorab als Plan „im Kopf“ habe.(6) Aber jenseits davon, was im Kopf der Kopfarbeiter passiert, erscheint die Form eines Artefaktes immer erst, wo Material geformt wird. Und auch die besten Kopfarbeiter schreiben Texte oder zeichnen Pläne, weil ihre Köpfe doch arg beschränkt sind.
Die entwicklungsgeschichtlich erste Funktion von Text sehe ich ein einer Art Selbstmitteilung, bei welcher ich Text herstelle, der nicht andere, sondern mich selbst an etwas erinnern soll. Text fungiert dann als externes Gedächtnis. Dass ich kein brauchbares Gedächtnis im Kopf habe, kann ich mir leicht bewusst machen, wenn ich Kopfrechnen mit schriftlichem Rechnen vergleiche, etwa anhand einer Multiplikation von zwei dreistelligen Zahlen. Vorderhand sehe ich nicht, wie der reine Geist der Kopfarbeiter je etwas bewirken sollte. Was sich beim Schreiben von Texten im Kopf oder im Bewusstsein des Schreibenden abspielt, kann mir auch die kognitivitstische Hirnphysiologie nicht erklären. Aber dass mir Texte beim Erinnern und beim Denken dienen, weiss ich im Sinne eines Erfahrungswissens, auch wenn ich mir nicht erklären kann, was dabei im Kopf passiert. Die gegenständliche Qualität eines Textes zeigt sich in seiner nachhaltigen Lesbarkeit, also darin, dass Material und Form des Textes im Unterschied zu Gedanken später noch vorhanden sind.
Herstellende Tätigkeiten unterliegen einer Entwicklung der Technik und der Produktionsweisen. Technisch verändern sich diese Tätigkeiten durch neue Werkzeuge und Materialien, und auf einer anderen Ebene durch Mechanisierungen und Automatisierungen, die auch die Werkzeuge betreffen. Die Werkzeuge entwickenl sich zu Maschinen und Automaten. Die Produktionsweise entwickelt sich vom Handwerk über die Manufaktur zur Fabrik, wobei im Übergang zur Manufaktur hauptsächlich die Handwerkstätigkeiten zerlegt wurden, und im Übergang zur Fabrik die Tätigkeiten zunehmend durch den vermehrten Einsatz von Maschinen bestimmt wurden.(7)
Gutenbergs revolutionärer Beitrag war, dass er das Textherstellen in eine Menge verschiedener Lohnarbeiten aufgeteilt hat. Bereits in den Skriptorien der Klöster hatten die Schreibenden keinen gewollten Einfluss auf den Inhalt der Texte, die sie nur durch mehr oder weniger bewusste Fehler veränderten. Gutenberg aber zerlegte das Handwerk jenseits von Inhalten.
Die Entwicklung der Maschinerie führte auch dazu, dass das Verlagswesen von Heimarbeit, das in der Zeit der Maufakturen verbreitet war, durch Fabriken ersetzt wurde. Die sogenannte Industriealisierung, die eigentlich das Einführen von Lohnarbeit bezeichnet, wurde durch die Fabriken nur sichtbarer, die innerbetriebliche Arbeitsteilung wurde in der Manufaktur eingeführt.(8)
Tätigkeiten, die als Lohnarbeit organisiert wurden, wurden durch die betriebliche Arbeitsteilung so zerlegt, dass zunächst verschiedene Teilarbeiten entstanden, die später durch die Automatisierung wieder aufgehoben wurden. Der Text in einem herkömmlich gedruckten Buch beispielsweise wird gedruckt, obwohl er wie ein von Hand geschriebener Text aus einer Art Tinte besteht, die gemeinhin Druckerschwärze genannt wird und die auch auf Papier aufgetragen wird. Im manufakturellen Buchdruck wurde das Schreiben durch eine innerbetriebliche Arbeitsteilung zerlegt. Die eigentliche Textherstellung wurde dabei Menschen übertragen, die nur mit den Händen und nur auf Geheiss arbeiten, und auf den Inhalt des Geschriebenen keinerlei Einfluss haben.(9)
Die Zerlegung der Tätigkeiten in der Manufaktur war ökonomisch motiviert, sie schuf aber auch eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Maschinen, indem sie Teiloperationen hervorbrachte, die einfacher, respektive durch einfachere Maschinen ersetzt werden konnten.
Diese industrielle Zerlegung des Schreibens in Teiltätigkeiten wie Setzen und Drucken führte zu einer sprachlich repräsentierten Vorstellung, wonach mit Schreiben eine Kopfarbeit bezeichnet wird, während die Textherstellung im engeren Sinne mit anderen Wörtern wie etwa Drucken bezeichnet wurde. Darin kann man einen Bedeutungswandel des Ausdruckes Schreiben sehen, weil in dieser Ideologie der vermeintlich Schreibende nicht mehr für die Textherstellung zuständig scheint. Gutenberg ist aber auch exemplarisch dafür, dass Kopfarbeit bei der Textherstellung keineswegs den Inhalt des Textes betreffen muss. Gutenberg hat ja seine Bibel nicht geschrieben, er hat als Kapitalist den Arbeitsprozess im Sinne einer abgetrennten Kopfarbeit organisiert. In die Textherstellung selbst war er in keiner Weise mehr involviert.
Als Handarbeit bezeichne ich eine konkrete Tätigkeit, während ich als Handwerk viel mehr eine Epoche der Produktivkraftentwicklung bezeichne, in welcher vor allem Handarbeit geleistet wurde. Das so verstandene Handwerk wurde unter arbeitsteiligen Gesichtspunkten durch die Manufaktur aufgehoben. Dabei wurden die handwerklichen Tätigkeiten zunehmend so zerlegt, dass Teilarbeiten entstanden, bei welchen die Hände immer weniger an das herzustellende Produkt angelegt wurden. Die auf diese Weise entdeckte sehr geistige Kopfarbeit wird in vielen betrieblichen Arbeitsteilungen von Ingenieuren im Konstruktionsbüro geleistet, während in der Werkstatt mit den Händen dieser Ideologie zufolge nur noch nach vorgesetztem Plan gearbeitet wird.
Beim Schreiben wird mir diese Arbeitsteilung zwischen Hand- und sogenannter Kopfarbeit – wie sie etwa zwischen einem diktierenden Chef und seiner Sekretärin gegeben ist – beim Abschreiben sicht- oder erlebbar. Wenn ich abschreibe, muss ich nicht verstehen, was ich abschreibe, und ich kann das, was ich abschreibe auch nicht mehr oder weniger gut verstehbar machen. Mein Verstand hilft mir beim Abschreiben nicht. In dieser spezifischen Hinsicht brauche ich den Kopf beim Abschreiben nicht.
Kopfarbeit trifft die Sache aber in zwei Hinsichten nur ungenau. Einerseits steure ich natürlich auch beim Abschreiben meine Hand in einer gewissen Weise im “Kopf”, soweit ich meine beim Schreiben anfallenden Hand- und Augenbewegungen quasi in meinem Kopf koordiniere. Und andrerseits arbeiten Ingenieure vielleicht noch etwas mehr „im“ oder mit dem Kopf, als ich es beim Abschreiben tue, aber ihre Arbeitsprodukte sind als Konstruktionszeichnungen oder als Beschreibungen doch wieder Artefakte, die als solche ausserhalb der Köpfe hergestellt werden müssen. Ich habe als Maschinenzeichner oft gezeichnet, was sich Ingenieure ausgedacht haben.
Abschreiben ist ein ziemlich spezieller – und wohl auch ein nicht wesentlicher – Fall des Schreibens, obwohl ich – etwa zitierend – immer noch recht oft abschreiben muss. Auch beim Formular ausfüllen muss ich lesen und schreiben können, ich kann dabei aber auch nicht schreiben, was ich will, sondern muss dem Formular folgen. Ich lasse solche speziellen Fälle vorerst ausser Acht und beobachte ein quasi noch vollständiges Handwerk, wie es im Zunftwesen gemeint war und konventionell einer einzelnen Person zugerechnet wird, weil die relativ ganzheitlichen Handarbeiten erst im Übergang zur Manufaktur zerlegt werden, während im Handwerk die Gesellen noch dem Meister zudienen.
Beim Schreiben scheint in diesem Sinne der Texthandarbeiter als Autor auch für den Inhalt des Textes zuständig, wobei oft ausser Acht gelassen wird, dass im Ausdruck “Autor” diese Zuständigkeit teilweise aufgehoben ist. Der Ausdruck Autor verweist auf ein Autorisiertsein, das zu schreiben, was geschrieben werden muss. Im exemplarischen Fall schreibt ein Autor etwa in der Bibel Gottes Worte und in einem vergleichbaren Fall schreibt ein Wissenschaftler, wie die Welt wirklich ist, also auch nicht einfach etwas, was ihm gefällt. Der Autor ist umgekehrt auch nicht verantwortlich, für das was er schreibt, er kann nichts dafür, dass die Welt ist, wie sie ist. U. Eco spielt mit der Variante, dass er auch als Schriftsteller Subjekt einer Romanhandlung ist, der er so ausgeliefert folgen muss, wie ein Wissenschaftler seiner Realität. Das metaphorische Handwerk betrifft in genau diesem Sinne, nicht was geschrieben wird, sondern wie es geschrieben wird.
Schreiben wird auch umgangssprachlich sehr oft als Handwerk bezeichnet, es gibt neben der Volksschule, die dieses Ziel auch verfolgt, ganz viele Kursangebote, das Handwerk des Schreibens zu lernen. Mit Handwerk wird in diesen Redeweisen aber nicht die Herstellung eines materiellen Gegenstandes gemeint. Es geht in dieser Art „Handwerk“ darum, verständlicher, spannender oder interessanter zu schreiben. Es geht dabei nicht darum, das handwerkliche Ab- oder Aufschreiben zu lernen oder zu verbessern, sondern um irgendeine psychologische Fähigkeit, von andern verstanden oder gerne gelesen zu werden. Der Ausdruck “Handwerk” dient dabei als Metapher für eine gute Arbeit, die einem einzelnen Menschen zugerechnet werden kann. Gutes Schreiben bezieht sich darin nicht auf einen Gegenstand, der etwa in einer Werkstatt von Hand hergestellt wird, sondern auf die psychologische Wirkung, die das Geschriebene erzeugen soll. In den Kursen, die als “Handwerk des Schreibens” angepriesen werden, wird normalerweise vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden bereits Text herstellen können. Gemeint ist eine verkürzte Rhetorik, in welcher es um die Darstellungsform von beliebigen Inhalten geht.(10) Diese Art guten Schreibens zeigt sich beispielsweise auch im Diktieren dessen, was dann die Sekretärin, die von diesem guten Schreiben gar nichts verstehen muss, mit ihren Händen wirklich niederschreibt. Aber jenseits dieser Metapher stellt, wer diktiert, keinen Text her, er lässt – wie Gutenberg – Text herstellen.
Diktieren kann auch jemand, der nicht schreiben kann. Im sogenannten Mittelalter wurde wenig geschrieben und wer etwas zu sagen hatte, konnte im Normalfall gar nicht schreiben. Erst mit der Entstehung von Verfassungen und Verträgen, die das Mittelalter beendeten, wurde zunehmend auf schriftliche Dokumente gesetzt. Die schriftliche Dokumentation wurde insbesondere für Schuld- und Besitzvereinbarungen verwendet, die nicht viel „gutes Schreiben“ wie es etwa W. Shakespeare zugerechnet wird, erforderten. Das Herstellen von Texten wurde lange Zeit an sogenannte Schreiber delegiert. Und wer – weil er zum Volk gehörte – nichts zu sagen hatte, aber trotzdem Mitteilungen machen wollte, kaufte das Schreiben als Dienstleistung bei solchen Schreibern ein.(11) In Ländern mit noch verbreitetem Analphabetismus war zwangsläufig Sitte, sich Texte von Schreibkundigen (auf)schreiben zu lassen.
In der Volksschule, die ich besuchte, hiess das Schulfach, in welchem ich Schreiben lernte, Schreiben, und das Schulfach, in welchem ich das vermeintliche Handwerk des guten Schreibens lernte, hiess dann sinnigerweise Deutsch, womit natürlich nicht das Lernen der deutschen Sprache gemeint war, die ich ja schon kannte, sondern viel mehr die Ideologie, welche Formulierungen, also Formgebungen gut angepasstes Schreiben ausmachen. Viele Menschen, die schreiben können, lassen sich Texte von anderen Menschen schreiben, die das Handwerk des guten Schreibens beispielsweise als Ghostwriters oder Werbetexter auf dem Markt anbieten. Dieses metaphorisch gemeinte Handwerk des guten Schreibens betrifft den Inhalt, nicht das Schreiben. Darin erkenne ich eine Inversion des Falles, in welchem jemand meint, er könne gut schreiben, aber die eigentliche Textherstellung nicht selbst ausführen will und deswegen nur diktiert.
Die Entwicklung des Schreibens wiederholt sich ontogenetisch - im Sinne der haeckelschen Rekapitulation - im Schreiben heutiger Menschen. Die eigentliche Handarbeit, die ich in der Volksschule mit Griffel und Bleistift als Buchstaben zeichnen lernte, wurde durch die technische Entwicklung so aufgehoben, dass ich das Schreiben später nochmals neu lernen musste, als ich die erste Tastatur mit zehn Fingern benutzen sollte. Und ich übe jetzt noch etwas unbeholfen mit einer Software, mit welcher ich Text hochautomatisiert herstellen kann. Das vorläufige Ende dieser Entwicklung ist aktuell ChatGPT.(12) Dass ich die Verinnerlichen der Handarbeitsfähigkeiten als automatisieren bezeichne, nimmt vorweg, dass diese Fähigkeiten später durch Textautomaten aufgehoben wurden.
In der Volksschule lernte ich nicht nur schreiben, sondern explizit auch schön schreiben.(13) Jedes Handwerk kennt den Unterschied zwischen kunstvollen Gegenständen und solchen, die nur praktischen Bedürfnissen entsprechen. Die Kalligrafie kann man in diesem Sinne als Kunsthandwerk sehen.
Das schöne Schreiben ist allerdings an primitive Werkzeuge gebunden. Wenn ich mit einer Maschine schreibe, kann ich die Schönheit der Schriftzeichen nicht mehr unmittelbar beeinflussen, sie ist dann meinem handwerklichen Geschick durch die Erfindung der Druckletter entzogen.(14) Schönschreiben geht in einem spezifischen Sinn nur als Handarbeit, bei welcher die Formgebung weitgehend durch die Hand bestimmt wird, was eben typischerweise beim Gebrauch von eigentlichen Werkzeugen, wie etwa dem Bleistift, der Fall ist. Der Gebrauch von Werkzeugen verlangt körperliche Fertigkeiten, die sich dann in der relativen Schönheit der Produkte zeigen. Wenn ich Maschinen verwende, brauche ich natürlich auch Fertigkeiten, aber das Aussehen der Produkte wird stark durch die Maschine bestimmt.(15)
Beim Schreiben mit einer etwas entwickelten Maschine wird mir auch bewusst, dass es typographisch schöne Schriften gibt, dass ich also auch beim Schreiben von Hand eine schöne Schrift wählen und mich dann in dieser Schrift üben muss, wenn ich einen Text schön schreiben will.(16)
In der Volksschule lernte ich nicht nur schön zu schreiben, sondern vor allem auch richtig zu schreiben. Mit richtig schreiben ist dabei nicht vor allem das gute Handwerk der Rhetorik gemeint, sondern viel mehr, dass Texte keine Fehler enthalten dürfen. Jeder Handwerker muss seine Produkte hinreichend fehlerfrei herstellen. Teppichknüpfer, die von Hand arbeiten, machen der Legende nach bewusst unregelmässig Fehler in die Teppichmuster, damit sichtbar bleibt, dass die Teppiche Handarbeit sind. Aber natürlich muss dabei das Muster als solches erhalten bleiben. Beim Schreiben kann ich beispielsweise einzelne Buchstaben vergessen, ohne dass der Sinn des Textes davon betroffen wäre – wenn es nicht zu oft geschieht. Solche Fehler kann ich beim Schreiben natürlich nur machen, wenn mir vorgegeben ist, welche Anordnungen welcher Buchstaben erlaubt und damit richtig sind.
Beim Schreiben eines gegebenen Textes unterscheide ich das Abschreiben etwa im klösterlichen Skriptorium und das Aufschreiben etwa eines Diktates durch eine Sekretärin. Beides sind eintönige Tätigkeiten, die mich sehr an anspruchslose Fliessbandtätigkeiten erinnern.
Beim Abschreiben muss ich die Regeln der Sprache nicht kennen. Ich unterscheide dabei aber Abschreiben und Abzeichnen. Wenn ich abschreibe, erkenne ich die Buchstaben als Schriftzeichen eines Alphabetes. Aber ich kann die Buchstaben natürlich auch als Zeichnungen sehen und sie dann eben abzeichnen, ohne zu wissen, dass ich dabei Text herstelle. Ich stelle dann einfach eine Kopie des materiellen Gegenstandes her. Ich kann einen Buchstaben als Artefakt kopieren, ohne zu wissen, dass es sich um einen Buchstaben handelt. Wenn ich dagegen einen mir diktierten Text aufschreibe, muss ich natürlich die Orthographie kennen, weil durch das Diktat nur der Text gegeben ist, aber nicht die Schreibweise der einzelnen Wörter. Wenn ich nur aufschreibe, was andere diktieren, muss ich die Grammatik der Sprache, die die Satzbildung der Sprache beschreibt, nicht kennen. Man mag einwenden, dass es kaum Menschen gibt, die die Orthographie beherrschen, ohne die Sprache zu sprechen. Aber jenseits der Menschen gibt es Wörterbücher, die nur die Orthografie behandeln und viele Computerprogramme haben mit dem Übersetzen und Rechtschreiben einzelner Wörter viel weniger Probleme als mit den Wortstellungen im Satz.
Wenn ich selbst schreibe, muss ich das ganze Handwerk der Textherstellung hinreichend beherrschen. Ich muss dabei nicht nur mit einem Bleistift umgehen können, sondern auch wissen, was ich als Text bezeichne. Damit ich ein Artefakt als Text bezeichne, muss es bestimmten Produktionsregeln, die ich als Grammatik der jeweiligen Sprache bezeichne, und bestimmten semantischen Bedingungen genügen. Die Produktionsregeln von hinreichend grossen Sprachen bewirken, dass ich mit endlich vielen Zeichen unendlich viele verschiedene Texte herstellen kann. Beim Schreiben muss ich die Regeln der jeweiligen Sprache kennen. Wenn ich schreiben lerne, nachdem ich die jeweilige Sprache bereits spreche, sind mir grosse Teile der Produktionsregeln bereits bekannt. Ich weiss dann beispielsweise welche Sätze Sinn machen, wie ich die Wörter also sinnvoll anordnen kann. Dagegen beruhen viele Schriften auf orthographischen Regeln, die ich beim Sprechen nicht kennen muss. Das Schreiben hat spezifische Produktionsregeln. Sie bestimmen auch oft, wie ich über mein Sprechen nachdenke. Dass und welche Wörter ich unterscheide, scheint mir mehr eine Folge der Schrift, während ich beim Sprechen zwischen den Wörtern oft gar keine Pause mache und als Kind vielleicht Sätze oder Satzteile lernte, ohne zu merken, dass ich dabei einzelne Wörter verwendet habe.(17)
Die Tätigkeit des Schreibens stellt sehr viele sehr verschiedene Anforderungen, welchen ich auch auf der Stufe der Handarbeit weitgehend mit implizitem Wissen und Können begegnen kann. Implizit heisst, dass ich schreiben kann, ohne begrifflich zu verstehen, was ich dabei tue. Wenn ich statt einer Füllfeder ein Schreibmaschine verwenden will, muss ich zwar eine neue Handlungsweise lernen, aber ich muss mir dabei nicht bewusst machen, inwiefern das von Hand schreiben in der Maschine aufgehoben wird. Unter dem Gesichtspunkt der Anforderungen kann ich jede Art des Schreibens als neue Tätigkeit betrachten, die dann auch neue Anforderungen stellt. Ich will mich aber nicht mit Anforderungen befassen, sondern das Schreiben als Produktionsprozess beobachten, der einer technischen Entwicklung unterliegt.
Ich begreife dabei das Schreiben nicht als Erfindung, sondern als eine sich autopoietisch entwickelnde Verhaltensweise, die im Tier-Mensch-Übergangsfeld allmählich zu einer mit Werkzeugen produzierenden Tätigkeit wird. Autopoiese heisst evolutionär entstanden.(18) Wenn ich von einer Autopoiese spreche, bezeichne ich in gewisser Hinsicht einen spezifischen Moment einer dort geteilten Entwicklung. Wenn ich beispielsweise von der Entwicklung des Menschen spreche, unterscheide ich in diesem Sinne eine naturhistorische Entwicklung innerhalb des Tierreiches, die mit dem Auftreten des Menschen abgeschlossen ist, und eine sozialhistorisch Entwicklung des Menschen, die mit dem Auftreten des Menschen beginnt und in welcher sich nicht mehr der Mensch, sondern dessen Lebensverhältnisse als Kultur entwickeln. Wenn ich Menschen als werkzeugherstellende Tiere sehe, beobachte ich eine Entwicklung im Tierreich hin zur Verwendung von Objekten, welche am Schluss den Menschen als Herstellenden hervorbringt, und eine zweite Entwicklung, in welcher sich die Menschen dadurch entwickeln, dass sie ihre Werkzeuge entwickeln.(19)
In der Autopoiese des Schreibens unterscheide ich dessen quasi naturhistorische Entwicklung, die ich im Lesen von Spuren begründet sehe, und dessen sozialhistorische Entwicklung, die auf der Herstellung von Schriftzeichen beruht. Im Tier-Mensch-Übergangsfeld invertiert das Spuren lesen zum Spuren herstellen, was etwas anderes ist, als Spuren hinterlassen. Wenn ein Tier sein Revier markiert, kann ich darin zwar eine instinktive Absicht erkennen, aber nicht das Herstellen eines Zeichens, weil ich als eigentliches Zeichen einen hergestellten Gegenstand bezeichne, der im Prinzip arbiträr für ein konventionell vereinbartes Referenzobjekt steht. Das Markieren von Tieren braucht ja keine Vereinbarung darüber, was es bedeutet. Schriftzeichen schliesslich implizieren einen sprachlichen Handlungszusammenhang, in welchem sie ihre inhaltliche „Bedeutung“ entfalten. Als Artefakte aber sind sie wie alle Zeichen Gegenstände einer sich technisch entwickelnden Produktion.
Wo Menschen im Tier-Mensch-Übergangsfeld bereits bewusst Spuren legten, etwa durch Hinlegen von gefundenen Gegenständen oder durch Knicken von Ästen entlang des Weges, sehe ich Keimformen der späteren Zeichen und Schriftzeichen, auch wenn solche Spuren noch sehr noch naturwüchsig und analog waren.(20)
Die Evolution des Schreibens verstehe ich in dem Sinne exemplarisch für die sozialhistorische Seite der menschliche Entwicklung, als ich das Schreiben als Tätigkeit sehe, für welche auch immer umfassendere Werkzeuge entwickelt werden. In dieser Entwicklung wird nicht nur das handwerkliche Schreiben zerlegt, sie integriert in einer Entdifferenzierung auch Funktionen, die zunächst nicht als Teile des Schreibens aufgefasst werden, wie etwa die Verwaltung der Dokumente und insbesondere das Verfügbarmachen der Texte im Internet. Als entwickelste Stufe des Schreibens sehe ich schliesslich das Hyperlesen, bei welchem ich lesend durch das Anklicken von Hyperlinks den Text, den ich lese, in einem eigentlichen Sinne erst erzeuge – was durch die bislang höchstentwickelten Textproduktionsmittel möglich wird.
Eine vollständige Aufhebung des Schreibens erkenne ich in der Textproduktion mittels Automaten, die wie etwa ChatGPT umgangssprachlich der KI zugerechnet werden, in welcher sogenannte neuronale Netzwerke und Sprachmodelle verwendet werden. Wenn ich solche Maschinen verwende, schreibe ich nicht, sondern wähle Texte aus, die ich - wie in einer Bibliothek - finden kann. Ich werde später darauf zurückkommen.
Alles, wofür ich noch kein Schreibwerkzeug habe, bezeichne ich als die noch nicht begriffenen Aspekte des Schreibens. Einen Aspekt des Schreibens will ich hier noch besonders hervorheben, weil er auch davon ablenkt, das Handwerk zu sehen. Die typischen Handwerker stellen viele Instanzen desselben Objektes her. Ein Hufschmied etwa schmiedet immer Hufeisen, auch wenn sie jeweils sehr verschiedenen Perdehufen angepasst werden müssen. Wenn ich als Handwerker das Produkt bereits viele Male hergestellt hätte, müsste ich wohl nicht mehr allzu viel denken, um ein weiteres Exemplar herzustellen. Texte sind in dieser Hinsicht spezielle Produkte. Ich schreibe sehr selten zwei- oder mehrmals den gleichen Text. Aber in einer bestimmten Hinsicht sehen natürlich meine Texte doch sehr ähnlich aus, weil sie alle ein Reihenfolge aus einer begrenzten Menge von Schriftzeichen sind.
Ich beobachte in diesem Buch die Entwicklung des Schreibens als eine Entwicklung der Textproduktionsmittel, in welcher der Schreibprozess wie jedes gegenständliche Herstellen der Entwicklung der Werkzeuge unterliegt und immer umfassender automatisiert wird.(21) Ich unterscheide dabei drei verschiedene Mittel der Textproduktion, die sich teilweise gegenseitig bedingen: Das eigentliche Werkzeug, das Material des Textes und den Träger des Textes. Wenn ich mit einem Bleistift auf Papier schreibe, ist der Bleistift das Werkzeug, das Graphit das Material des Textes und das Papier der Textträger. Die wesentliche Entwicklung beobachte ich bei den Werkzeugen, weil mir die Werkzeuge zei-gen, was ich beim Schreiben quasi noch von Hand machen muss, wenn ich die jeweils neueren Werkzeuge noch nicht zur Verfügung habe. So macht mir beispielsweise die elektrisch angetriebene Schreibmaschine bewusst, dass ich den Bleistift wie etwa einen Hammer mit meiner Körperkraft bewegen muss, was mir beim Schreiben mit dem Bleistift nicht ohne weiteres auffällt, weil ich dafür sehr wenig Kraft brauche.
Anmerkungen
1) Ich bezeichne den Zweck in Anlehnung an K. Holzkamp als Gegenstandsbedeutung, weil Zweck oft mit Funktion und Sinn verwechselt wird. Ich werde darauf zurückkommen. (zurück)
2) Ich habe in der Einleitung bereits einige Bemerkungen zur Wahl meiner Kategorien gemacht, und darüber, wie sie diesen Text beeinflussen. Das ist natürlich vor allem Inhalt der Theorie, die ich nebenher schreibe. (zurück)
3) Hergestellte Gegenständen haben einen Zweck, sie können aber ganz verschiedene Funktionen erfüllen. Umgangssprachlich - bis weit in die Philosophie hinein - werden Wortbedeutungen erläutert, indem typische "Funktionen" angegeben werden, wobei Funktion in diesem Zusammenhang für "Wofür verwende ich es" steht. Messer wird dabei definiert als Ding zum Schneiden, Text ist dann beispielsweise eine "schriftlich fixierte, im Wortlaut festgelegte Folge von Aussagen", weil ich Text zum Aussagen machen verwende. (zurück)
4) Artefakt ist in vielen Disziplinen ein Modewort geworden, das sehr verschieden verwendet wird. Sehr oft wird Artefakt diffus für mentale Konstrukte, also für Vorstellungen oder geistige Gegenstände verwendet, ich meine aber ausschliesslich anfassbare, materielle Gegenstände, die hergestellt wurden. (zurück)
5) Nebenbei bemerkt meinte V. Flusser, dass er damit die Arbeitswertlehre von K. Marx widerlegt habe, weil dessen Proletarier, die nur mit den Händen arbeiten, durch Maschinen ersetzt würden, wodurch dann jeder Wert vollständig im Kopf produziert werde (V. Flusser, Kommunikologie weiter denken; Frankfurt a.M. 2009, S. 142ff (zurück)
6) K. Marx, Das Kapital, MEW Bd. 23, S. 183 (zurück)
7) Mit dem Frabrikwesen entwickelte sich auch die schriftliche Dokumentation durch Ingenieure und Buchhalter als eigenständige Tätigkeiten. (zurück)
8) Die Unterscheidung zwischen naturwüchsiger und innerbetrieblicher Arbeitsteilung hat H. Braverman als Babbage-Prinzip bezeichnet, weil C. Babbag in seiner Ökononie den Sinn innerbetrieblicher Arbeitsteilung beschrieben hat: Für Tätigkeiten, die weniger Qualifikationen verlangen, muss ein kleinerer Lohn bezahlt werden. Es ist also rentabel, wenn nicht jeder Arbeiter alles können muss. (Über die Ökonomie von Maschinerie und Manufaktur, 1832) (zurück)
9) Manufaktur ist ein kapitalistischer Euphemismus, der das von „Hand hergestellt“ bezeichnet und das „auf Geheiss“ versteckt. (zurück)
10) Rhetorik heisst die Techne (Kunst) des Dialoges (von Aristoteles eingeteilt in Pathos, Ethos und Logos). Die Aufgabe der Rhetorik ist, die Möglichkeiten zu erforschen und die Mittel bereitzustellen, die nötig sind, um eine Gemeinsamkeit zwischen Redner und Zuhörern herzustellen, auf deren Basis es ermöglicht wird, eine subjektive Überzeugung allgemein zu machen (Persuasion). (zurück)
11) A. Wendehorst beschreibt in seinem Aufsatz „Wer konnte im Mittelalter lesen und schreiben“ wie sich das Schreiben durchsetzte, in einer Zeit, in welcher es keine Schulen gab, die das Schreiben unterrichteten. Vorab Kleriker übernahmen die Rolle des Schreibers, die sich zunehmend im Notariatswesen institutionalisierte. Die Vorstellung, wonach viele Menschen schreiben können sollten, entwickelte sich erst später, sozusagen als eine Revolution im Schulwesen. (zurück)
12) ChatGPT ist eine Maschine. Maschinen schreiben nicht, was hätten sie davon, wenn sie es tun würden? Ich schreibe, indem ich ChatGPT verwende. (zurück)
13) Schönschreiben wird mittlerweile an den Volksschulen nicht mehr unterrichtet. Dagegen gibt es Opposition, die den handarbeitlichen Aspekt der Bildung hervorhebt. (zurück)
14) Ich komme darauf zurück, wo ich am Computer eigene Schriften entwerfen kann. Aber auch das Verwenden von verschiedenen Schriftauszeichnungen (Zeichnung) wie kursiv, fett usw sind Gestaltungen, die bereits mit dem Kugelkopf möglich waren. (zurück)
15) V. Flusser hat diesen Übergang in Bezug auf Bilder mit dem Ausdruck Technobild charakterisiert. Er verwendet den Ausdruck in Abgrenzung zu Bildern, die mit einfachen Werkzeugen - wie beispielsweise dem Pinsel - hergestellt sind. Der Fotofilm wurde durch die sogenannte Digitalkamera praktisch vollständig verdrängt. "Vor-moderne Bilder [sind] Produkte des Handwerks (Kunstwerke), nach-moderne [sind] Produkte der Technik“. Von Technotext hat er meines Wissens nicht gesprochen, weil er Text mit Inhalten verbindet und LLM noch nicht kannte. (zurück)
16) Es gibt sehr viele Menschen, die beispielsweise die Sütterlinschrift als quasi kalligrafisches Hobby pflegen. (zurück)
17) Der Papagei der Sätze reproduziert muss ja auch keine Wörter kennen. (zurück)
18) Autopoiese ist ein Kunstwort, das quasietymologisch für „(sich) selbst-erzeugt“ (auto-poiesis) steht, das ursprünglich von H. Maturana zur Charakterisierung von Leben eingeführt wurde, aber in einem weiteren Sinn als Eigenname für spezielle Theorien der Selbstorganisation verwendet wird. (zurück)
19) In naturhistorischen Zeiträumen mag sich unter evolutionstheoretischen Gesichtspunkten natürlich auch der Mensch weiterentwickeln, aber im historischen Zeitraum kann ich keinerlei Entwicklung des Menschen als biologisches Wesen erkennen. Ich wüsste nicht, inwiefern ich „entwickelter“ sein sollte als beispielsweise die „alten Griechen“, deren Philosophen auch zeigen, dass nicht ernsthaft von einer geistigen Weiterentwicklung gesprochen werden kann. Was wir früheren Generationen voraus haben, sind Maschinen wie das Internet. (zurück)
20) Als Keimform bezeichne ich, was K. Holzkamp in der Grundlegung der Psychologie als Frühform bezeichnet hat. K. Holzkamp spricht auch von Vor-Form: "Wenn hier und im folgenden von »Vorformen« die Rede ist, so muß man sich vergegenwärtigen, daß den verschiedenen Erscheinungen ihr Charakter als »Vorform« nur rekonstruktiv, bei Kenntnis der jeweiligen (vorläufigen) »Endform«, zugesprochen werden kann. K. Marx spricht von einer Keim(form): "Der Gebrauch und die Schöpfung von Arbeitsmitteln, obgleich im Keim schon gewissen Tierarten eigen, charakterisieren den spezifisch menschlichen Arbeitsprozess, und Franklin definiert daher den Menschen als "a toolmaking animal", ein Werkzeuge fabrizierendes Tier" (MEW 1867:194). (zurück)
21) Eine umfassende Darstellung zur Entwicklung der Arbeit im modernen Produktionsprozess gibt H. Braverman im gleichnamigen Buch (zurück)
2. Textproduktion
2.1 Schreibwerkzeug
Beim Schreiben kann ich Werkzeuge verwenden. Viele Tätigkeiten wie etwa Schneiden oder Schweissen kann ich ohne Werkzeuge gar nicht ausüben, weil ich diese Tätigkeiten gerade durch den Gebrauch von jeweilig spezifischen Werkzeugen von anderen Tätigkeiten unterscheide. Schreiben kann ich zur Not auch ohne Werkzeug, obwohl das deutsche Wort quasietymologisch auf scriban zurückgeht, was auf das Schreiben mit einem Griffel verweist.(1)
Wo immer ich Werkzeuge verwende, entwickelt sich die Tätigkeit mit der Entwicklung der Werkzeuge, die ich verwende. Die Entwicklung der Werkzeuge betrachte ich unter dem Gesichtspunkt einer Ausdifferenzierung, durch die bestimmte Aspekte der Tätigkeit aufgehoben werden.
Da ich beim Schreiben ein Artefakt herstelle, brauche ich zwangsläufig ein Material, das ich formen kann und etwas weniger unmittelbar eine Unterlage, durch die das Artefakt getragen wird. In der noch ganz unentwickelten Form ist die Unterscheidung zwischen Textmaterial und Textträger noch aufgehoben, weil ich beispielsweise mit meinem Finger in den Sand schreibe, also den Textträger selbst forme. Sand ist weich genug, dass ich mit meinem Finger schreiben kann.
Allerdings ist das nicht sehr nachhaltig, eine Welle am Strand oder etwas Wind lassen den Text wieder verschwinden. Wenn ich einen Meissel verwende, kann ich härteres Material wie Holz, Stein oder Fels ritzen, was mein Schreiben nachhaltiger macht. Was geschrieben wird, soll noch eine bestimmte Zeit sichtbar vorhanden sein.
Man könnte sagen, dass der Meissel beim Schreiben den Finger ersetzt, ich neige eher dazu zu sagen, dass der Finger in der Not den Meissel ersetzt, weil  beim Schreiben für mich in der Nachhaltigkeit des Geschriebenen ein Sinn des Schreibens liegt. Wie auch immer, der Meissel ist ein Werkzeug.
wenn er nicht ein zufällig aufgelesener Stein mit einer scharfen Kante ist. Der Meissel zeigt in einer rohen Form, was ich auch beim Schreiben ohne Meissel mache. Ich mache Striche, die ich später wieder sehen will. Ich kann sagen, dass ich Striche mache, die mich an etwas erinnern sollen. Dann spreche ich nicht nur darüber, was ich mache, sondern auch über eine Funktion der Striche, oder allgemeiner nicht nur darüber wie, sondern darüber, warum ich schreibe. beim Schreiben für mich in der Nachhaltigkeit des Geschriebenen ein Sinn des Schreibens liegt. Wie auch immer, der Meissel ist ein Werkzeug.
wenn er nicht ein zufällig aufgelesener Stein mit einer scharfen Kante ist. Der Meissel zeigt in einer rohen Form, was ich auch beim Schreiben ohne Meissel mache. Ich mache Striche, die ich später wieder sehen will. Ich kann sagen, dass ich Striche mache, die mich an etwas erinnern sollen. Dann spreche ich nicht nur darüber, was ich mache, sondern auch über eine Funktion der Striche, oder allgemeiner nicht nur darüber wie, sondern darüber, warum ich schreibe.
Wenn ich mit einem Meissel statt mit dem Finger schreibe, muss ich weniger drauf achten, dass mein Text erhalten bleibt. So realisiere ich, dass ich beim Schreiben auch die implizite Aufgabe erfülle, den Text aufzubewahren, und dass ich das besser oder schlechter machen kann.
In einer etwas entwickelteren Form des Schreibens variiere und kombiniere ich die Striche, so dass verschiedene Zeichenkörper entstehen. Der Meissel wird dabei zunehmend unhandlich. Ich kann aber auch beobachten, dass die Verwendung von „Farben“ die Ausdifferenzierung von verschiedenen Zeichenkörper besser zugelassen hat. Wenn ich mit „Farbe“ schreibe, was ich wiederum im engeren Sinne von Hand, also mit dem Finger machen kann, brauche ich andere Werkzeuge als den Meissel. Zuerst aber brauche ich „Farbe“. Als Farbe bezeichne ich in diesem Zusammenhang ein farbiges Material, das ich gut auf einer geeigneten Unterlage auftragen kann. Solange die „Farbe“ in einem Behälter ist, ist sie leicht als dreidimensionales Material zu erkennen. Und wenn ich dieses Material in einer dünnen Schicht auf ein Trägermaterial auftrage, verliert es sein Materialsein natürlich nicht.
Den Ausdruck „Farbe“ verwende ich für zwei ganz verschiedene Sachen. Einerseits bezeichne ich das Material und andrerseits die Farbe des Materials. Eine naturwüchsige Farbe, die sich zum Schreiben eignet, ist – rotes – Blut, eine hergestellt Farbe heisst Tinte, die auch rot sein kann. Die Variation des Farbmaterials ist nicht nur in Bezug auf die Farbe enorm. Die verschiedenen Materialien verlangen auch verschiedene Werkzeuge, die ich vorerst ganz grob als Pinsel bezeichne.
Die Farbe wird zum Material des Textes, der einen Träger braucht. Ich trenne damit den Text von seinem Träger und unterscheide deshalb, ob ich vom einen oder dem andern spreche. Schreiben mit Farbe verlangt nicht unbedingt ein Werkzeug, aber es verlangt – tautologischerweise – ein Farbmaterial, das ich forme, während ich den Textträger dabei nicht willentlich verforme.
Ziemlich alte Dokumente sind Höhlen- oder Felsmalereien, bei welchen durch farbige Oxide gefärbte Tonerden verwendet wurden, die sozusagen als natürlich Farben gegeben waren. Als nachhaltige Träger solcher Artefakte erweisen sich beispielsweise die Wände der berühmten Höhle von Lascaux, die relativ trocken sind, da sie von einem Mergelhorizont gegen Wasserinfiltration abgedichtet sind, wodurch auch kein nennenswerter Kalzitüberzug entstehen kann. Dass diese „Texte“ nach mehr als tausend Jahren noch lesbar sind, ist nicht nur vom Material des Textes, sondern auch von der Beschaffenheit des Textträgers abhängig. Die Höhlenwände sind nicht hergestellt sondern naturwüchsige Textträger, die nur gewählt, nicht gemacht wurden. Die Beobachtung des Textträgers entwickelt sich, wo dieser als Kultur hergestellt wird, zunächst als Pergament oder Papier.
Wenn ich den Text an der Höhlenwand von Lascaux lesen will, muss ich diese Höhle besuchen. Wenn ich aber nur den Text, der dort geschrieben wurde, lesen will, kann ich auch eine Abschrift lesen. Auf diese Differenz komme ich später im Zusammenhang mit Buchdruck und Computer sehr ausführlich zurück. Zunächst will ich zwei Raumprobleme behandeln.
Das eine Raumproblem entsteht dadurch, dass der Text und der Textträger in vielen Fällen so verbunden sind, dass sie nicht getrennt werden können. In diesem Sinne ist der Textträger dann Teil einer chemischen Verbindung und damit natürlich auch verformt. In diesen Fällen kann ich den Text nur transportieren, wenn oder indem ich den Textträger transportiere. Das macht bestimmte Textträger, etwa Höhlenwände sehr unpraktisch, weil der Leser zum Text muss anstelle davon, dass der Text zum Leser kommt.
Ein zweites räumliches Problem, das ich nur erwähnen und auch später behandeln werde, besteht darin, dass ich beim Schreiben ein Textfeld erzeuge oder impliziere, in welchem ich den Text anordne. „Unterschrift“ deute ich in diesem Sinne als „Schrift“, die unten, „unter“ anderer Schrift platziert wird. Wenn ich nur Striche an die Höhlenwand mache, muss ich sie später wieder finden, wozu ich mir deren Lage auf der Wand merken muss. Wenn ich komplizierte Zeichen verwende, spielt eine Rolle, wo bestimmte Striche in Relation zu anderen Strichen stehen. Zeichen erscheinen so als Konstellationen von Zeichen.
Wenn ich Text transportieren will, muss ich in vom Träger lösen oder den Textträger transportierbar machen. Der Stein von Rosette ist ein Beispiel für gemeisselten und doch transportierbaren Text, der überdies noch andere Textkriterien sichtbar macht. Eine Form des Textträgers, die grosse Verbreitung gefunden hat, ist in der entwickelten Form Papier, das zunächst als Tierhaut, Pergament oder als Papyrus naturnähere, aber auch schon mehr oder weniger bearbeitete Formen hatte. Papier ist ein Textträger, dessen Herstellung industriell entwickelt wurde, nachdem es zunächst ein Handwerksprodukt war.
Während die Schreibwerkzeuge eine grosse Entwicklung durchlaufen haben, hat sich beim Textträger lange Zeit nur dessen Produktion entwickelt. Papier ist als Textträger erst auf der Stufe der Computertechnik, etwa in der Idee des papierlosen Büros, aber dann vor allem durch das Internet problematisiert worden. Aber die Papierherstellung hat eine enorme Entwicklung durchlaufen. Ich selbst habe mich beruflich eine Zeitlang mit der Konstruktion von Pulpern beschäftigt.[1]
Papier als Textträger hat auch das Textmaterial weitgehend bestimmt, es ist Tinte, die in verschiedenen Viskositäten verwendet wird, was im Wesentlichen durch die jeweiligen Schreibwerkzeuge bestimmt wird. Tinte durchläuft natürlich auch eine Entwicklung, die aber von Auge kaum erkennbar ist, weil sie nur die chemische Zusammensetzung betrifft. Auf einem Brief, den ich mit meinem PC-Drucker ausgedruckt habe, ist kaum zu sehen, ob ich einen Laser- oder einen Inkjet-Drucker benutze. Der Text erscheint als Tinte, auch wenn ganz verschiedene Verfahren und Materialien verwendet werden.
Papier – auch in den noch nicht entwickelten Formen – erlaubt nicht nur den Transport von Text, sondern – mit entsprechenden Werkzeugen – auch eine Vereinfachung des Schreibens. Für Tinte als Textmaterial eignen sich Pinsel. Anfänglich scheinen auch Vogelfedern als Pinsel verwendet worden zu sein. Dann merkte wohl ein praktischer Schreiber, dass der Federkiel besser geeignet ist oder anstelle von Schilfrohr eingesetzt werden kann. Der Federkiel wurde dann durch eine hergestellte „Feder“ aus Metall ersetzt, die sinnigerweise auch Feder genannt wurde.
Tinte in flüssiger Form hat ein paar Nachteile, sie tropft und schmiert. Und sie muss in einem Behälter aufbewahrt werden. In festerer Form gibt es Kreide und Bleistift. Beides ist nicht so nachhaltig wie Tinte, weil sich das Material mit dem Papier weniger stark verbindet. Bleistiftgeschriebener Text kann dafür gut radiert werden. Es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die auf dieser Stufe noch als Vor- oder Nachteile der verschiedenen Werkzeuge gesehen werden können, weshalb es auch verschiedene dieser Werkzeuge nebeneinander gibt. Die Entwicklung hat auch Füllfederhalter, Kugelschreiber und Filzstifte hervorgebracht.
Eine Art Mischung zwischen Einritzen und Auftragen, die für die weitere Entwicklung wichtig ist, ist das Siegel, bei welchem die „Tinte“ in Form von Wachs ohne Struktur auf das Papier aufgetragen wird, um danach in eine Form gebracht zu werden, durch Prägung, was in gewisser Weise dem Einritzen eines Musters entspricht. In dieser Kombination der beiden Verfahren erkenne ich einen Übergang zu einer entwickelteren  Art des Schreibens. Es wird dabei nicht das Trägermaterial bearbeitet, aber das Textmaterial wird so bearbeitet, wie das mit einem Meissel passiert. Art des Schreibens. Es wird dabei nicht das Trägermaterial bearbeitet, aber das Textmaterial wird so bearbeitet, wie das mit einem Meissel passiert.
Ich habe bisher stark auf das Material von Text und Textträger fokussiert. Ich will - in einem kleinen Exkurs - deshalb genauer erläutern, was ich als Material bezeichne. Das scheint mir umso notwendiger als der Ausdruck jenseits des Themas Schreibens sehr verschieden verwendet wird und die damit bezeichnete Sache bei Text kaum je beachtet wird.
Material und Form im Kontext des Herstellens
Ich verwende den Ausdruck Material komplementär zu Form. Die herstellende Tätigkeit begreife ich als Formen. Egal, was ich herstelle, das dabei entstehende Artefakt hat eine durch das Herstellen bewirkte Form. Formen kann ich nicht überhaupt, ich forme immer etwas. Und das, was ich forme, bezeichne ich als Material. Was ich als Material bezeichne ist also gewissermassen die Kehrseite des Formens.
Der Ausdruck Material begegnet mir – oft missverständlich – im Ausdruck Materialismus. Als Materialismus bezeichne ich eine Weltanschauung, in welcher Material eine orientierende Rolle spielt. Ich unterscheide sehr verschiedene Formen des Materialismus, die dann auch den Ausdruck Material sehr verschieden verwenden.
Der mir geläufigste Materialismus bezeichnet – metaphorisch – die Orientierung am Geld. Materialisten tun alles für Geld, ohne dabei Geld als Material zu sehen. Dann gibt es einen Materialismus, der die Materie ins Zentrum stellt. Diese Sichtweise beherrscht einen grossen Teil der Naturwissenschaften. Materie ist aber ein ganz anderes Wort als Material. Ich weiss nicht, was Materie ist, ausser dass sie aus Atomen besteht, wobei ich keine Ahnung von Atomen habe. F. Heider – der kein Materialist sein wollte – hat das Geformte als Ding bezeichnet und anstelle von Material den Ausdruck Medium verwendet. Das ist von vielen Sozialwissenschaftlern, die auch keine Materialisten sein wollen, übernommen worden. Differenztheoretisch kann „Material“ durch die Differenz zwischen Material und Medium gesehen werden, wobei Medium für die nicht aktualisierte Form steht, also keine Eigenschaft hat, während die Materialbezeichnung Eigenschaften benennt und auch eine konkrete Form impliziert.
Als Form bezeichne ich in einem operativen Sinn, genau das, was ich zeichnen kann. Jede Zeichnung repräsentiert die Form. Jede Zeichnung ist aber auch ein Artefakt. Sie hat also selbst eine Form und besteht aus Material.
Da ich Material beim Herstellen von Artefakten forme, muss es formbar und im festen Aggregatzustand anfassbar sein. Das Wort Material wird in der Philosophie oft synonym zu Stoff, Substanz oder Materie verwendet. Es wurde schon in der antiken Philosophie oft als Träger von substanzlosen Eigenschaften bestimmt. Materialien wie etwa Bronze und Silber, oder allgemeiner wie Metalle sind in diesem Sinne Verdinglichungen (Hypostasierung) von Eigenschaften, die ich – quasi-ontologisch formuliert – am Material wahrnehme. „Metall“ bedeutet in diesem Sinne „glänzend, stromleitend, schwer, …“ und „Silber“ bedeutet „Metall, helle Farbe, nicht oxidierend, …“.[2]
Im festen Aggregatzustand hat Material immer eine Form. Das Referenzobjekt des Ausdruckes Bronze etwa kann als Barren, Klumpen, Ohrring oder Statue existieren. Ich kann beispielsweise Eisen flüssig machen, dann nimmt es die Form der Gussform an, aber eben nur insofern, als es beim Abkühlen diese Form behalten würde. Solange es flüssig ist, hat es keine Form.
Wenn ich beispielsweise beim Schreiben Tinte verwende, ist sie flüssig. Ich giesse sie aber nicht in eine Form, sondern benutze deren Eigenschaft, dass sie rasch trocknet und damit fest wird, wenn ich sie in kleinen Mengen auf Papier auftrage. Ein i-Punkt aus Tinte ist, gerade nachdem ich ihn geschrieben habe, ein noch flüssiger Tropfen auf einer Unterlage, der als abgegrenzte Menge bereits wie ein fester Körper, wie eine abgeflachte Halbkugel erscheint. Beim Herstellen von Artefakten verwende ich oft die Formbarkeit von Materialien in flüssiger oder weicher Form. Gusseisen- und Töpfereiartikel sind typische Beispiele.
Wenn ich vom Material spreche, abstrahiere ich generell von dessen Form. Ich spreche auch von Material, wenn ich den vorübergehenden Zustand während des Formens ausser Acht lasse.
Viele Materialien haben eine Verarbeitung hinter sich, sie wurden hergestellt. Das ist für ihr Materialsein aber unerheblich. Ich unterscheide einige Fälle. Metalle finde ich gemeinhin als Erze, die ich durch schmelzen trennen muss. Das getrennte oder reine Metall hat dann normalerweise eine Gussform, typischerweise als Barren. Tonerde kann ich direkt abbauen. Weil sie weich ist, kann ich sie formen und danach durch brennen, hart machen. Tinte beispielsweise ist ein hergestelltes Gemisch aus einer Flüssigkeit und Farbstoff, das selbst noch flüssig ist. In all diesen Fällen spreche ich von einem Material unter dem Gesichtspunkt, dass ich es zum Herstellen von Artefakten verwende. Wenn ich vom Herstellen abstrahiere, erscheinen mir Materialien als naturwüchsige Stoffe, die ich physikalisch oder chemisch beobachten kann, was hier aber nicht weiter interessiert.
Material, das aus einer Verarbeitung folgt, bezeichne ich als Werkstoff. Werkstoffe haben eine (Proto)-Form, die noch keinem bestimmten Gebrauch entspricht, weshalb ich auch von Halbfabrikaten spreche. Die Herstellung von Gebrauchsgegenständen ist oft in getrennte Operationen zerlegt. Das Abbauen von Erz, das Gewinnen von Metall und das Herstellen von Nadeln oder Schrauben sind zerlegte Operationen einer Herstellung von verschraubten Artefakten. Diese Protoformen, die als Werkstoffe oder Halbfabrikate verwendet werden, sind nicht „konstruiert“, sondern sozusagen materielle Urformen.
Von einem Medium spreche ich in diesem Sinn, wenn ich das Material nicht nur nicht von seiner Form unterscheide, sondern auch von dessen Materialeigenschaften abstrahiere. Wenn ich die Formseite der Unterscheidung markiere, repräsentiert die Form das Bestimmte, während das Medium das unspezifische Potential zur Formgebung darstellt. Die Form bestimmt Eigenschaften, die dem Material nicht zukommen. Wenn ich ein Messer forme, forme ich die Eigenschaft „schneidend“.
Wenn ich meinen Körper durch Diät, Bodybuilding oder Verstümmelung forme, ist der Körper Medium in verschiedenen Formen, aber dabei wird kein Material gewählt. Wenn dagegen der berühmte Genfer Arzt
Frankenstein eine Kreatur herstellt, muss er sich überlegen, ob er das aus Lehm (Golem), Holz (à la Pinocchio), Puppenmaterial (im Sandmann) oder aus Teilen, die er Friedhof ausgräbt, verwenden soll. Er braucht also Material. Und wenn ich eine Prothese für ein Bein oder ein Herz herstelle, muss ich wählen unter Stahl, Plastik usw. also unter Materialien. Als Artefakte bezeichne ich Gegenstände, die auf einer Materialwahl beruhen – und ausserdem noch auffindbar sind, was bei Frankensteins Monster und dessen Variationen ja nicht der Fall zu sein scheint.
Ich bezeichne meinen Materialismus in Anlehnung an K. Marx als „historischen Materialismus“, in welchem ich als Subjekt und meine Tätigkeit im Zentrum steht. Mit historisch bezeichne ich dabei einerseits eine Abgrenzung zu einem naturwissenschaftlichen Materieverständnis und andrerseits, dass jede artefaktische Formgebung Teil eines Prozesses ist, der sich als Produktion historisch entwickelt. Den Produktionsprozess beschreibe ich einerseits als Entwicklung der Produktionsmittel und andrerseits als Differenzierung in Bezug auf mich als tätiges Subjekt. Schreiben als Textherstellung ist ein exemplarisches Thema dafür.
Naturhistorische und sozialhistorische Entwicklung
Wenn ich Schreiben als Handwerk bezeichne, bezeichne ich in gewisser Hinsicht einen spezifischen Moment einer logisch dort geteilten Entwicklung. Zunächst geht es um die Autopoiese der Schrift, das heisst darum, dass Schreiben überhaupt als Tätigkeit entstanden ist. Danach geht es darum, wie sich diese Tätigkeit ausdifferenziert. Wenn ich beispielsweise von der Entwicklung des Menschen spreche, unterscheide ich in diesem Sinne eine naturhistorische Entwicklung innerhalb des Tierreiches, die mit dem Auftreten des Menschen abgeschlossen ist, und eine sozialhistorisch Entwicklung des Menschen, die mit dem Auftreten des Menschen beginnt und in welcher sich nicht mehr der Mensch, sondern dessen Lebensverhältnisse als Kultur entwickeln. Menschen kann ich beispielsweise – wenn mir das gefällt – als toolmaking animals sehen. Dann beobachte ich im Tierreich eine Entwicklung hin zur Verwendung von Objekten, welche am Schluss den Menschen als Herstellenden hervorbringt, und eine zweite Entwicklung, in welcher sich die Menschen dadurch entwickeln, dass sie ihre Werkzeuge entwickeln.
Wenn ich mich in diesem Sinne als schreibendes Tier begreife, unterscheide ich eine quasi naturhistorische Entwicklung, welche mit der Verwendung von Symbolen abgeschlossen ist, und sozialhistorische Entwicklung, in welcher Symbole sich als Gegenstand der sozietalen Produktion entwickeln.[3]
Als Handwerk bezeichne ich eine Produktionsform ohne bewusste betriebliche Arbeitsteilung, in welcher der jeweilige Handwerker als Meister seines Faches den gesamten Arbeitsprozess beherrscht. Al Huang beispielsweise betont die Wichtigkeit, das er als Kalligraf die vier Produktionsmittel Schreibpinsel, Stangentusche, Reibstein und Papier, die auch Schätze des Gelehrtenzimmers genannt werden, selbst herstellen sollte. Beim praktischen Üben sollte wenigstens die Tinte immer selbst angemacht werden.
Das Handwerk selbst begreife ich als eine Ausdifferenzierung der ursprünglichen Aneignung, in welcher hergestellte Hilfsmittel oder Werkzeuge verwendet wurden, womit deren naturgeschichtliche Phase abgeschlossen war. Eigentliches Handwerk entsteht mit der natürlichen Arbeitsteilung, die gewerbliche Berufe wie Müller, Bäcker oder Schmied hervorbringt. Das ursprüngliche Handwerk des Schreibens besteht in diesem Sinne darin, einen Meissel herzustellen, eine geeignete Felswand oder einen geeigneten Stein zu finden und die Zeichen einzuritzen. Oder wenn mit Farbe auf Papyrus geschrieben wurde, musste Farbe, Pinsel und Papyrus hergestellt und dann verwendet werden.
Nachdem Farbe, Pinsel und Papyrus je ein eigenes Gewerbe geschaffen haben, musste der Schreibhandwerker diese Mittel erwerben, wozu er sie beurteilen können musste.  Seine Tätigkeit im engeren Sinne war dann das Herstellen der Zeichenkörper. Wenn ich als Schmied einen Pflug herstelle, muss ich das Metall entsprechend bearbeiten können. Ich muss aber natürlich auch wissen, wozu der Pflug gebraucht wird und welche Form er deshalb haben muss. Wenn ich einen Text herstelle, muss ich beispielsweise die Tinte entsprechend verarbeiten können, ich muss aber natürlich auch wissen, was der Text bewirken soll und welche Form er deshalb muss. Ich bezeichne mich dann als Handwerker, wenn ich alle Aspekte dieser Tätigkeit erfüllen kann. Eine erste Form der betrieblichen Arbeitsteilung, die das Handwerk zerlegt, habe ich schon angesprochen. Der Klosterbruder, der im Skriptorium abschreibt, während ein anderer seine Texte rubriziert. Im späteren Gerichtsschreiber sehe ich ein Art Inversion zu dieser Zerlegung eines Handwerkes in einem neuen Kontext. Seine Tätigkeit im engeren Sinne war dann das Herstellen der Zeichenkörper. Wenn ich als Schmied einen Pflug herstelle, muss ich das Metall entsprechend bearbeiten können. Ich muss aber natürlich auch wissen, wozu der Pflug gebraucht wird und welche Form er deshalb haben muss. Wenn ich einen Text herstelle, muss ich beispielsweise die Tinte entsprechend verarbeiten können, ich muss aber natürlich auch wissen, was der Text bewirken soll und welche Form er deshalb muss. Ich bezeichne mich dann als Handwerker, wenn ich alle Aspekte dieser Tätigkeit erfüllen kann. Eine erste Form der betrieblichen Arbeitsteilung, die das Handwerk zerlegt, habe ich schon angesprochen. Der Klosterbruder, der im Skriptorium abschreibt, während ein anderer seine Texte rubriziert. Im späteren Gerichtsschreiber sehe ich ein Art Inversion zu dieser Zerlegung eines Handwerkes in einem neuen Kontext.
Als eigentlicher Schreibhandwerker fungiere ich typischerweise noch, wenn ich von Hand einen Liebesbrief schreibe und dabei sowohl die Adressatin und den Zeitpunkt, aber auch die Farbe des Briefpapiers und sowie die Worte, die ich schreibe, nach bestem Wissen wähle und quasi berufsmässig – was heute professionell heisst – gestalte. Von Hand heisst dabei – nicht ganz selbstverständlich – dass ich beispielsweise einen Füllfederhalter verwende, den ich mit meiner Hand über das Papier führe und eben nicht mit dem Finger Tinte auftrage. Ich bin dann sozusagen Herr über meine Textproduktion, auch wenn ich Papier und Füllfederhalter mit Tinte erworben habe. Um dieses Handwerk auf einem bestimmten Niveau ausführen zu können, musste ich eine entsprechende Lehrzeit durchlaufen und auch danach, quasi als Gesell noch einiges hinzulernen.
Als Handwerker bezeichne ich jemanden, der seinen Körper so im Griff hat, dass er bezüglich der Herstellung seiner Produkte machen kann, was er plant. Das umschliesst, dass ich als Handwerker meine Produkte plane, also auch weiss, wozu ich sie herstelle. Im Falle des Liebesbriefes weiss ich natürlich wenig darüber, wie er von der Adressatin gelesen und interpretiert wird, aber ich habe schreibenderweise den Sinn des Briefes als Plan vor Augen. Und ich stelle meinen Text mit meinem Werkzeug her.
Man mag mir sagen, dass ich nur Wörter aus der Sprache verwenden kann und dass ich in diesem Sinne nicht frei sei. Darin erkenne ich – was Plato schon für jedes Handwerke erkannt hatte – dass ich mich meiner Absicht unterwerfe. Text ist wie jedes Artefakt Gebrauchsbedingungen unterworfen. Philosophen können dann erkennen, das ich eine „Sprache“ verwende, die sie als etwas Soziales bezeichnen. Wenn ich als Handwerker schreibe, ist aber vollständig gleichgültig, was sich Philosophen als Sprache ausdenken und wie "gesellschaftlich" diese Sprache sein soll. Ich stelle ein Produkt her, das seinen Zweck erfüllen kann, wenn sein Sinn gefragt wird. Wenn ich ein Brücke baue, können die Philosophen mir ihre naturwissenschaftliche Materie zugrunde legen, aber die Brücke baue ich zweckmässig aus Material, gleichgültig, was Physiker dazu sagen. Die Philosophen fragen nach den Bedingungen der Möglichkeit. Sie fragen sich beispielsweise, weshalb ich einen Brief schreiben kann und welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen. Das sind recht eigenartige Fragen, nachdem ich das Briefschreiben bereits praktiziere. Wozu sollte ich über die Bedingungen der Möglichkeit nachdenken?
Das ursprüngliche Handwerk stellt ganze Gegenstände her. Die Aufhebung des Handwerkes, die ich hier beobachten will, bezeichne ich als betriebliche Arbeitsteilung. Diese Arbeitsteilung - die keine Arbeitsteilung im eigentlichen Sinn ist - hat historisch zwei komplementäre Gründe: die Entwicklung der Werkzeuge und die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse.
Eigentliches Handwerk wurde beim Meister gelernt, während ich das Schreiben teilweise in der Schule lernen musste, und dort nur selten Meister erkannt habe. Ein Meister nimmt einen Lehrling, wenn der Lehrling in den Augen des Meisters passt. Als Schullehrer im institutionalisierten Sinn bin ich ein Lohnarbeiter, der Schüler zugewiesen bekommt, von welchen ich annehmen muss, dass ein grosser Teil nicht passen, sondern durch Zwang, der Erziehung genannt wird, angepasst werden. Diese Anpassung, die ich als Schüler und als Lehrer mit Unbehagen erlebte, besteht darin, das Handwerk aus dem Bewusstsein zu verdrängen und stattdessen philosophisch-wissenschaftliche Ideologien einzuüben, die den Menschverstand kränken. Dass die Erfindung der Schule mit dem Ende des Handwerkes zusammenfällt, scheint mir kein Zufall zu sein.
Gemeinhin finde ich unterstellt, dass der sogenannte Buchdruck das Handwerk des Schreibens aufgehoben habe. In dieser Vorstellung hat J. Gutenberg den „Buchdruck“ erfunden. Und noch gemeiner finde ich die Idee, dass J. Gutenberg damit die Wissensgesellschaft ermöglicht habe. J. Gutenberg müsste etwas differenzierter beobachtet, eher dafür berühmt sein, dass er in seiner Manufaktur mehrere technische Entwicklungen vereint und so Bücher als eigentliche Waren industriell produziert hat. So weit ich sehe, ist J. Gutenberg eine sagenhafte Figur, ihm eine Wissensgesellschaft zuzuschreiben scheint mir ähnlich sinnvoll, wie B. Gates für die Digitalisierung der Welt verantwortlich zu machen, weil er dem PC zum Durchbruch verholfen habe. J. Gutenberg und sein Buchdruck sehe ich als figürliche Metapher dafür, wie das spezifische Handwerk der Textproduktion aus dem Bewusstsein verdrängt wurde.[4]
Meine erste bewusste Handwerkserfahrung beim Schreiben machte ich – nachdem ich bereits gut schreiben konnte – in einer Legasthenietherapie, wo ich Buchstaben aus farbigem Plastilin herstellen musste. Ich sollte mir auf diese Weise die Gegenständlichkeit der Buchstaben bewusst machen und insbesondere, dass Gegenstände im Raum gedreht werden können, so dass beispielweise aus einem p ein d oder ein b wird. Dabei habe ich in einem wörtlichen Sinn mit den Händen begriffen, was Text ist. Ich habe auch erkannt, dass es nicht ganz einfach ist, die Buchstaben handwerklich schön herzustellen.
Wenn ich Plastilin zur Buchstabenherstellung verwende, verwende ich – was nicht im Sinne der Therapie gewesen wäre – sinnigerweise Ausstechformen, wie ich sie für Weihnachtsgebäck verwende. In Ausstechformen ist die Form wie in Schablonen vorgegeben. Die Ausstechform ist ein eigentliches Werkzeug, während die Schablone ihren Werkzeugsinn komplementär erfüllt, etwa mit einem Tuschzeichenwerkzeug zusammen, wie ich es als Maschinenzeichner benutzte. Ausstechformen habe ich in Bezug auf Schreiben bislang gar nicht kennengelernt, aber ich habe als Kind in der sogenannten Buchstabensuppe Teigwaren mit Buchstabenform gegessen, nachdem ich jeweils ein bisschen damit gespielt haben.
Nachdem ich Buchstaben aus Plastilin hergestellt habe, habe ich verstanden, was ich mit einem Bleistift oder mit einem Füllfederhalter wirklich mache. Ich stelle Gegenstände her, indem ich Material zu Buchstaben forme. Im Bleistift sehe ich eine raffinierte Technik, in welcher das Werkzeug das Material, das ich verarbeite gespeichert hat und in der gewünschten Menge freigibt. Das ist auch bei vielen entwickelteren Schreibwerkzeuge der Fall.
Eine Art Inversion zur Ausstechform sehe ich in der Verwendung eines Siegelringes, mit welchem auch eine Form in einem Textmaterial reproduziert wird. Das Siegel wird als Stempel nochmals invertiert, weil der Stempel, der wie ein Siegel aussieht, anders verwendet wird. Mit dem Stempel, der die Drucktype vorwegnimmt, forme ich nicht zuvor aufgetragenes Material, sondern übertrage das Material in der bereits richtigen Form. Anders als beim Bleistift ist das Textmaterial nicht im Stempel enthalten, sondern muss durch ein Kissen aufgenommen werden.
Wenn ich beim Drucken eine Drucktype verwende, trage ich das Textmaterial auf den Drucktypkörper auf, wodurch der jeweilige Buchstabe auf 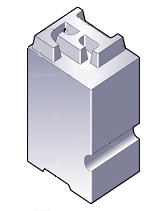 dem Typ gebildet wird. Danach drucke ich den Buchstaben mittels der Drucktype auf das Papier. Ich muss dabei drücken, damit der Buchstabe sich mit dem Papier verbindet und sich von der Drucktype löst. Die Druckfarbe muss dazu zunächst auf der Drucktype hinreichend konsistent sein, um einen Buchstaben zu bilden und sie darf an der Drucktype nur so fest haften, dass sie auf das Papier übertragen werden kann. dem Typ gebildet wird. Danach drucke ich den Buchstaben mittels der Drucktype auf das Papier. Ich muss dabei drücken, damit der Buchstabe sich mit dem Papier verbindet und sich von der Drucktype löst. Die Druckfarbe muss dazu zunächst auf der Drucktype hinreichend konsistent sein, um einen Buchstaben zu bilden und sie darf an der Drucktype nur so fest haften, dass sie auf das Papier übertragen werden kann.
Als Drucktype (oder Letter) bezeichne ich dabei ein Werkzeug, das das erhabene, spiegelverkehrte Bild eines Schriftzeichens trägt. Ich unterscheide zwei Verwendungsarten. Die eine, die ich als konventionelles Drucken bezeichne, habe ich gerade erläutert. Die andere Verwendung mache ich in der Schreibmaschine, wo die Farbe auf einem Farbband gespeichert ist und mittels der Drucktype auf den Textträger geschlagen wird. Beim Drucken wird der fertige Buchstabe auf Papier gedrückt, während bei der Schreibmaschine der Buchstabe erst auf dem Papier – in einer dem Stanzen analogen Art – hergestellt wird.
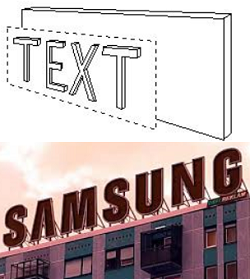 Schliesslich gibt es noch eine handwerkliche Form, um Buchstaben herzustellen. Ich kann Buchstaben giessen. Dazu brauche ich Giessformen der Buchstaben, die ich mit einem flüssigen Material fülle, das dann fest wird. Mir fällt gerade keine Fall ein, indem so geschrieben wird, aber die Drucktypen wurden ursprünglich so hergestellt. Das entspricht einer Erfindung, die J. Gutenberg zugeschrieben wird. Schliesslich gibt es noch eine handwerkliche Form, um Buchstaben herzustellen. Ich kann Buchstaben giessen. Dazu brauche ich Giessformen der Buchstaben, die ich mit einem flüssigen Material fülle, das dann fest wird. Mir fällt gerade keine Fall ein, indem so geschrieben wird, aber die Drucktypen wurden ursprünglich so hergestellt. Das entspricht einer Erfindung, die J. Gutenberg zugeschrieben wird.
Es gibt aber natürlich Text aus Buchstaben, die ganz offensichtlich hergestellte Körper sind, beispielsweise als Firmenlogos auf Hausdächern, die dann die Buchstaben tragen. In solchen Fällen spreche ich bei der Herstellung nicht von Schreiben, weil andere Tätigkeiten in den Vordergrund rücken. Aber natürlich wird auch dabei Text hergestellt.
Als historische Geschichte hat die Geschichte, die ich hier erzähle, eine dunkle Vorzeit, in welcher das Schreiben entstanden ist oder erfunden wurde. Als evolutionäre Geschichte dagegen erzähle ich die Geschichte anhand von Ereignissen, die sich logisch oder genetisch folgen, wobei weder Datierungen noch Ursachen, sondern nur Ausdifferenzierungen von Interesse sind. Ich beobachte hier, wie das Handwerk des Schreibens zerlegt und in Maschinen aufgehoben wurde. Am Anfang dieser Entwicklung steht das Handwerk mit einfachen Werkzeugen.
Die Auflösung des Handwerkes betrifft nicht nur das Schreiben, sondern alle Bereiche der Technik. Die konventionelle Geschichtsschreibung tabuisiert diesen Prozess durch die Erfindung einer Renaissance. Im Ausdruck Renaissance finde ich gut festgehalten, dass es keine plausible Erklärung dafür gibt, wie und warum im 15. Jahrhundert kapitalistische Gesellschaften entstanden sind, die die Technik industriell zu nutzen angefangen haben. Wiedergeburt verschiebt das Problem in eine Zeit, von der ich noch viel weniger wissen kann, weil sie noch weiter zurückliegt. Ich kann allerdings ohne weiteres damit leben, nicht zu wissen, warum die industrielle Organisation der Produktion im 15. Jahrhundert begonnen hat. Ich habe ja auch keine Ahnung davon, wann und warum das Schreiben erfunden wurde oder warum es Menschen auf der Erde gibt. Ich lese die Gutenberg-Saga als narrative Entwicklungsgeschichte, in welcher Figuren diasynchron Ereignisse durchlaufen, wodurch die Ereignisse in einem sinnstiftenden Zusammenhang gestellt werden. Ich mache mir damit auch bewusst, dass die beobachteten Ereignisse nicht per se verbunden sind, sondern dass ich sie vielmehr erst im Prozess einer – zurückblickenden – Rekonstruktion so verbinde, dass ich mich in meinem aktuellen Leben orientieren kann.
In der konventionellen Geschichtsschreibung der letzten zweihundert Jahre, insbesondere seit die Ideologie der Renaissance Verbreitung gefunden hat, wird dem Buchdruck viel Bedeutung zugemessen. Es wird dabei sehr gerne übersehen, dass der Buchdruck eine technische Entwicklung darstellt, die auf dem Wissen aus Büchern, die von Hand vervielfältigt wurden, beruht. Der Buchdruck ist viel mehr ein Folge der technischen Entwicklung als dessen Voraussetzung.
Bücher und Zeitungen werden von wenigen geschrieben und allenfalls von vielen nur gelesen. Der Buchdruck ist in diesem Sinne ein Mittel einer sehr spezifischen, durch Massenmedien organisierten Gesellschaft. Immerhin scheint die Zeit der Vervielfältigung auf Papier allmählich zu Ende zu gehen. Die gedruckten Zeitungen sind im Prinzip schon tot. Und aus Büchern sind e-books geworden.
"Buchdruck" als effiziente Vervielfältigung von Text auf Papier, was in Form von Bücher und Zeitungen passierte, ist nur eine Funktion des Druckens. Eine andere, mittlerweile wichtige Funktion ist der Medienwechsel, in welchem etwa ein Bild auf ein T-Shirt oder ein Schriftzug auf Autotüren gedruckt wird, insbesondere aber auch, wenn ich einen Text im Computer einen Text auf Papier (aus)drucke, also den Textträger selbst wähle oder ändere.
Am Anfang dieser Entwicklung steht die Schreibmaschine. Wenn ich mit der Schreibmaschine – die ohne Motor gar keine richtige Maschine ist – schreibe, stelle ich die Buchstaben als Gegenstände auf dem Papier auch mit Drucktypen her. Bei der Schreibmaschine verwende ich die Drucktypen viel flexibler als beim Bleisatz-Verfahren, das J. Gutenberg eingeführt hat. Im Bleisatz muss ich von den einzelnen Buchstaben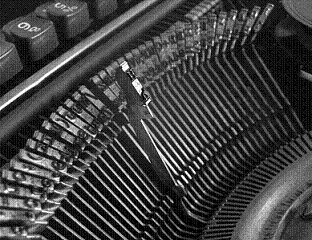 eine grössere Menge von Drucktypen haben, weil ich sie für das Drucken von Texten gleichzeitig brauche. Ich muss die Drucktypen alle setzen, bevor ich die Buchstaben auf dem Papier herstelle. Bei der Schreibmaschine verwende ich die Drucktypen genau dann, wenn ich die Buchstaben herstelle. Das Textmaterial kommt vom Farbband. Die Buchstaben werden nacheinander hergestellt, dabei brauche ich für jeden Buchstaben nur eine Drucktype, die ich durch die Tastatur bewege. eine grössere Menge von Drucktypen haben, weil ich sie für das Drucken von Texten gleichzeitig brauche. Ich muss die Drucktypen alle setzen, bevor ich die Buchstaben auf dem Papier herstelle. Bei der Schreibmaschine verwende ich die Drucktypen genau dann, wenn ich die Buchstaben herstelle. Das Textmaterial kommt vom Farbband. Die Buchstaben werden nacheinander hergestellt, dabei brauche ich für jeden Buchstaben nur eine Drucktype, die ich durch die Tastatur bewege.
Durch die Schreibmaschine wird das eigentliche Schreiben mechanisiert, während der Bleisatz-Druck nur die Vervielfältigung von einzelnen Seiten - überdies wenig - mechanisiert hat. Beim ursprünglichen Setzen von Hand muss ich die Drucktypen in die Hand nehmen, um sie in einen Rahmen zu setzen. In einem separaten Arbeitsgang presse ich dann den Rahmen, also alle Drucktypen gleichzeitig auf das Papier. Bei der Schreibmaschine bewege ich die Drucktypen, die fest in der Maschine montiert sind, je einzeln, während ich schreibe. Ich „drucke“ mit den Drucktypen, indem ich eine entsprechend gekennzeichnete Taste drücke. Bei den „mechanischen“ Schreibmaschinen benutze ich dabei meine eigene Kraft, um die Buchstaben herzustellen. Genau so wie ich den Bleistift auch mit meiner eigenen Kraft bewege. In beiden Fällen ist mein Kraftaufwand relativ klein, so dass er mir gar nicht unbedingt auffällt, solange ich dafür keinen Motor habe.
Die Schreibmaschine entlastet mich, weil ich nicht mehr auf meine Schrift achten muss. Alle Buchstaben sehen immer gleich gut aus und sind perfekt auf einer Linie, was ich in Handschrift nur unter grösster Konzentration halbwegs hinbringe. In der Patentschrift von H. Mill (1714) wird eine Maschine beschrieben, bei welcher "Buchstaben fortschreitend einen nach dem anderen wie beim Schreiben [gedruckt werden], und zwar so klar und genau, dass man sie vom Buchstabendruck nicht unterscheiden kann.“ Und damit verbunden kann ich mit der Maschine mit weniger Mühe viel schneller schreiben.
Wenn ich mit der Schreibmaschine schreibe, muss ich die einzelnen Buchstaben nicht mehr von Hand formen. Ich stelle dann Buchstaben her, indem ich eine ganz andere Handlung ausführe. Ich drücke eine Taste, was einen Prozess auslöst, dessen Resultat die Herstellung des Buchstabens ist. Der Mechanismus zwischen der Taste und dem eigentlichen Herstellen des Buchstabens kann technisch weiterentwickelt werden, ohne dass das Prinzip der Tastatur und des Druckens des Textes wesentlich verändert werden. Die Weiterentwicklung betriff dann den Mechanismus. In der elektrischen Schreibmaschine wird die Drucktype mit elektrischem Strom bewegt, so dass ich die Taste nur noch leicht berühren muss. Das macht mich schneller und das Schriftbild gleichmässiger, weil jede Taste mir der gleichen Kraft bewegt wird.
Für die von mir beobachtete Entwicklung ist viel wichtiger, dass dabei das Schreiben in zwei Teile zerlegt wird, was beim Fernschreiber noch deutlicher sichtbar wird, weil dort das Drucken an einem ganz anderen Ort passiert. Das Schreiben zerfällt in ein Tippen und ein Drucken. Das Drucken ersetzt die Arbeit, die davor in der Druckerei von einem Schriftsetzer und einem Drucker ausgeführt wurde. Beide waren an der Textproduktion beteiligt, ohne dass sie den Text beeinflusst haben. In der tayloristischen Betriebswissenschaft wurde das als Trennung von Kopf- und Handarbeit bezeichnet. Die vermeintlich Schreibenden, beispielsweise Redakteure von Zeitungen, haben auf dieser Stufe der Entwicklung zwar wirklich geschrieben, aber sie schrieben Manuskripte, die nie gelesen, sondern von Schriftsetzern kompiliert wurden. Darin sehe ich einen Grund für die verkürzte Vorstellung, dass das Schreiben etwas Geistiges sei und nichts mit dem Herstellen von materiellen Buchstaben zu tun habe.
Wenn ich als Redakteur – womöglich von Hand – ein Manuskript schreibe, stelle ich Buchstaben her. Dass der Text später in einem weiteren Arbeitsgang – wie im klösterlichen Skriptorium – von einem Team aus Schriftsetzer und Drucker nochmals hergestellt wird, ist eine eigentümliche Arbeitsteilung, die aber das physische Herstellen von Buchstaben des Redakteurs nicht betrifft. Wenn ich aber mit der elektrischen Fernschreibe-Schreibmaschine schreibe, wird mein Text am anderen Ort nicht nochmals geschrieben. Ich stelle die Buchstaben durch mein Schreiben mittels der Maschine her, deren Teile einfach weit auseinander liegen.
Diese Differenz hat logischerweise auch eine sprachliche Ebene, die ich später noch ausführlicher beobachte. Es geht darum, dass in einer bestimmten Auffassung Maschinen arbeiten. Ich verwende den Ausdruck Arbeit für eine tauschwertorientierte Tätigkeit, was in der aktuellen Gesellschaft als bezahlte Produktion von Waren erscheint, aber immer ein Tauschverhältnis unterstellt. Da ich mit einer Maschine nichts tausche, kann sie in meiner Auffassung nicht arbeiten. Ich benutze Maschinen wie Werkzeuge beim Arbeiten. Wenn ich sage, dass ein Drucker demzufolge nicht arbeitet, bezeichne ich mit dem Wort Drucker die Maschine, nicht einen Mensch, der diese Maschine benutzt. Und wenn ich sage, dass der Drucker nichts, also keine Buchstaben oder Texte ausdruckt, meine ich wieder die Maschine. Ich drucke Texte aus und verwende dabei eine Maschine.
Beim Schreiben sehe ich oft recht unmittelbar, dass ich es nicht so habe schreiben wollen, wie ich es geschrieben habe. Wenn ich mit einem Bleistift schreibe, hilft der Radiergummi wenigstens in bestimmten Fällen. Wenn ich mit der Schreibmaschine schreibe, wird das nachträgliche verändern des Textes relativ kompliziert bis unmöglich. Zwar gibt es Tipp-Ex, bei teureren Schreibmaschinen sogar eingebaut, aber das hilft mir nur bei einzelnen Tippfehlern, die ich rasch erkenne. Wenn ich merke, dass ich den ganzen Satz lieber anders geschrieben hätte, bin ich auf eine spezielle Art verloren..[5]
Wenn das Tippen und das Ausdrucken getrennt sind, habe ich in bestimmten Fällen die Möglichkeit, das Getippte zu korrigieren, bevor es ausgedruckt wird. Bei Massenmedien gibt es ein sogenanntes Lektorat und ein „Gut zum Druck“ bevor der Text massenweise gedruckt wird. Beim Fernschreiber gab es eine Variante, in welcher Lochkarten geschrieben wurden, weil so der Fernschreiber in einer optimalen Geschwindigkeit übertragen konnte. Die Lochkarten sind zwar materielle Texte wie die Manuskripte, aber sie sind nicht die „gemeinten“ Texte, sondern nur eine Art Zwischenform, die dann allerdings nicht mehr von einem Schriftsetzer nochmals abgeschrieben werden müssen.
Wenn ich beim Tippen Lochkarten herstelle und die  Lochkarten dann zur Steuerung eines Druckers verwendet werden, erzeuge ich den Text in zwei verschiedenen materiellen Formen. Dasselbe mache ich mit einzelnen Buchstaben, wenn ich beispielsweise Drucktypen oder Schablonen herstelle. Wenn ich eine Druckplatte, etwa in der Form eines mit Drucktypen gefüllten Rahmens herstelle, erzeuge ich auch einen Text, mit welchem ich dann den beabsichtigten Text herstelle. Lochkarten dann zur Steuerung eines Druckers verwendet werden, erzeuge ich den Text in zwei verschiedenen materiellen Formen. Dasselbe mache ich mit einzelnen Buchstaben, wenn ich beispielsweise Drucktypen oder Schablonen herstelle. Wenn ich eine Druckplatte, etwa in der Form eines mit Drucktypen gefüllten Rahmens herstelle, erzeuge ich auch einen Text, mit welchem ich dann den beabsichtigten Text herstelle.
Das Handwerk wurde in der betrieblichen Arbeitsteilung so zerlegt, dass die Herstellung in einen Planung und eine Herstellung zerlegt wurde. Im Maschinenbau beispielsweise wird eine Konstruktionszeichnung hergestellt, bevor die gezeichnete Maschine dann von anderen Arbeitern wirklich hergestellt wird. Handwerker, die etwas komplizierte Produkte herstellen, haben schon vor der Arbeitsteilung dann und wann Zeichnungen gemacht. Aber sie haben die Zeichnungen für sich selbst gemacht, und dann das gezeichnete Artefakt auch selbst hergestellt. In der Arbeitsteilung wird hauptsächlich das Planen und das Ausführen von verschiedenen Menschen gemacht.
Wenn ich eine Konstruktionszeichnung mache, mache ich in einem sehr metaphorischen Sinn eine Maschine, obwohl die Umgangssprache auch hier allerlei Verwirrungen enthält. Der Ingenieur sagt etwa, dass er eine Maschine konstruiert oder entwickelt oder gebaut habe. Und B. Brecht hat das mit der Frage des lesenden Arbeiters auf den Punkt gebracht: „Wer baute das siebentorige Theben?“ Haben die Stadtplaner die Felsbrocken herbeigeschleppt? Wenn ich als Redakteur ein Manuskript schreibe, muss ein anderer Mensch Hand anlegen, damit der Text gemeinte entsteht. Wenn ich dagegen mit einer entwickelteren Maschine Lochkarten schreibe, muss kein anderer Mensch den gemeinten Text herstellen.
Ökonomisch unterscheide ich – wie C. Babbage in seinem Buch „Über die Ökonomie von Maschinerie und Manufaktur“ vorgeschlagen hat – zwei ganz verschiedene Entwicklungen des Handwerkes. Die eine widerspiegelt sich in der Maschine und die andere in der Manufaktur. In beiden Fällen analysiere ich die Handlung des Handwerkers und unterscheide dabei verschiedene Operationen. Als Operation bezeichne ich dabei konstruktiv beschreibbare Aspekte von Handlungen, die ich im Prinzip maschinell ausführen kann. Wenn ich eine entsprechende Maschine herstelle, ist die Operation Element von deren Funktionsweise. Wenn ich keine entsprechende Maschine habe, kann ich die verschiedenen Operationen von verschiedenen Menschen ausführen lassen, was ich als Manufakturprinzip oder als betriebliche Arbeitsteilung bezeichne.
In der Maschine wird das Handwerk nicht zerlegt, sondern spezifisch aufgehoben. Wenn ich mit einer entsprechenden Maschine einen Text schreibe, stelle ich den Text wie beim Schreiben mit einem Bleistift selbst her, es sind keine anderen Menschen involviert. Wenn ein Textwerkzeug hinreichend kompliziert ist, kann ich aber nach dessen Funktionsweise fragen und so die Operationen erkennen, die zuvor implizit im Handwerk steckten. Bei einfachen Werkzeugen wie etwa einem Bleistift, macht die Frage nach der Funktionsweise keinen Sinn, weil sie ihre Funktion nur in den Händen eines Menschen erfüllen, der natürlich nicht konstruiert wurde, sondern ein Lebewesen ist.
Wenn ich die Tastatur einer Lochkartenmaschine betätige, veranlasse ich, dass ein Loch an einem bestimmten Ort in eine Karte geschlagen wird. Analog zur elektrischen Schreibmaschine wird dabei ein Teil des Mechanismus mit elektrischem Strom angetrieben, um einen Zeichenkörper herzustellen. Wenn ich diesen Prozess unter dem Gesichtspunkt des Schreibens beobachte, stelle ich einen Text her, bei welchem die Lochkarte als Text fungiert. Bei der Lochkarte sind Text und Textträger noch nicht verschieden. Ich forme Kartonkarten, das ist wie wenn ich mit dem Finger in den Sand, oder mit dem Meissel in einen Stein schreibe.
Wenn ich nach der Funktionsweise frage, frage ich, was innerhalb der Maschine passiert, also nicht, was ich mit der Maschine mache. Der Witz vieler Maschinen besteht darin, dass ich nicht wissen muss, wie sie funktionieren, wenn ich sie brauchen will. Ich kann Autofahren, ohne den Motor zu verstehen. Hier will ich aber die Maschine verstehen, um besser zu verstehen, was ich mache, wenn ich – handwerklich – schreibe. Diese Art der Analyse bezeichne ich als Kybernetik oder als Systemtheorie. Der konstruierte Mechanismus repräsentiert mein Begreifen. Was ich als Mensch beim Schreiben mache, mache ich mir systemtheoretisch in Form von Mechanismen, die ich dann als Systeme bezeichne, bewusst. Das "Schreibmaschinensystem" zeigt mir Operationen, die ich zuvor ohne sie als solche erkannt zu haben, von Hand ausgeführt habe.
Im Mechanismus der Fernmeldeschreibmaschine dient die Lochkarte als eine Art Zwischenspeicher, der vom Benutzer des Gerätes weder gesehen noch verstanden werden muss, sondern einfach zur Konstruktion des Mechanismus gehört. Wenn ich aber die einzelnen Operationen beobachte, erkenne ich die Herstellung dieser Karten. Ich kann mich dann fragen, wie oder inwiefern der Text auf diesen Karten gespeichert ist. Und ich kann dann erkennen, dass die Karten Texte sind. Ich kann die Karten lesen, wenn ich weiss, wie ich sie lesen muss.
Wenn ich die Karten neben den in Buchstaben aus Tinte ausgedruckten Text lege, habe ich eine Art Stein von Rosette, auf welchem der gleiche Text in verschiedenen Schriften eingemeisselt ist. Der Stein von Rosette hilft mir beim Entziffern von Hieroglyphen, weil ich rekonstruieren kann, welche Zeichen für welche anderen Zeichen stehen. Dieses Verfahren könnte ich auch auf Lochkarten anwenden, wenn ich nicht schon wüsste, welche Zeichen auf der Lochkarte wie dargestellt sind.
Die ersten Lochkarten dienten der Steuerung des Webstuhles von 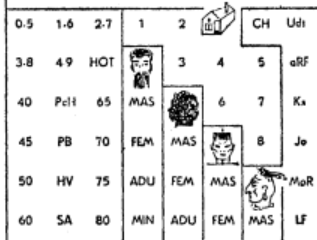 J. Jacquard. Berühmt sind die Lochkarten, die H. Hollerith 1890 für die amerikanische Volkzählung verwendet hat. Diese hatten die Grösse von Dollarnoten, weil die Banken schon damals genügend Ablagekästen dafür liefern konnten. Hier interessiert mehr, dass auf den Karten Text aufgedruckt war, der die Bedeutung der jeweiligen Lochpositionen erläuterte. Die Lochpositionen für die jeweilige Rassenzugehörigkeit war durch schematische Bildchen gekennzeichnet. Auch die in der Computerbranche gängigen Lochkarten waren bedruckt, sozusagen Texte die Textträger für andere Texte waren. J. Jacquard. Berühmt sind die Lochkarten, die H. Hollerith 1890 für die amerikanische Volkzählung verwendet hat. Diese hatten die Grösse von Dollarnoten, weil die Banken schon damals genügend Ablagekästen dafür liefern konnten. Hier interessiert mehr, dass auf den Karten Text aufgedruckt war, der die Bedeutung der jeweiligen Lochpositionen erläuterte. Die Lochpositionen für die jeweilige Rassenzugehörigkeit war durch schematische Bildchen gekennzeichnet. Auch die in der Computerbranche gängigen Lochkarten waren bedruckt, sozusagen Texte die Textträger für andere Texte waren.
(21)
Anmerkungen
1) Das althochdeutsche Wort scriban wurde als Tätigkeitsbezeichnung eingeführt, als mit dem Griffel bereits ein Werkzeug benutzt wurde. Das sagt weniger über das Schreiben aus als darüber, wann eine bestimmte Tätigkeit als solche wahrgenommen wird. (zurück)
==
2) Materie ist ein philosophisches Konzept, für welches die Philosophen auch Urstoff und Substanz verwenden, weil sie ohnehin nicht wissen, was sie bezeichnen. Wo Material auch kein Begriff ist, wird Materie oft auch synonym dazu verwendet. Schliesslich hat A. Einstein Materie in der Energie aufgehoben, aber natürlich ist auch das nur Philosophie. Im praktischen Leben und in diesem Text spielt Materie keine Rolle, ich brauche das Wort nicht. (zurück)
[3] Sozietät ist ein soziologischer Begriff, der die beiden alltäglichen Wortverwendungen von Gesellschaft und sozial abgrenzt, die etwas anderes bezeichnen. (zurück)
[4] Über Gutenbergs Beitrag zur Zerlegung des Handwerkes habe ich schon im 1. Kapitel geschrieben: Gutenbergs revolutionärer Beitrag war, dass er das Schreiben in eine Menge verschiedener Lohnarbeiten aufgeteilt hat. (zurück)
[5] Der schlaue Inspektor Colombo überführt in einem seiner Filme einen Täter anhand eines Textes, der auf dem Korrekturband der Schreibmaschine erhalten geblieben ist. (zurück)
3. Schrift
Einleitende Bemerkungen
Ich habe das Schreiben im vorangegangegen Kapitels als Handwerk beobachtet und dabei Text, Textträger und Textwerkzeug unterschieden. Diese Unterscheidung mache ich in einem operativ-konstruktiven Sinn, indem ich Text, Textträger und Textwerkzeuge in einem je eigenen Produktionsprozess herstelle und dabei sowohl die Gegenstände und auch die Herstellungsverfahren entwickle. Als Textträger habe ich bisher hauptsächlich Papier unterstellt und kaum etwas zur Entwicklung gesagt, wenn ich von der Erwähnung des Überganges von Sand zu Fels zu Pergament absehe. In Bezug auf Textwerkzeuge habe ich einen wesentlichen Entwicklungsschritt vom Werkzeug zur Maschine schon etwas ausführlicher dargestellt.
Als Textträger und Textwerkzeuge bezeichne ich je spezielle Fälle von Trägern und Werkzeugen, die ich durch das vorangestellte „Text“ kennzeichne. Ich werde beides später noch genauer beobachten und weiterentwickeln. Zunächst will ich mich dem Text zuwenden, der den eigentlichen Gegenstand des von mir beobachteten Handwerkes bildet.
Als Lochkarte invertiert Text die Unterscheidung von Textträger und Text und kehrt so auf eine primitive Entwicklungsstufe von Text zurück, die allerdings durch das weiterentwickelte Werkzeug aufgehoben wird. Die Lochkarte entspricht dem eingravierten Text im Sand oder im Stein, sie gehört aber zu einer komplizierten Textmaschine. Darin erkenne ich ein Muster, worin Diffferenzierungen von komplementären Entdifferenzierungen begleitet sind. Das Textwerkzeug ist als Lochkartenautomat viel differenzierter geworden, und damit verbunden wurde der Text entdifferenziert: zu Löchern im Karton.
Solche komplementären Entdifferenzierungen finde ich in vielen Bereichen. Kinder beispielsweise wurden anfänglich von ihren Eltern belehrt, nach einer bestimmten gesellschaftlichen Differenzierung, die Lehrer hervorgebracht hat, müssen die Eltern ihre Kinder nicht mehr schreiben lernen. Die Aufgabe der Eltern wird dadurch einfacher, dass sich das Belehren ausdifferenziert. Wenn ich ein höher entwickeltes Auto mit einem automatischen Getriebe und einem ABS-Bremssystem fahre, muss ich viel weniger können und machen als wenn ich ein älteres Fahrzeug fahre. In all diesen Fällen zeigt sich die jeweils beobachtete Differenzzierung als Frage der Perspektive.
Handwerker werden manchmal als bluecollar bezeichnet, obwohl diese Bezeichnung eigentlich erst in der Manufaktur Sinn macht, wo sich nicht mehr alle die Hände schmutzig machen. Die zugrunde liegende Vorstellung ist, dass Menschen in den Werkstätten blaue Overalls tragen, während die Bürolisten weisse Hemden tragen. Zu dieser Vorstellung gehört, dass die Büroarbeit als Ausdifferenzierung aus dem Handwerk hervorgegangen sei. Beim Schreibhandwerk allerdings waren die ursprünglichen Handwerker quasi Bürolisten und die Ausdifferenzierung brachte dann in Form von Schriftsetzern und Druckern erst die Bluecollars hervor. In der weiteren Entwicklung sterben diese Bluecollars wieder aus, was einer Entdifferenzierung auf der Ebene der Berufe entspricht, die mit einer weiteren Differenzierung der Textwerkzeuge einhergeht.
Ich beobachte zunächst das eigentliche Produkt des Schreibens, das ich als Text bezeichne. Text als Artefakt entwickelt sich im Sinne einer Differenzierung, die auf der unmittelbaren Ebene des Artefaktes auch Entdifferenzierungen zeigt. Aber das, was ich als Text bezeichne, ist nicht ein beliebiges Artefakt, sondern ein Artefakt mit einer bestimmten Gegenstandsbedeutung. Wenn ich Text herstelle, verfolge ich eine Absicht, die ich als Bedeutung des Textes bezeichne. Damit der Text Text ist, muss er bestimmte Bedingungen erfüllen und dazu muss er auf eine bestimmte Art geformt sein. Ich habe bisher geschrieben, dass ich beim Schreiben Artefakte forrme, aber über die Form der Artefakte habe ich noch nichts gesagt.
Ich beobachte also als nächstes, was für Artefakte ich – beispielsweise mit einem Bleistift – herstelle und beginne narrativ wieder mit dem unentwickelsten Fall. Ich zeichne etwas, indem ich Graphit auf dem Papier anordne. Als Kleinkind bin ich allenfalls von der Möglichkeit Striche zu machen fasziniert und mache wahllos Striche im Sinne eines Praktizierens, das sich selbst genügt und keinen Gegenstand braucht oder produzieren will. Umgangssprachlich wird auch dieses Kritzeln als Zeichnen bezeichnet. Später – aber noch bevor ich schliesslich zum abstrakten Künstler avanciere – mache ich meine Striche nicht mehr zufällig, ich will ein bestimmtes Produkt hervorbringen, wodurch meine Praxis zur Poiesis wird.[1] Wenn ich beispielsweise das Haus zeichne, in welchem ich wohne, zeichne ich naturwüchsig den Umriss des Hauses aus einer bestimmten Perspektive. Ich zeichne das Haus, so wie ich es - davor stehend - sehe.
Ich mache dabei mit der Hand, die den Bleistift führt, analoge Bewegungen zu den Bewegungen, die ich mit meinen Augen mache, wenn ich dem Umriss des Hauses folge. Meine Zeichnung sieht dann in diesem operativen Sinn gleich aus wie das Haus, weil ich beim Anschauen der Zeichnung mit den Augen wieder dieselben Bewegungen mache. In der mentalistischen Sprache der operativen Schule bewege ich dabei quasi innerhalb des Auges meine Aufmerksamkeit. Viele Gegenstände sehe ich ja sozusagen in einem Augenblick. Was meine Aufmerksamkeit dabei in Bezug auf Umrisse macht, erkenne ich beim Zeichnen.[2]
Die Bewegung, die ich beim Formen des Artefaktes mache, gerinnt als dessen Form, was ich dann auch als Form des gezeichneten Gegenstandes erkenne. In diesem Sinne sage ich, dass ich beim Zeichnen die Form zeichne und dass die Form in diesem operativen Sinn genau das ist, was ich zeichnen kann.[3] was ich dann auch als Form des gezeichneten Gegenstandes erkenne. In diesem Sinne sage ich, dass ich beim Zeichnen die Form zeichne und dass die Form in diesem operativen Sinn genau das ist, was ich zeichnen kann.[3]
Wenn ich zeichne, stelle ich einen Gegenstand her, der die gleiche Form hat wie der gezeichnete Gegenstand. In diesem Sinn ist die Zeichnung eine Re-Präsentation mit viel weniger Aufwand und Mitteln, die für die Präsentation der gezeichneten Sache nötig wäre. Wozu ich Zeichnungen mache, ist eine andere Frage. Ich kann zeichnen, weil es als Praxis Spass macht. Manchmal mache ich Zeichnungen, die mir als externes Gedächtnisse oder als Konstruktionsplan dienen. Dann soll mich die Zeichnung nicht nur an das Gezeichnete, sondern vor allem auch an mein Zeichnen erinnern. In diesem Sinne fungiert die Zeichnung als Symbol oder als Zeichen, das für anderes steht.
In der Zeichnung sehe ich den naturwüchsigen Fall des Zeichens, gerade weil ich Zeichnungen gar nicht als eigentliche Symbole sehen muss. Ich erkenne ohne Erziehung und ohne Vereinbarung – quasi naturwüchsig – , dass Zeichnungen hergestellt sind, und ich sehe, was dabei gezeichnet wurde. Ich kann natürlich ausgetrickts werden. Wenn ein Kuh von oben oder von unten statt im Aufriss gezeichnet wird, kann ich die Zeichnung nicht ohne weiteres zuordnen, weil ich Kühe selten von oben oder von unten sehe. Und viele Zeichnungen passen zu verschiedenen Sachen, die eben dieselbe Form haben. Die Zeichnung eines Gugelhupfs lässt mich auch nicht erkennen, ob ein Kuchen aus Teig oder eine Kuchenform aus Metall dargestellt ist, was sich aber durch keine Erziehung korrigieren lässt.
In einer speziellen Hinsicht unterscheide ich Zeichen von Anzeichen. Zeichen und Anzeichen interpretiere ich als Verweis auf etwas anderes. Anzeichen sind aber nicht dafür gemacht worden. Westwind bringt oft Wolken und Wolken bringen oft Regen, deshalb nehme ich Westwind als Anzeichen für Regen. Dass ich Anzeichen wahrnehme, begreife ich als Ergebnis der naturgeschichtlichen Entwicklung des Menschen. Zeichen dagegen sehe ich als Ergebnis der sozialhistorischen Entwicklung, in welcher sich im evolutionären Sinn nicht mehr der Mensch, sondern dessen spezifische Aneignung entwickelt. Zeichnungen markieren eine Art Übergangsfeld, sie sind Artefakte, aber als Zeichen in dem Sinne primitiv, dass sie nicht wie Anzeichen auf etwas verweisen, das sie selbst nicht zeigen. Rauch etwa sehe ich als Anzeichen für Feuer. Rauch sieht ganz anders aus als Feuer. Die Zeichnung einer Kuh verweist zunächst auf eben diese Kuh, die so aussieht wie die gezeichnete Kuh. Zeichen dagegen sehe ich als Ergebnis der sozialhistorischen Entwicklung, in welcher sich im evolutionären Sinn nicht mehr der Mensch, sondern dessen spezifische Aneignung entwickelt. Zeichnungen markieren eine Art Übergangsfeld, sie sind Artefakte, aber als Zeichen in dem Sinne primitiv, dass sie nicht wie Anzeichen auf etwas verweisen, das sie selbst nicht zeigen. Rauch etwa sehe ich als Anzeichen für Feuer. Rauch sieht ganz anders aus als Feuer. Die Zeichnung einer Kuh verweist zunächst auf eben diese Kuh, die so aussieht wie die gezeichnete Kuh.
Zeichnungen helfen mir nicht nur – oder sogar nicht vor allem – beim Erinnern. Das Herstellen von Zeichnungen hilft mir auch beim Planen. Mit Konstruktionszeichnungen mache ich mir Zusammenhänge bewusst, die ich ohne Zeichnungen nicht überblicken könnte. Aber als Zeichen für etwas anderes dienen Zeichnungen gerade wegen ihrer Anschaulichkeit unmittelbar nicht. Die Konstruktionszeichnung zeigt zwar etwas, was es noch nicht gibt, sie zeigt aber, wie die Sache aussieht, wenn es sie dann gibt.
Wenn ich beispielsweise festhalten will, das ich vier Rinder auf einer Allmend habe, kann ich vier Rinder zeichnen oder vier Striche machen. Ich kann auch vier Steine an einen bestimmte Ort legen. Ich kann sogar lange Striche oder grosse Steine für ausgewachsene Tiere verwenden, oder schwarze Steine für schwarze Tiere. In all diesen Fällen sehe ich das Schreiben prototypisch. Das heisst, wenn ich schon ein Bewusstsein vom Schreiben habe, kann ich darin das Schreiben erkennen, aber ich kann das Verhalten auch sinnvoll finden, ohne ans Schreiben zu denken.
Jenseits von Schreiben bezeichne ich die gezeichneten Rinder als Ikone, weil sie zeigen, was sie zeigen: Rinder. Sie zeigen natürlich nicht, dass sie mich an bestimmte Rinder an einem bestimmten Ort erinnern sollen. Die vier Striche oder Steine, die ich anstelle der Ikone zeichne, bezeichne ich - in diesem Kontext - als Indexe, weil sie nicht zeigen, wofür sie stehen, aber mit ihrem Referenzobjekt über eine benennbare Funktion verbunden sind: gleich viele Striche wie Rinder. Wenn ich weiss, dass die Striche für Rinder stehen, kann ich sehen, wie viele Rinder vorhanden sind.
Ikone und Indexe verwende ich als Zeichen, die auf etwas verweisen. Die Zeichenkörper haben als Gegenstände eine Form. Bei den Ikonen ist die Form analog zur Form des Referenzobjektes. Ich kann die Form nicht beliebig wählen. Wenn ich ein Rind zeichne, muss das Rind erkennbar sein. Ich kann das Rind, wenn ich nicht ein ganz bestimmtes Rind zeichne, ziemlich verschieden zeichnen. Auch Indexe haben keine beliebige Form. Sie müssen die Funktion repräsentieren. Wenn ich die Anzahl der gemeinten Gegenstände darstellen will, muss die Form des Indexes diese Anzahl zeigen. Die römischen
Zahl oder ziffer oder Schreibweise
beliebig wähle und das Zeichen auf eine Vereinbarung beziehe, die im Zeichenkörper nicht zu erkennen ist. Im einfachsten Fall verknüpfe ich eine Anzahl Striche mit einer Anzahl von etwas anderem. Ich erkenne darin eine Art Protoschreiben, ein Aufschreiben, etwa, was ich nicht als zeichnen bezeichne, obwohl ich die Striche als gezeichnet bezeichne.
Eine erste Form des Zeichens sehe ich im Siegel, das als Zeichen für eine im Siegel nicht erkennbare Person steht. Ich muss aufgrund einer Vereinbarung wissen, wofür das Siegel steht. Als Schreiben bezeichne ich das Herstellen von Texten, die aus einer Kombination von Zeichen bestehen, und als Zeichen für eine Kombination von Sachverhalten fungieren. Die primitivste Form des Schreibens erkenne ich in der Verwendung von Hieroglyphen. Im einfachsten Falle werden dabei mehrere verschiedene zusammengestellt, was eine Zusammenstellung der mit den Zeichen bezeichneten Objekte repräsentiert. Ich kann beispielsweise mein Siegel und vier Zeichen für Kuh und ein Zeichen für Allmend in einen Stein ritzen und damit – vereinbart – ausdrücken, dass die vier Kühe auf der Allmend mir gehören.
Hier geht es mir darum, dass die Form der Zeichenkörper – wenn sie keine Zeichnungen sind – einer Vereinbarung unterliegt. In diesen Vereinbarungen geht es zunächst nicht darum, wofür die einzelnen Zeichen stehen, sondern darum welche Zeichenkörper ich überhaupt verwende, wie sie geformt sind und wie ich sie kombiniere. Ein wichtiger Teil solcher Vereinbarungen sind etwa das Alphabet oder die Menge der chinesischen Schriftzeichen. Die Zeichenkörper, die im Alphabet aufgeführt werden, sind keine Zeichen oder Symbole, sie verweisen nicht auf anderes, sondern in gewisser Hinsicht auf sich selbst.
Beim Schreiben muss ich wissen, wie ich die einzelnen Zeichenkörper kombinieren kann, was ich in einer Grammatik definiere. Ich werde später darauf zurückkommen.
Zur Naturwüchsigkeit des Zeichnens gehört auch, dass ich Zeichnungen von anderen Menschen anschauen und sehen kann, was sie gezeichnet haben. Dass das möglich ist, beschäftigt Philosophen, die über Voraussetzungen dazu spekulieren. Mich interessiert hier nur, was ich beim Zeichnen mache und worin das Produkt dieser Tätigkeit besteht. Wenn ich etwas als Zeichnung erkenne, unterstelle ich die mir bekannte Art der Herstellung und dabei macht es für mich keinen Unterschied, ob ich die Zeichnung selbst gemacht habe oder jemand anderer. Umgekehrt unterstelle ich, dass andere, die Zeichnungen machen und anschauen, das auch so sehen wie ich - was natürlich auch Spekulation ist.
Diktionär ist veraltet - hier aber nicht xx
Daraus, dass andere Menschen auch Wasser und Wein trinken, leite ich kein soziales Wesen ab. Und dass andere Menschen auch zeichen, macht weder sie noch mich sozial. Aber wenn ich erkenne, dass andere beim Zeichnen dasselbe tun, kann ich auch für sie zeichnen und unterstellen, dass sie auch für mich zeichnen können. Die Zeichnung wird so zum Medium einer gemeinsamen Aneignung und schafft eine Differenz, in welcher ich für mich oder für andere zeichnen kann. Ich weiss, dass meine Texte manchmal auch von anderen Menschen gelesen werden. Aber das heisst nicht, dass ich für andere schreiben muss. Schreiben macht für mich - wie zeichnen - auch Sinn, wenn ich es für mich mache. Und das Schreiben als Handwerk kann ich auch gut beobachten, wenn ich für mich schreibe.
Wenn ich nur für mich schreibe, muss ich die Schriftzeichen mit niemand anderem vereinbaren, aber ich muss für mich trotzdem festlegen, welche Zeichenkörper ich verwenden will. Ich stelle dazu Prototypen her, die ich verkürzt als Type bezeichne, und jedes Zeichen, dass ich dann gemäss dieser Type schreibe, bezeichne ich – der gängigen Linguistik folgend – als Token. Das "a" ist ein Typ, und jedes "a" das ich schreibe, ist ein Token dieses Typs. Die Type erscheint als Drucktype, die ich jedesmal verwende, wenn ich das Zeichen drucke. Natürlich ist jede konkrete Drucktype in einem Setzkasten oder auf einer Schreibmaschine auch ein Token der Type. Und wenn es schon vorfindbare Schriftzeichen gibt, dann kann ich diese verwenden, statt eigene zu erfinden, auch wenn ich nur für mich schreiben will. Wenn ich Zeichenkörper wähle, die auch andere verwenden, wird das Lesen für andere etwas einfacher. Der berühmte Stein von Rosette vermittelt zwischen verschiedenen Typen, die zu verschiedenen Zeichensätzen gehören. Er ist eine Art Wenn ich schreibend Lochkarten herstelle, realisiere ich, dass mir bestimmte Zeichenkörper geläufiger sind als andere. Und für Chinesen ist es vielleicht einfacher, chinesische Zeichenkörper zu verwenden, auch wenn sie so nicht für mich schreiben können.
Im Übergangsfeld zwischen Zeichnung und Schriftzeichen sind Bilderschriften, deren Schriftzeichen – wie etwa Hieroglyphen – wie Zeichnungen aussehen, aber als eigentliche Zeichen in Texten verwendet werden, also nicht als Bildchen gedacht sind. Die primitivsten Schriftzeichen sind Zeichen, die für ein Objekt oder einen Begriff stehen. In der chinesischen Schrift gibt es beispielsweise ein Zeichen für „Haus“. Ich bezeichne solche Zeichen als Ideogramme. Eine ideographische Schrift braucht logischerweise sehr viele Zeichen.
Entwicklungslogisch werden – wie immer auch die historischen Geschichten erzählt werden – Ideogramme zunächst schematisiert und erkalten dann verschiedene Bedeutungen, die sich aus dem Kontext ergeben. Auf einer weiteren Entwicklungsstufe werden sie in Logogramme aufgeteilt, dass heisst, dass Teile der Zeichenkörper aus Bilderschriften zu eigenständigen Zeichenkörper werden, die dann verschieden rekombiniert werden können. Dabei verlieren die Logogramme ihren Zeichencharakter zunehmend, sie funktionieren nur noch innerhalb von Kombinationen von Logogrammen, die dann die Zeichen bilden. Schliesslich werden die Logogramme zu Buchstaben, die insofern Schriftzeichen sind, als ich sie beim Schreiben verwende, die aber keine Zeichen sind, weil sie nicht für etwas anderes stehen, sondern nur Bausteine für Zeichen darstellen.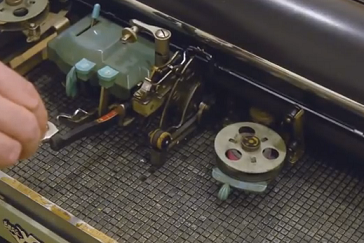
Beim Schreiben von Hand mag die chinesische Schrift noch praktikabel sein, aber bei einer Mechanisierung mittels einer Schreibmaschine verliert sie jede Viabilität. Das betrifft nicht nur die Durcktypen sondern auch die Tastatur (1). Schriften mit einem Alphabet wie etwa die Schrift, die ich hier verwende, kommen mit sehr wenigen Schriftzeichen aus, was eben eine effiziente Schreibmaschine möglich macht.
Anmerkungen
[1] N. Luhmann erzählt (in seiner Systemtheorie), dass H. Maturana ihm erzählt habe, dass er mal zufällig während eines gesellschaftlichen Anlasses beim Nachtessen eine Lektion aristotelische Philosophie bekommen habe, worauf er realisiert habe, dass eine selbstbezügliche Poiesis perfekt treffe, was er zuvor ungenau mit Zirkularität beschrieben habe.
Differentiell scheint mir der Ausdruck eher unglücklich (oder paradox) gewählt, weil sich darin meine Unterscheidung zwischen Praxis und Poietik - die auch von Aristoteles angezogen wurde - verdreht.
Bei Artistoteles (und vielen seiner Nachfolgern wie etwa dem hier erzählenden N. Luhmann) steht Poiesis für Tätigkeit mit einem extrinsischen Ziel, während Praxis eine Tätigkeit bezeichnet, die sich selbst genügt. Poiese bezeichnet in dieser Auffassung also das Herstellen von Gegenständen, die einen Zweck haben. Und Autopoiese impliziert, dass ich mich zu einem Zweck herstelle - was ich als quasi-religiöse Verklärung - etwa der Körper als Fahrzeug der Seele - sehe.
Ich kann singen, um Geld zu verdienen oder weil es mir gefällt. Poiesis bezeichnet das Herstellen von Gegenständen, die einen Zweck haben, der jenseits des Herstellens liegt und später realisiert wird. H. Maturana hat mit seinem Ausdruck Auto-Poiesis (wie bewusst auch immer) die Poiesis auf den Kopf gestellt. Er bezeichnet sich selbst als autopoietische "Maschine" und suggeriert damit zwecklose Maschinen, wie sie etwa J. Tinguely hergestellt hatte. Die Vorsilbe "auto" zeigt an, dass Poiesis gerade nicht gemeint sein kann. Nur, das griechische Praxis würde zu auto genau so schlecht passen. Praxis in diesem Sinn ist immer Autopraxis. (zurück)
[2] Diese Verinnerlichung der Operation von Silvio Ceccato habe ich bei E. von Glasersfeld gefunden, der damit erklärt, was beim Lesen eines Stadtplanes passiert. (zurück)
[3] Es gibt wohl kein Wort, das öfter als Metapher verwendet wird, als Form. (zurück)
1) Die chinesische Schreibmaschine zeigt eine Komplikation beim Mechanisieren des Schreibens mit Ideogrammen. Sie braucht 3 Setzkästen à je 2000 Drucktypen, die dann überdies aufwendig angeschlagen werden.(zurück)
Epilog
Ein sehr persönliches Vorwort
Weil ich meine, dass dieses Thema alle interessieren müsste , aber niemanden interessiert, weil alle schon alles darüber wissen ....
Ich habe als Schüler, als Student, als Lehrer und als Dozent sehr lange verschiedene Schulen besucht. In all diesen Jahren plagte mich ein stehtes Unbehagen, das ich durch S. Freud auf Verdrängungen zurückzuführen lernte, ohne dabei zu begreifen, was ich verdrängte. Ich vermutete, dass es etwas mit der Lehre zu tun haben müsse, und die Schule erschien mir nur als Ort, wo die Lehre weitergegeben wird, nicht als der Ort, wo diese Lehre geschaffen wird. Ich habe sehr lange nicht verstanden, worin diese Lehre besteht. Ich glaubte naiverweise auch noch als Dozent an der Hochschule, dass irgendwelche Inhalte die Lehre seien und dass Lehrer als Pädagogen die Lehre nur zugänglich machen.
Als ich dann in einem Buch von H. Maturana gelesen habe, dass alles, was gesagt wird, von einem Beobachter gesagt wird, habe ich in einer Art Erleuchtung erkannt, was ich all die Jahre schon wusste, aber verdrängt habe. Es war bei weitem nicht, die von S. Freud beschworene Sexualität, die ich verdrängte, es war meine eigene Sprache, in welcher ich als ich vorkomme. Ich verdrängte meinen Wunsch über mich und über meine Erkenntnisse zu sprechen. Im Nachhinein kann ich mich an viele Situationen erinnern, wo ich das in der Schule ansatzweise versucht habe, aber die Institution Schule habe ich gerade darin erlebt, meine Erkenntnisse als nicht zur Lehre gehörend zurückzuweisen. Ich lernte früh, meine Sätze nie mit “ich” zu beginnen und das ich möglichst ganz zu vermeiden. Ich lernte , dass in wissenschaftlichen Dokumenten das ich gar nicht vorkommen kann. In der Wikipedia – die jenseits aller Wissenschaft als Konversation geschrieben wird – wird heute noch jede “ich-Formulierung”, die ich eintrage, augenblicklich gelöscht.
Durch das Buch von H. Maturana erkannte ich mich als Subjekt im dialektischen Sinn. Als Subjekt bin ich zwar die Hypostasierung meines Denkens und Handelns, aber gleichzeitig bin ich meinen eigenen Plänen unterworfen – etwa als Baumeister muss ich das Haus so bauen, wie ich es geplant habe, oder als Bürger muss ich mich nach einer Verfassung richten, der ich zugestimmt habe. Als Subjekt bestimme ich, was ich sage, aber meine je gewählte “Sprache” bestimmt, was ich sagen kann. Ich fing an, über meine Sprache nachzudenken und erkannte sofort das Tabu, das in der durchgesetzten Vorstellung besteht, dass ich keine eigene Sprache haben könne, dass die Sprache vor dem Menschen sei und dass jeder Mensch, also auch ich die Sprache der Gesellschaft sprechen müsse.
Ich merkte, dass ich meine Muttersprache benutzte und keine Ahnung habe, wie ich dazu gekommen bin – ausser eben, dass meine Mutter mit mir gesprochen hat, schon bevor ich antworten konnte. Als ich zum ersten Mal in die Schule ging, konnte ich – so erinnere ich mich jedenfalls – ziemlich gut sprechen. An die Zeit, in der ich noch nicht sprechen konnte, erinnere ich mich nicht, darüber wurde mir allerhand erzählt. Ich habe später auch Kleinkinder gesehen, die offensichtlich noch nicht sprechen konnten, so dass es mir leicht fällt, anzunehmen, ich hätte das Sprechen wie das Gehen oder das Schwimmen irgendwie entwickelt, erworben oder gelernt. Aber eben nicht in der Schule.
Dann fragte ich mich, was ich vom dem, was im Nachhinein irgendwie nützlich finde, in der Schule gelernt habe. Ich realisierte, dass ich mich an praktisch nichts erinnern kann. Ich habe angefangen, andere Menschen zu fragen, was sie während ihrer gesamten Schulzeit gelernt haben, das sie noch brauchen können. Die Antworten waren für mich zunächst sehr ernüchternd. Die meisten Menschen, die mir überhaupt geantwortet haben, nannten das Schreiben und das Rechnen, wobei sie eigentlich hauptsächlich das Schreiben wichtig finden, weil sie in ihrem Alltag kaum erkennbar Rechenprobleme lösen müssen.
Dass ich schreiben und rechen kann, finde ich wichtig. Ich weiss allerdings, dass ich beides ansatzweise bereits vor der Schule konnte und dass es viele “begabte” Kinder gibt, die sich in der Schule langweilen, wenn sie nochmals lernen sollten, was sie schon lange können. Ein besonders begabtes Kind erzählte mir, dass sein Vater mit ihm im Alter von drei Jahren die Elemente von Euklid gelesen habe. Es habe seinem Vater nie verzeihen können, dass er es nach dieser Ausbildung auch noch auf die Schule schickte, als es sechs Jahre alt war. Denn es hätte viele Jahre gekostet, wieder zu verlernen, was man ihm dort beigebracht habe.
Ganz vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ging es wie mir, sie konnten mir spontan sehr wenig darüber sagen, was sie in der Schule gelernt haben. Die Gespräche halfen mir aber zu realisieren, dass ich in der Schule eine “Sprache” lernte, in welcher ich mein “ich” verdrängte. Die Schule ist der Ort, wo ich mein “ich” wegtrainiert bekommen habe. Als Schüler musste ich die ich-Losigkeit annehmen, die ich als Dozent weitergegeben habe. Das Schreiben, das ich in der Schule lernte, formte meine Sprache und mein Denken viel stärker als das Sprechen, das ich praktisch ohne bewussten Aufwand davor gelernt habe und das in den Schulen, die ich besuchte, ohnehin sehr vernachlässigt wurde. Mein ich-loses Formulieren habe ich während des Schreibunterrichtes angenommen. Aufgrund der Gespräche über das erlernte Schreiben dachte ich nochmals genauer darüber nach, was ich als Schreiben bezeichne. Ich erkannte, dass ich mit Schreiben eine mir bis dahin zwar wohl bekannte, aber nicht bewusste Differenz bezeichne, die teilweise in der Differenz zwischen Schreiben und Abschreiben sichtbar wird.
Schreiben ist einerseits eine Tätigkeit, die ich können muss, also keine Lehre, die ich kennen oder wissen sollte. Das Schulfach, in welchem Schreiben gelehrt wird, heisst aber normalerweise nicht Schreiben, sondern ganz diffus “Sprache” oder bei uns sogar etwas präziser “deutsche Sprache”. Schreiben hat in diesem Kontext sehr verschiedene Bedeutungen. Zunächst geht es darum, Text herstellen zu können, völlig unabhängig davon, was in den Texten steht. Es geht darum, die Buchstaben lesbar in einer richtigen Reihenfolge schreiben zu können. Später geht es darum, die Grammatik und die Orthographie nicht zu verletzen. Um Abschreiben zu können, muss ich weder Grammatik noch Orthographie kennen. Es geht die Sage um, wonach viele Mönche in den mittelalterlichen Klöstern Texte quasi gemalt, nicht geschrieben haben, weil sie gar nicht lesen konnten, was sie reproduzierten. In U. Eco’s Der Namen der Rose werden die wichtigen Texte allerdings vor den kompilierenden Mönchen versteckt, mit Gift geschützt und schliesslich verbrannt, damit sie nicht unter die Menschen kommen.
Das Textherstellen ist ein Handwerk, das wie jedes andere Handwerk systematisch zerlegt werden kann. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft müssen beispielsweise Maurer nicht wissen, wie man Häuser baut, sie müssen nur aus Steinen Mauern machen (können), wo es von ihnen verlangt wird. Soweit die Textherstellung Abschreiben ist, muss der Abschreibende das Herstellen können, ohne dass er den Text verstehen muss. In der Schule habe ich zuerst dieses Textherstellen gelernt. Ich habe aber auch gleichzeitig lesen gelernt, so dass ich in einem bestimmten Sinn wusste, was ich abschreibe. Was ich dabei eingeübt habe, war nicht nur das Text herstellen, sondern nebenbei und unreflektiert habe ich auch eingeübt, wie und worüber Texte normalerweise geschrieben sind.
In der Schule wurde ich nicht nur in der “Sprache” unterrichtet, die Lehrer beschrieben mir auch die Welt. Dazu sagten sie Sätze, die mit den Sätzen, die ich im Schreibunterricht schreiben musste, übereinstimmten. Ich schrieb also, obwohl es darum ging, schreiben zu lernen, Sätze darüber, wie die Welt ist und lernte wie sie sprachlich dargestellt wird. Diese Welt erschien mir als gegeben, und was darüber zu sagen ist, wurde mir vorgesagt. Als ich dann selbst schreiben musste, was als Aufsatz schreiben bezeichnet wurde, wurden mir Themen und Formate vorgegeben. Dabei wurde ich in einer Rhetorik unterrichtet, die ihre Gültigkeit jenseits von Themen hat. Und erst als ich so schreiben gelernt hatte, wurde mir anhand der Unterscheidung Fiction versus Nonfiction Literatur erklärt, wo im trivialsten Fall dann ich-Formulierungen vorkommen, die aber in der Fiktion aufgehoben sind.
Schliesslich habe ich wieder beim libidofeindlichen S. Freud entdeckt, was ich in der Schule – wohl zum Wohle der Kultur – hätte lernen sollen. In einer perversen Inversion des Inhaltes meines Unbehagens hat S. Freud – auch – mein Unbehagen mit drei Kränkungen des gesunden Menschenverstandes erklärt. Als “gesunder Menschenverstand” bezeichnete er dabei, was durch die Lehre überwunden werden soll – was bei mir, wenn auch nicht so nachhaltig wie wohl gewünscht – erreicht wurde. Ich lernte – obwohl ich das heute nur bedingt als lernen bezeichnen würde – dass N. Kopernikus die Erde, auf der er lebte, aus planetdem Zentrum der Welt gezogen hat. Dass C. Darwin die Gestalt, in der er lebte, aus dem Zentrum der Schöpfung zog. Und dass S. Freud das Bewusstsein, in dem er lebte, aus dem Zentrum seines Handelns zog. Wirklich gelernt habe ich erst später, dass die drei Wissenschaftler über je sich selbst gesprochen haben. Der Mensch dieser Wissenschaften ist ein zufälliges Produkt einer zufälligen Evolution an einem zufälligen Ort auf einem Planeten der Sonne der Milchstrasse des Universums, wo er sich un- und unterbewusst, also ganz zufällig verhält. Als Nichts im Nirgendwo, das nur getrieben ist, hätte ich auch keinen Grund, ich zu sagen.
Dass mein Unbehagen mit meiner Verdrängungen des Subjektes zusammenhängt, habe ich in derselben Schule gelernt, deren Zweck ich darin sehe, diese Verdrängung durch die Tabuisierung des Subjektes zu gewährleisten. Jede Tabuisierung ist darauf angelegt, den unvermeidbaren Diskurs in gewissen Grenzen zu halten. Ich lernte beim Üben des Schreibens auch Lehren kennen, die das Subjekt thematisieren und sogar fokussieren. Der vermeintliche Kinderpsychologe J. Piaget untersuchte, wie er zu seiner Sprache kam. Dazu fokussierte er das Lernen des Kindes in einer subjektorientierten Theorie, der sich viele nachfolgende Psychologen nicht zu entziehen vermochten. Er öffnete damit dem verdrängten Subjekt wenigstens ansatzweise einen Weg – oder einen Umweg über das Lernen – ins je eigene Bewusstsein.
Zwei Lehren, die ich mit der piaget’schen Subjekttheorie verbinde, bezeichne ich mit Eigennamen, ich bezeichne sie als Radikalen Konstruktivismus und als Kritische Psychologie. In meinem Studium entdeckte ich, dass mein Psychologieprofessor alle wichtigen Bücher der Kritischen Psychologie in seinem Schrank versteckt hatte. Sie waren nicht in der Bibliothek und wurden in den Vorlesungen nie zitiert, aber sie waren trotzdem da. Daran erinnerte ich mich, als ich das Buch von U. Eco las, in welchem die wichtigen Bücher im Kloster auch erfolglos versteckt wurden. Derselbe Psychologieprofessor hielt viel später, als der Konstruktivismus nicht mehr zu verleugnen war, Vorlesungen gegen den Radikalen Konstruktivismus, den er damit natürlich auch beim Namen nennen musste.
Institutionen wie Schulen, insbesondere Hochschulen können nicht verhindern, dass die Regeln verletzt werden, weil sie andauernd potentielle Verletzungen thematisieren müssen. Schulen, die mit Lehrplänen formulieren, was gelehrt werden muss und mithin was gelehrt werden darf, schreiben dabei quasi auf der Rückseite der Medaille mit, was nicht gelehrt werden soll. Und dazu muss sich die Institution damit befassen, was sie ausblenden will. Unser Professor musste die Bücher der Kritischen Psychologie studieren, um abschätzen zu können, ob er sie zurecht versteckt. Er musste also die Regel brechen, wonach solche Bücher nicht gelesen werden sollten, um die Regel – von der notwendigen Ausnahme abgesehen – aufrecht zu erhalten.
Die Subjekttheorien, die ich kennenlernte, beobachteten weniger das entwickelte Subjekt als dessen Entwicklung, die sie als Lernen begreifen. Darin sind sie einerseits befangen, aber andrerseits ist das wohl auch der Grund, weshalb diese Ansätze in die Schulen kamen. In beiden Ansätzen spielt die Sprache als Medium der Vergesellschaftung eine wichtige Rolle, wobei relativ unklar bleibt, was als Sprache bezeichnet wird. Für mich war wichtig, dass ich mein “ich” nicht mehr im freudschen Unbehagen aufheben musste, sondern dass ich als Beobachter im Zentrum meiner Welt stehe.
Eine methodologische Zuspitzung dieser Subjektorientierung lernte ich als Dialog abseits der Schule kennen, weil diese Art Dialog und Schule sich praktisch ausschliessen. In diesen Dialogen wird durch eine bewusste Reflexion in Form von Verhaltensregeln darüber, wie ich spreche, verhindert, dass der Gesprächsgegenstand die Führung darüber übernimmt, was ich spreche. Die Protokolle, die die Gesprächsform festlegen, sollen verhindern, dass die Sprechenden zu Subjekten einer jeweils verhandelten Sache verkommen. Die Protokolle verlangen vordergründig, dass die Formulierungen eine bestimmte Form einhalten, so dass ich jedes Mal bevor ich spreche, noch etwas über die Formulierung nachdenken muss. So bleibe ich stets gewahr, dass ich spreche und dass ich das, was ich sage, auf verschiedene Weise sagen könnte, wobei ich dann natürlich Verschiedenes sagen würde. Ich treffe eine Wahl und bedenke so, was ich mit dem, was ich sage und wie ich es sage, aneignen will. Dieses Aneignen verstehe ich als allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
Diese Auffassung widerspricht den Schulen, die ich besucht habe, diametral. In dieser Art Dialog sind keine als Kinder eingestufte Menschen beteiligt, die belehrt werden. Und natürlich auch keine Idioten, wie jene, die Sokrates und später G. Galilei in deren “Pseudodialogen” diskursiv geholfen haben, das vermeintlich einzig Richtige zu sagen. Durch die Dialoge erkannte ich, wie ich als Schüler in sokratische Pseudodialoge verstrickt und so erzogen wurde. D. Bohm, der den Dialog als Gesprächsform vorgeschlagen hat, bezog sich auf Streitereien zwischen A. Einstein und N. Bohr, die sich gegenseitig belehren wollten, weil sie nach D. Bohms Auffassung beide meinten, sie hätten entweder die Wirklichkeit beschrieben oder die einzig mögliche Beschreibung einer allfälligen Wirklichkeit gefunden. Zwei der wichtigsten Physiker konnten nicht miteinander sprechen, weil sie nur lehren konnten.
Mit dem Ausdruck Dialog bezeichne ich in dieser Differenz nicht ein Gespräch, sondern was ich in einem Gespräch über mich erfahren kann. Dialog steht in diesem Sinne für “dia logos”, also für das, was ich “durch das Wort” erkenne oder für das, was ich durch meine Worte mir aneigne. Dem Sprechen – und natürlich auch dem Schreiben – wird dabei die Funktion zugeordnet, sich die Welt eigentlich bewusst zu machen. Im Kontext des Radikalen Konstruktivismus wird diese Aneignung als Konstruieren bezeichnet. Ich beschreibe sozusagen meine Konstruktionen. Dabei liegt der Focus aber normalerweise auf einer mentalen Repräsentation. Viele Konstruktivisten gehen sogar solipsistisch so weit zu sagen, dass es die Welt gar nicht gebe, sondern nur mentale Repräsentation. Die Subjektorientierung wird so weit getrieben, dass alle Objekte jenseits der Vorstellung Illusionen sind.
Die Kritische Psychologie thematisiert die Aneignung zunächst verdoppelt, als Tätigkeit und als Sprache, in welcher die Tätigkeit reflektiert und vor allem kulturell weitergegeben wird. Durch diese Aneignung – die in der biblischen Variante als sich Welt untertan machen erscheint – wird dem Subjekt ein Primat zugeschrieben. Das Subjekt eignet sich die Welt an. Die Aneignung wird dann allerdings ziemlich psychologisch interpretiert, eben als Lernen, nicht als viel Geld aneignen.
Die eigentliche Aneignung sehe ich in einer Tätigkeit, in welcher ich die materielle Welt forme, wenn ich beispielsweise als Schreiner einen Tisch herstelle und dabei das Holz als Natur begreife, weil ich es nicht herstellen kann. Die Aneignung sehe ich in der Verarbeitung, die ich als Kultivierung bezeichne. Natürlich muss ich solche Tätigkeiten in einem gewissen Sinn “lernen”, was ich als Aneignen von Fähigkeiten begreifen kann. Aber dieses Lernen und die damit verbundene mentale Repräsentation, sind psychologisch beobachtbare Nebenwirkungen der eigentlichen Tätigkeit, die mir unter den gegeben gesellschaftlichen Verhältnissen als Arbeit erscheint.
Das Schreiben begreife ich in diesem Sinn als Arbeitstätigkeit. In seiner einfachsten Form sehe ich das Schreiben als Handwerk. Über die Entfaltung dieses Handwerkes will ich in diesem Buch schreiben. Ich staune immer wieder darüber, wie der handwerkliche Aspekt des Schreibens negiert wird, gerade weil die Schule, wo ich das Schreiben gelernt habe, am Anfang enorm viel Wert auf das handschriftliche Schreiben legt. Es geht dabei buchstäblich um das körperliche Können der Buchstabenproduktion, die nicht durch Tintenflecken auf dem Papier beschädigt werden darf.
Die meisten Menschen, mit denen ich über die Schule und das Schreiben gesprochen haben, erinnern sich sehr gut daran, wie sie am Anfang ihrer Schulzeit zu einer für das Schreiben günstige Körper- und Schreibhaltung gewöhnt wurden, wie sie die Grundbewegungen des Schreibens nach allen Richtungen rhythmisch auszuführen üben mussten und wie sie dabei ihre Fein- und Schreibmotorik entwickelten. Aber praktisch niemand erkennt im Nachhinein darin das Handwerk, das damit erlernt wurde. Die sogenannte Digitalisierung – davon abgesehen, dass diese Bezeichnung das damit verbundene Verständnis selbstreferenziell kritisiert – wird nicht als Automatisierung eines Handwerkes gesehen, sondern als Beleg für eine immaterielle Geistigkeit, die im Schreiben ihren Ausdruck findet. Praktisch alle Menschen, mit den ich darüber gesprochen habe, verbinden das Schreiben mit Denken und Sprache und sehen Text als Vergegenständlichung einer nicht-gegenständlichen Sprache. Sie unterstellen dabei, dass „Sprache” sehr viel mit Bewusstsein und Geist, aber nur ganz wenig mit konstruierten, materiellen Textstrukturen zu tun habe. Dass ich beim Konstruieren von Texten „sprachlich denke”, sagt weder etwas darüber aus, was Text ist, noch darüber, was Denken und Bewusstsein sein soll. Dass text2ich aber den Handlungszusammenhang, den ich mit materiellen Text-Konstruktionen begründe, Sprache nenne, sagt etwas darüber aus, dass ich „Sprache” mindestens in bestimmten Hinsichten auch konstruktiv und nicht nur funktional verstehen kann. Die im intuitiv geprägten Ausdruck „Konstruktivismus” gemeinten Konstruktionen sehe ich in materiellen Texten – und nicht in irgendwelchen geistigen Konstrukten in den Köpfen der Beobachter, die die Texte deuten.
******
Schliesslich aber merkte ich – und das ist für mich in diesem Kontext wichtig – dass Schreiben und Rechen keinen Inhalt hat. Schreiben ist eine Tätigkeit, die ich können muss, also keine Lehre, die ich kennen oder wissen sollte. Das Schulfach, in welchem Schreiben gelehrt wird, heisst normalerweise nicht Schreiben, sondern ganz diffus Sprache. Schreiben hat darin sehr verschiedene Bedeutungen. Zunächst geht es darum, Text herstellen zu können, völlig unabhängig davon, was in den Texten steht. Es geht darum, die Buchstaben lesbar in einer richtigen Reihenfolge produzieren zu können. Später geht es darum, die Grammatik nicht zu verletzen und schliesslich darum, Aufsätze oder Dissertationen zu schreiben. Diese Unterschiede sind in der Fachbezeichnung “Sprache” aufgehoben, aber unabhängig davon, was oder welche Stufe jeweils mit “Schreiben” bezeichnet wird.
Insgesamt wissen spontan ganz viele Menschen so wenig wie ich zunächst wusste, was sie in der Schule gelernt haben. Die Gespräche halfen mir aber zu realisieren, dass ich in der Schule eine “Sprache” lernte, in welcher ich mein “ich” verdrängte. Die Schule ist der Ort, wo ich mein “ich” wegtrainiert bekommen habe. Als Schüler musste ich die ich-Losigkeit übernehmen, die ich als Dozent weitergeben musste.
Dann habe ich wieder beim libidofeindlichen S. Freud entdeckt, was ich in der Schule – zum Wohle der Kultur – hätte lernen sollen. In einer perversen Inversion des Inhaltes meines Unbehagens hat S. Freud auch mein Unbehagen mit drei Kränkungen des gesunden Menschenverstandes erklärt. Als “gesunder Menschenverstand” bezeichnete er dabei, was durch die Lehre überwunden planetwerden soll – was bei mir, wenn auch nicht so nachhaltig wie wohl gewünscht – erreicht wurde. Ich lernte – obwohl ich das heute nicht mehr als Lernen bezeichnen würde – dass N. Kopernikus die Erde, auf der er lebte, aus dem Zentrum der Welt gezogen hat. Dass C. Darwin die Gestalt, in der er lebte, aus dem Zentrum der Schöpfung zog. Und dass S. Freud das Bewusstsein, in dem er lebte, aus dem Zentrum seines Handelns zog. Der Mensch dieser Wissenschaften – ich ? – ist ein zufälliges Wesen der Evolution an einem zufälligen Ort auf einem Planeten der Sonne der Milchstrasse des Universums, das sich zufällig (un- und unterbewusst) verhält. Universum, Evolution und Unbewusstes sind Elemente der herrschenden Ordnung, also Elemente der Ordnung der Herrschenden. Sie sind (wissenschafts-)kulturell die letzten Konsequenzen daraus, dass die Herrschenden, die über Objekte herrschen, ihr Erleben und ihre Erfahrungen in Form einer objektiven Welt wahrnehmen (müssen), welcher sie – wie das Wort sagt – als verantwortungslose Sub-Jekte unterworfen sind. Die Herrschenden können nichts dafür, dass die Evolution sie zu dem machte, was sie sind. Sie spielen ihre Rolle als Rolle in einer gewalt\igen Institutionalisierung, in welcher die Rolle bestimmt, was der Rolleninhaber tut. Die brutalste (nackteste) Formulierung dieser Welt erkenne ich in Luhmann’s sozialem System, in welchem Menschen wie Zellen eines Organismus nur noch als psychodelische Träger der mit Eigenleben ausgestatteten Institutionen fungieren, also gar nicht mehr vorkommen. Als Nichts im Nirgendwo, das nur getrieben ist, habe ich keinen Grund, ich zu sagen.
-----------
============ kommt noch ==============
Universum, Evolution und Unbewusstes sind Elemente der herrschenden Ordnung, also Elemente der Ordnung der Herrschenden. Sie sind (wissenschafts-)kulturell die letzten Konsequenzen daraus, dass die Herrschenden, die über Objekte herrschen, ihr Erleben und ihre Erfahrungen in Form einer objektiven Welt wahrnehmen (müssen), welcher sie – wie das Wort in dieser Deutung sagt – als verantwortungslose Sub-Jekte unterworfen sind. Die Herrschenden können nichts dafür, dass die Evolution sie zu dem machte, was sie sind. Sie spielen ihre Rolle als Rolle in einer gewalt\igen Institutionalisierung, in welcher die Rolle bestimmt, was der Rolleninhaber tut. Die brutalste (nackteste) Formulierung dieser Welt erkenne ich in Luhmann’s sozialem System, in welchem Menschen wie Zellen eines Organismus nur noch als psychodelische Träger der mit Eigenleben ausgestatteten Institutionen fungieren, also gar nicht mehr vorkommen.
-----------------
Ich verdrängte über meine eigenen Beobachtungen zu sprechen, ich wurde dazu erzogen, quasi wissenschaftlich über die Welt zu sprechen. Die Schule sehe ich jetzt als Instrument einer Kultur, in der eine Welt gegeben ist.
Der Radikale Konstruktivismus und die Kritische Psychologie klärten mir meine Verdrängungen des Subjektes auf. Beides sind Lehren, die ich an Schulen kennenlernte. Ich lernte dabei auch, dass die Schule wie jede Institution Ausnahmen zulässt, einfach weil sich das Unbhagen der Verdrängung da und dort Luft machen muss.
Der Radikale Konstruktivismus und die Kritische Psychologie wurden zeitgleich mit dem Neoliberalismus erfunden, der die Schule in eine sehr komplizierte Lage brachte, weil er die soziale Ungleichheit enttabuisierte.
eine Lehre
Dialog ein Praktizieren
Unabhängig davon hat Schreiben natürlich mit Schrift und Sprache zu tun, was ja Thema dieses Buches ist.
schreiben ist DAS Handwerk, aber die die Menschen meinen gar nicht das Handwerk, sondern das richtig ortographisch grammatisch richte schreiben ...
Mit Dialog im Dialog lege ich einige Berichte von inszenierten Dialogen vor. Inszeniert werden solche Dialoge in Form von Veranstaltungen, in welchen durch Protokolle darüber, wie man spricht, verhindert wird, dass der Gesprächsgegenstand die Führung darüber übernimmt, was man spricht. Die Protokolle, die die Gesprächsform festlegen, sollen verhindern, dass die Sprechenden zu Subjekten verkommen, die der jeweils verhandelten Sache unterworfen sind. In diesen Dialog sollen nicht die Gesprächsgegenstände bestimmen, was gesagt wird, sondern der Logos durch die Form der Sprache. Die Protokolle verlangen vordergründig, dass die Formulierungen eine bestimmte Form einhalten, so dass ich jedes Mal bevor ich spreche, noch etwas über die Formulierung nachdenken muss. So bleibe ich stets gewahr, dass ich spreche und dass ich das, was ich sage, auf verschiedene Weise sagen könnte, wobei ich dann natürlich Verschiedenes sagen würde. Ich treffe eine Wahl und bedenke so, was ich mit dem, was ich sage und wie ich es sage, aneignen will. Dieses Aneignen verstehe ich als allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Ich spreche so, damit mir klarer wird, wie ich zu andern, zum Du spreche.
Ich befasse mich schon einige Zeit mit Hypertext und habe dazu auch schon einiges geschrieben
http://www.hyperkommunikation.ch/todesco/publikationen/ti/ti_leseprobe.htm
Der Radikale Konstruktivismus und die Kritische Psychologie wurden zeitgleich mit dem Neoliberalismus erfunden, der die Schule in eine sehr komplizierte Lage brachte, weil er die soziale Ungleichheit enttabuisierte.
last update: 12.2.2015 / 13.2.2015 /
===============================
Als Aneignung bezeichne ich - anders als die meisten Vertreter der Kritischen Psychologie oder der kulturhistorischen Schule - nicht vor allem das Lernen, sondern die materielle Produktion, in welcher ich meine Reproduktion realisiere. Die materielle Produktion sehe ich nicht nur weitgehend gesellschaftlich organisiert, ich sehe in deren Organisation das Wesen der Gesellschaft überhaupt. Von einer kapitalistischen Gesellschaft spreche ich, wenn sie einer tayloristischen Arbeitsteilung der Lohnarbeit unterliegt.
Es gibt eine Produktion, die ich selbst vom primitivsten Handwerk bis zur höstentwickelten Automtisierung ohne Arbeitsteilung ausführe. Das ist die Herstellung von Text, was ich als Schreiben bezeichne. Dieser Produktionsprozess begründet, was ich als Schrift und Sprache bezeichne.
============================
-------------Beispielsweise im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich in der Schweiz werden fünf Unterrichtsbereiche unterschieden, wovon einer mit "Sprache" bezeichnet wird. Mit Sprache ist von ein paar einleitenden Floskeln die deutsche Sprache (und ausserdem beispielsweise die französische Sprache als Fremdsprache) gemeint. In den ersten Schuljahren ist dann Sprechen und Hören und Lesen und schreiben-----------
Forts. folgt…
Schreiben hat natürlich mit Schrift und Sprache zu tun, was ja Thema dieses Buches ist.
|
![bild]()
|



