Kopien meiner Blogs (Weblog)
als Datensicherung
[ zurück ]
[ Stichworte ]
[ Die Hyper-Bibliothek ]
[ Systemtheorie ]
[ Meine Bücher ]
Inhalt - weiter
Trumps vermeintliche Wende - April 8, 2017
ich beobachte gerade, wie unsere Medien Hr. Trump beobachten. Die NZZ meint ganz typisch, dass Hr. Trump eine seltsamerweise einsichtige Kehrtwendung vorgenommen habe, nachdem er sich bislang gegen ein Engagement in Syrien ausgesprochen habe. Unseren Qualitätsredaktionen (die den Journalismus be-lohn-en) gefällt die "neue" Politik von Hr. Trump sehr gut.
Ich beobachte aber etwas ganz anderes: Hr. Trump geht es in keiner Weise um Syrien  oder Giftgas. Das ist alles Ausland für ihn. Dagegen geht es ihm seinen Aussagen nach darum, im Inland wichtige Freunde zu gewinnen und zu binden. Und wer wäre ein gewichtigerer Freund als die Rüstungsindustrie, deren Werbeträger Armee so schöne Tomahawk Raktetenbilder in die Qualitätsmedien liefert?
Hr. Trump bleibt sich und seinen Wahlversprechen treu - und unsere Qualitätsmedien tun das eben auch.
oder Giftgas. Das ist alles Ausland für ihn. Dagegen geht es ihm seinen Aussagen nach darum, im Inland wichtige Freunde zu gewinnen und zu binden. Und wer wäre ein gewichtigerer Freund als die Rüstungsindustrie, deren Werbeträger Armee so schöne Tomahawk Raktetenbilder in die Qualitätsmedien liefert?
Hr. Trump bleibt sich und seinen Wahlversprechen treu - und unsere Qualitätsmedien tun das eben auch.
[2 Kommentar]
Inhalt
Was ist ein Plan? - April 5, 2017
Der Ausdruck Plan wird umgangssprachlich für sehr verschiedene Sachen verwendet. Insbesondere auch für mentale Pläne, die ich "im Kopf" habe, wenn ich etwas "plane", also überlege, wie ich vorgehen oder mich verhalten will. Hier beobachte ich aber nur Pläne ausserhalb meines Kopfes, also gezeichnete Artefakte.
Wer einen Plan "im Kopf" hat, kann den Plan (ausserhalb seines Kopfes) zeichnen und/oder dessen Referenzobjekt des Plans herstellen. Die Biene als "marxistischer Baumeister" unterscheidet sich vom menschlichen Baumeister nicht dadurch, dass letzterer zuerst einen Plan macht/hat, sondern dass letzterer einen Plan (ausserhalb seines Kopfes) herstellen - und danach den Plan und den Referenten des Plans vergleichen kann. Der Plan dient dann als kopf-externes Gedächtnis.
Als Plan bezeichne ich in diesem eingeschränkten Sinn eine quasi-isomorphe, analoge Abbildung des Referenzobjektes. Bei den gezeichnetne Pläne unterscheide ich zwei Perspektiven oder Orientierungen: den anweisenden Vorab-Plan und den orientierenden Nachher-Plan.
Als (Vorab)-Plan bezeichne ich eine gezeichnete Abbildung, die ich als Anweisung 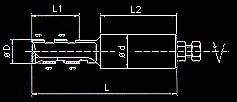 interpretiere. Der typische Fall dafür ist der Konstruktionsplan, der mir zeigt, was ich wie herstellen muss. Der anweisende Plan ist ein Teil eines Konzepts, in welchem die herstellende Tätigkeit so zerlegt wird, dass zunächst - allenfalls arbeitsteilig - eine Zeichnung hergestellt wird.
Als (Nacher)-Plan bezeichne ich eine Abbildung, die ich als Orientierungshilfe verwende. Der typische Fall dafür ist der Stadtplan, der mir zeigt, wie die Stadt gebaut wurde. Der Stadtplan wird normalerweise gezeichnet, nachdem die Stadt gebaut ist, während der Konstruktionsplan einer Maschine normalerweise gezeichnet wird, bevor die Maschine hergestellt wird. Als Abbildung ist der Plan logisch-genetisch aber immer später als das Referenzobjektes des Plans. Auch im Konstruktionsplan zeichne ich eine Maschine, die ich vor meinem geistigen Auge sehen kann.
interpretiere. Der typische Fall dafür ist der Konstruktionsplan, der mir zeigt, was ich wie herstellen muss. Der anweisende Plan ist ein Teil eines Konzepts, in welchem die herstellende Tätigkeit so zerlegt wird, dass zunächst - allenfalls arbeitsteilig - eine Zeichnung hergestellt wird.
Als (Nacher)-Plan bezeichne ich eine Abbildung, die ich als Orientierungshilfe verwende. Der typische Fall dafür ist der Stadtplan, der mir zeigt, wie die Stadt gebaut wurde. Der Stadtplan wird normalerweise gezeichnet, nachdem die Stadt gebaut ist, während der Konstruktionsplan einer Maschine normalerweise gezeichnet wird, bevor die Maschine hergestellt wird. Als Abbildung ist der Plan logisch-genetisch aber immer später als das Referenzobjektes des Plans. Auch im Konstruktionsplan zeichne ich eine Maschine, die ich vor meinem geistigen Auge sehen kann. Der operative Zweck des Plans ist in beiden Fällen derselbe. Er lässt sich aber anhand des Stadtplanes unmittelbarer veranschaulichen. Wenn ich dem Stadtplan lese, folge ich mit meinen Augen den Strassen, die mich interessieren. Ich mache dabei mit den Augen die Bewegungen, die ich dann mit meinem Füssen mache, wenn ich durch die die entsprechenden Strassen gehe. Der Stadtplan erfüllt seine Funktion, weil ich die Beziehung zwischen dem Weg meiner Augen und dem Weg meiner Füsse in mir erzeugen kann.
Der operative Zweck des Plans ist in beiden Fällen derselbe. Er lässt sich aber anhand des Stadtplanes unmittelbarer veranschaulichen. Wenn ich dem Stadtplan lese, folge ich mit meinen Augen den Strassen, die mich interessieren. Ich mache dabei mit den Augen die Bewegungen, die ich dann mit meinem Füssen mache, wenn ich durch die die entsprechenden Strassen gehe. Der Stadtplan erfüllt seine Funktion, weil ich die Beziehung zwischen dem Weg meiner Augen und dem Weg meiner Füsse in mir erzeugen kann.
[1 Kommentar]
Inhalt
Das Elend der Massenmedien - Februar 4, 2017
Die NZZ startet einen neuen Versuch, das von ihr bezeichnete Machtgefälle zwischen den Zeitungseigentümern und der Leserschaft im Facebook aufrecht zu erhalten. Die Redaktion fungiert dabei als Moderator, der eingreift, wenn die Regeln, die der Redaktion gefallen, verletzt werden.
Das Internet hat anders als Massenmedien keine Gatekeeper. Aber lokal kann das Facebook natürlich rein gehalten werden, weil jede(r) FacebookerIn die je eigenen Seite von fremden Kommentaren rein halten kann.
Wenn auf meiner Facebookseite etwas geschrieben wird, was mir nicht gefällt, lösche ich es. Darin erkenne ich keine Zensur, weil jede(r) auf seiner Facebookseite schreiben kann, was sie/er will.
So sehe ich das Facebook und das Internet. Die NZZ sieht das aber ganz anders. Sie sieht das Facebook als Ort ihrer Redaktion, als Ort für Leserbriefe, für die sie mit Machtgefälle zuständig sein will.
Die NZZ ignoriert - wohl sehr bewusst - den Unterschied zwischen Internet und Massenmedien, sie möchte im von ihr konstatierten "Machtgefälle" oben bleiben - obwohl sie auf Facebook-Konsorten nicht verzichten kann: das ist das Elend der Massenmedien und ihrer Eigentümer.
[0 Kommentar]
Inhalt
Big-Data-Wahlen (zb Brexit oder Trump) - Dezember 15, 2016
Als postfaktisches Ereignis schlechthin erkenne  ich die bigdata-vermittelte Werbung, mit welcher nicht nur mehr McDonalds-Food verkauft werden, sondern auch grosse politische Wahlen oder Abstimmungen gewonnen werden.
Früher gab es mal die vermeintlich wissenschaftlich gesicherte Vorstellung, wonach CocoaCola in den Kinofilmen so kurze Werbesequenzen einfügt, dass ich sie beim Betrachten des Filmes gar nicht sehen kann. Dabei wird beispielsweise jedes hundertste Bild im Film mit einer CocaCola-Werbung ersetzt. Wissenschaftler haben dann "bewiesen" (das heisst verifiziert), dass sie diese Werbung zwar bewusst nicht wahrnehmen, aber unterbewusst trotzdem darauf reagieren. Sie habe in der Kinofilmpause und nach dem Film immer viel mehr CocaCola getrunken.
Später wurde dann - wieder werbungs-wissenschaftlich - bewiesen, dass die im Film sichtbar verwendeten Produkte als Werbung dienen. Viele heutige Kinofilme werden durch solche Produktewerbung weitgehend finanziert. Der Filmstar fährt einen Mercedes und benutzt ein Apple-Computer, usw. Ich habe keinen Kinofilm gesehen, in welchem sich der Star für Brexit oder für Trump geäussert hat, aber ich habe ja nicht alle Filme gesehen.
Sehr viele "Kinofilme" schaue ich als TV-Filme. Im TV werden die Filme sehr oft von gut erkennbarer Werbungen unterbrochen, in welchen dann ganz jenseits des Filmes der Tennisspieler Federer einen Mercedes fährt. Diese Art Werbung - deren Wirkung natürlich auch wissenschaftlich belegt ist - wird in der Schweiz seltsamerweise extrem selten für politische Wahlen oder Abstimmungen verwendet. Solche Werbung scheint politisch anrüchig oder unmoralisch zu sein. Bislang habe ich das Fehlen der TV-Werbung für die SVP im Sinne einer Verschwörungstheorie gedeutet, nach welcher der Staat solche Werbung verbietet, weil er sie für alle Parteien bezahlen würde. Jetzt aber sehe ich das unter Big-Data-Gesichtspunkten viel praktischer. Die Big-Data-Wissenschaftler haben jetzt nämlich - speziell im Fall von Trump - bewiesen, dass solche Werbung für Politiker oder Parteien gar nichts taugen würde.
Konventionelle TV-Werbung doppelt wäre - sagen die Big-Data-Werber - in zwei HInsichten schlecht. Zum einen würde solche Werbung ein Konkurrenzparadox erzeugen. Ein Konkurrenzparadox zeigt sich beispielsweise dann, wenn jemand im Kino einfach aufsteht, um den Film besser zu sehen. Dann müssten nämlich alle hinter ihm auch aufstehen, so dass das Aufstehen für alle nur noch Kosten verursachen würde. Jeder konventionelle Werber weiss natürlich, dass dieses Paradox Unsinn ist, weil die Big-Data-Werber die Kinobesucher in der zweiten Reihe übersehen, die vom Aufstehen tatsächlich profitieren.
Viel wichtiger aber - und darin muss ich den Big-Data-Werber recht geben - ist, dass eine Werbung für Mercedes, wo oder in welchem Film auch immer, in dem Sinne nichts bringt, als sich die meisten Zuschauer gar keinen Mercedes leisten können. Deshalb wäre es viel besser, wenn jeder Zuschauer die Autowerbung sehen würde, die zu seinem Vermögen passt. In konventionellen Massenmedien ist das nicht gut realisierbar, weil die ganze jewilige Masse nicht nur dieselben Nachrichten, sondern auch dieselbe Werbung sehen muss.Bei individueller Brief- oder Telefon-Werbung kann ich natürlich - im Prinzip - jeweils passende Angebote machen, wenn ich den potentiellen Kunde kenne.
Hier schlägt die Stunde der Big-Data-Werber, die ihre Werbung im Internet plazieren, also elektrische Briefe (e-mail) verschicken oder in Facebook-Konsorten jeweils bestimmte Empfnger ansprechen. Sie schauen zuerst mit halbwegs raffinierten Methoden, wer sich welche Ware leisten kann, und schicken ihm dann passende dazu Werbung.
Die Big-Data-Werber für Trump haben natürlich nicht geschaut, wer sich Trump leisten könnte, sondern wer für welche Argumente für Trump oder gegen Clinton empfänglich war. Ein beliebtes Beispiel zur Erläuterung dieses Verfahrens ist das heftig umstrittene Waffenrecht. Trump gilt als Verfechter einer sehr liberalen Haltung, nach welcher jeder so viele Waffen besitzen darf, wie er will. Die Big-Data-Werber schauen also, ob ich beispielsweise eher ängstlich oder eher ein Jäger bin. Dann schicken sie mir entsprechend Werbung, in welcher Trump für Waffen als Schutz vor Einbrechern wirbt, oder eben für Waffen, wie sie die ursprünglichen Siedler am Anfang der USA getragen habe. In beiden Fällen lasse ich mich aus verschiedenen Gründen tendenziell für freien Waffenbesitz begeistern und dann - in einer für Big-Data-Werber bewiesenen Konsequenz - Trump wählen.
Bei mir selbst wirkt solche Werbung natürlich sowenig, wie die - auch nicht sichtbare - CocaCola-Werbung im Kino. Und bei allen Menschen, die mit mir darüber sprechen, wirkt diese Werbung auch nicht. Aber bei allen andern scheint sie hinreichend zu wirken: denn so wurde Trump schliesslich gewählt - sagen die Big-Data-Werber und viele Menschen, die Trump nicht mögen, scheinen den Big-Data-Werber jetzt gerne zu glauben. Diese Werbung für Big-Data scheint ohne jedes Big-Data zu funktionieren.
ich die bigdata-vermittelte Werbung, mit welcher nicht nur mehr McDonalds-Food verkauft werden, sondern auch grosse politische Wahlen oder Abstimmungen gewonnen werden.
Früher gab es mal die vermeintlich wissenschaftlich gesicherte Vorstellung, wonach CocoaCola in den Kinofilmen so kurze Werbesequenzen einfügt, dass ich sie beim Betrachten des Filmes gar nicht sehen kann. Dabei wird beispielsweise jedes hundertste Bild im Film mit einer CocaCola-Werbung ersetzt. Wissenschaftler haben dann "bewiesen" (das heisst verifiziert), dass sie diese Werbung zwar bewusst nicht wahrnehmen, aber unterbewusst trotzdem darauf reagieren. Sie habe in der Kinofilmpause und nach dem Film immer viel mehr CocaCola getrunken.
Später wurde dann - wieder werbungs-wissenschaftlich - bewiesen, dass die im Film sichtbar verwendeten Produkte als Werbung dienen. Viele heutige Kinofilme werden durch solche Produktewerbung weitgehend finanziert. Der Filmstar fährt einen Mercedes und benutzt ein Apple-Computer, usw. Ich habe keinen Kinofilm gesehen, in welchem sich der Star für Brexit oder für Trump geäussert hat, aber ich habe ja nicht alle Filme gesehen.
Sehr viele "Kinofilme" schaue ich als TV-Filme. Im TV werden die Filme sehr oft von gut erkennbarer Werbungen unterbrochen, in welchen dann ganz jenseits des Filmes der Tennisspieler Federer einen Mercedes fährt. Diese Art Werbung - deren Wirkung natürlich auch wissenschaftlich belegt ist - wird in der Schweiz seltsamerweise extrem selten für politische Wahlen oder Abstimmungen verwendet. Solche Werbung scheint politisch anrüchig oder unmoralisch zu sein. Bislang habe ich das Fehlen der TV-Werbung für die SVP im Sinne einer Verschwörungstheorie gedeutet, nach welcher der Staat solche Werbung verbietet, weil er sie für alle Parteien bezahlen würde. Jetzt aber sehe ich das unter Big-Data-Gesichtspunkten viel praktischer. Die Big-Data-Wissenschaftler haben jetzt nämlich - speziell im Fall von Trump - bewiesen, dass solche Werbung für Politiker oder Parteien gar nichts taugen würde.
Konventionelle TV-Werbung doppelt wäre - sagen die Big-Data-Werber - in zwei HInsichten schlecht. Zum einen würde solche Werbung ein Konkurrenzparadox erzeugen. Ein Konkurrenzparadox zeigt sich beispielsweise dann, wenn jemand im Kino einfach aufsteht, um den Film besser zu sehen. Dann müssten nämlich alle hinter ihm auch aufstehen, so dass das Aufstehen für alle nur noch Kosten verursachen würde. Jeder konventionelle Werber weiss natürlich, dass dieses Paradox Unsinn ist, weil die Big-Data-Werber die Kinobesucher in der zweiten Reihe übersehen, die vom Aufstehen tatsächlich profitieren.
Viel wichtiger aber - und darin muss ich den Big-Data-Werber recht geben - ist, dass eine Werbung für Mercedes, wo oder in welchem Film auch immer, in dem Sinne nichts bringt, als sich die meisten Zuschauer gar keinen Mercedes leisten können. Deshalb wäre es viel besser, wenn jeder Zuschauer die Autowerbung sehen würde, die zu seinem Vermögen passt. In konventionellen Massenmedien ist das nicht gut realisierbar, weil die ganze jewilige Masse nicht nur dieselben Nachrichten, sondern auch dieselbe Werbung sehen muss.Bei individueller Brief- oder Telefon-Werbung kann ich natürlich - im Prinzip - jeweils passende Angebote machen, wenn ich den potentiellen Kunde kenne.
Hier schlägt die Stunde der Big-Data-Werber, die ihre Werbung im Internet plazieren, also elektrische Briefe (e-mail) verschicken oder in Facebook-Konsorten jeweils bestimmte Empfnger ansprechen. Sie schauen zuerst mit halbwegs raffinierten Methoden, wer sich welche Ware leisten kann, und schicken ihm dann passende dazu Werbung.
Die Big-Data-Werber für Trump haben natürlich nicht geschaut, wer sich Trump leisten könnte, sondern wer für welche Argumente für Trump oder gegen Clinton empfänglich war. Ein beliebtes Beispiel zur Erläuterung dieses Verfahrens ist das heftig umstrittene Waffenrecht. Trump gilt als Verfechter einer sehr liberalen Haltung, nach welcher jeder so viele Waffen besitzen darf, wie er will. Die Big-Data-Werber schauen also, ob ich beispielsweise eher ängstlich oder eher ein Jäger bin. Dann schicken sie mir entsprechend Werbung, in welcher Trump für Waffen als Schutz vor Einbrechern wirbt, oder eben für Waffen, wie sie die ursprünglichen Siedler am Anfang der USA getragen habe. In beiden Fällen lasse ich mich aus verschiedenen Gründen tendenziell für freien Waffenbesitz begeistern und dann - in einer für Big-Data-Werber bewiesenen Konsequenz - Trump wählen.
Bei mir selbst wirkt solche Werbung natürlich sowenig, wie die - auch nicht sichtbare - CocaCola-Werbung im Kino. Und bei allen Menschen, die mit mir darüber sprechen, wirkt diese Werbung auch nicht. Aber bei allen andern scheint sie hinreichend zu wirken: denn so wurde Trump schliesslich gewählt - sagen die Big-Data-Werber und viele Menschen, die Trump nicht mögen, scheinen den Big-Data-Werber jetzt gerne zu glauben. Diese Werbung für Big-Data scheint ohne jedes Big-Data zu funktionieren.
[0 Kommentar]
Inhalt
Arbeit 4.0 - November 22, 2016
Mich irritiert die Frage, wie WIR in Zukunft arbeiten werden. Ich frage mich, wer WIR sein könnte. WIR Roboter? Was soll Arbeit 4.0 denn anderes heissen?
Roboter übernehmen nie und unter keinen Umständen MENSCHLICHE Tätigkeiten, Roboter sind Maschinen. Und als Produktionsmittel sind sie - im Kapitalismus - Eigentum der Kapitalisten, Deshalb gibt es kein WIR im Sinne einer Gattung, sondern jene, die  Roboter besitzen und deshalb ihr Kapital vergrössern (können) und jene, die keine Roboter haben und deshalb im kapitalistischen Markt verlieren.
Roboter besitzen und deshalb ihr Kapital vergrössern (können) und jene, die keine Roboter haben und deshalb im kapitalistischen Markt verlieren.
WIR würde in Bezug auf Roboter vielleicht gehen, wenn diese Allgemeingut oder Allmende wären. Aber auch dann würden Roboter nicht arbeiten, wir würden mittels Roboter arbeiten, so wie ich etwa mittels eines Hammers arbeite. Ich kann mit einem Handbohrer Löcher machen, ich kann mit einer Bohrmaschine Löcher machen und ich kann mit einem Roboter Löcher machen. Ich mache dabei immer Löcher und die Löcher mache immer ich, weil weder der Handbohrer noch der Roboboter das geringste Interesse an den Löcher haben, die ich machen will. Meine Tätigkeit, nämlich das Löcher machen, verändert sich in Abhängigkeit von den Werkzeugen, die ich verwende.
Und es kann sein, dass meine Tätigkeit auf dem Markt nicht mehr verlangt wird, wenn ich mit einem Handbohrer arbeite und meine "menschlicher Konkurrent" einen Roboter verwendet. Das lässt sich sozialdarwinistisch so sehen.
Das hat aber nicht das allergeringste damit zu tun, dass Roboter MEINE oder eine MENSCHLICHE Tätigkeit übernehmen. Es sei denn, das die Wörter "Tätigkeit" und "Roboter" würden ganz anders verwendet, etwa im Sinne des Schwarzenegger-Terminator oder im Sinne des Latour-Maschinenmensch, um nur zwei kapitalistische Bilder zu nennen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Metaphern - Oktober 30, 2016
"Mit der Metapher begeben wir uns in des Teufels Küche”
ein Thesenpapier zur MMK 2016 Mir geht es hier darum, den je eigenen Begriff von Metapher zu erläutern, weil ich das
Gefühl habe, dass es dazu ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Meiner Erfahrung nach ist es praktisch und sinnvoll, wenn ich mich jeweils auf eine explizite Vorstellung beziehen kann. Die Klärung, was ich als Metapher bezeichne, dient dann auch dazu, welche Probleme ich mit Metaphern verbinde. Wer Metapher anders versteht, mag dann auch andere Probleme sehen.
Ich beginne mit einem alltäglichen Beispiel. Ich kann
Mir geht es hier darum, den je eigenen Begriff von Metapher zu erläutern, weil ich das
Gefühl habe, dass es dazu ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Meiner Erfahrung nach ist es praktisch und sinnvoll, wenn ich mich jeweils auf eine explizite Vorstellung beziehen kann. Die Klärung, was ich als Metapher bezeichne, dient dann auch dazu, welche Probleme ich mit Metaphern verbinde. Wer Metapher anders versteht, mag dann auch andere Probleme sehen.
Ich beginne mit einem alltäglichen Beispiel. Ich kann  zu jemandem sagen: "Du bist ein Esel", und wenn er kein Esel ist, versteht er mich. Ich benutze im umgangssprachlichen Sinn eine Metapher, wenn ich von einem Menschen sage, er sei ein Esel, weil der Ausdruck "Esel" Eigenschaften des jeweiligen Menschen unterstellen, die von einem anderen Referenzobjektes des Ausdruckes "übertragen" werden. Metapher steht lax gesprochen für "uneigentliche Wortverwendung". Ein Mensch ist ja - im eigentlichen Sinn des Wortes - kein Esel. Uneigentliche Wortverwendung bedeutet, dass ich ein Wort nicht so verwende, wie ich es eigentlich verwenden sollte. Wobei natürlich unausgesprochen mitschwingt, dass jemand - auch für mich weiss - wie ich das Wort eigentlich verwenden sollte.
Ich gebe ein zweites Beispiel: Ich kann zu jemandem sagen, der auf einer Bank sitzt: "Bring Dein Geld auf die Bank". Und wenn er kein Esel ist, versteht er, dass ich nicht meine, er solle sein Geld auf die Sitzbank legen, auf welcher er gerade sitzt. Bank ist in diesem Fall keine Metapher, sondern ein Homonym. Als Homonym bezeichne ich einen Ausdruck, für den in derselben (Einzel)-Sprache verschiedene Vereinbarungen oder Wortbedeutungen gelten. Der Ausdruck "Bank" steht in diesem Sinn als arbiträr oder zufällig gewählte Buchstabenkette für ein Sitzmöbel und für eine Finanzinstitution. Ich muss in jedem Fall durch den Kontext erkennen, was gerade gemeint ist.
Dass es Homonyme gibt, ist eine eigenartige Sache. Synonyme - also eine Art Inversion zum Homonym, in welcher dasselbe Referenzobjekt durch zwei verschiedene Ausdrücke bezeichnet wird - gibt es nämlich nicht. Darüber will ich hier aber nicht weiter nachdenken, hier interessiert mich die Idee der Metapher.
Als Metapher bezeichne ich ein erkenntnisleitendes Konstrukt, das auf der Grundlage von Homonymen beruht. Wenn ich Homonyme als Metaphern auffasse, postuliere ich eine Übertragung eines Ausdruckes von einem Geber- zu einem Nehmergebiet und frage, welche Eigenschaften damit übertragen werden. Homonyme bezeichne ich also genau dann als Metaphern, wenn die doppelte Verwendung des Ausdruckes etwas über eine Beziehung zwischen den Referenzobjekten des Ausdruckes aussagen soll. "Bank" könnte zufällig für "Geldinstitut" und für "Sitzgelegenheit" stehen, dann würde ich von einem Homonym sprechen. Es könnte aber auch sein, dass ich zwischen den beiden Referenzobjekten irgendeine Verwandtschaft erkenne, dann würde ich von einer Metapher sprechen, und untersuchen, worin die Verwandtschaft besteht. Es gibt auch viele Vorschläge dazu, inwiefern Finanzinstitute und Sitzbänke verwandt sind, die mir bekannten leuchten mir einfach nicht ein.
Unter dem Gesichtspunkt einer uneigentlichen Wortverwendung kann ich mich fragen, welche Wortverwendung die eigentlich und welche metaphorisch ist. Häufigkeitserwägungen helfen dabei keineswegs immer. Im städtischen Kontext etwa wird das Wort "Esel" sehr viel öfter für Menschen als für pferdeartige Tiere verwendet. Ich bezeichne - was auch nur eine Möglichkeit darstellt - diejenige Wortverwendung zu welcher ich eine Definition habe, als eigentlich. Habe ich verschiedene Definitionen, sehe ich den Ausdruck als Homonym.
Auch dazu ein Beispiel. Ein Teil des Computers wird oft als (Daten)speicher bezeichnet. Der Ausdruck Speicher wird aber auch für Kornspeicher verwendet. Wenn ich darin eine Metapher sehe, frage ich mich, was woher wohin übertragen wurde. Dass es Kornspeicher schon länger gibt als Computer, lasse ich dabei ausser Acht. Ich frage mich vielmehr, was ich als Speichern bezeichne. Englisch wird der Ausdruck Memory verwendet. "Gedächtnis" kann ichdeshalb auch als Metapher sehen. Ich kann so erkennen, dass verschiedene Differenzen ins Spiel gebracht werden (können).
Das Konstrukt der Metapher ist für mich also zunächst eine Art Denkform, die mir hilft Zusammenhänge zu sehen. Zum Problem wird diese Denkform, wenn ich sie nicht bewusst reflektiere, weil sie dann dazu führt, dass ich die implizierten Verwandtschaften als gegeben und nicht als von mir projiziert wahrnehme. Dialektisch wird die Denkform, wenn sie unbedacht auf eine andere stösst.
Als Problem erscheint mir die Metapher, wenn durch sie Zusammenhänge oder Verhältnisse postuliert werden, die ich nicht teile oder gar ablehne, weil ich darin quasi Denkfehler erkenne. Das passiert mir natürlich nie bei Metaphern, die ich selbst verwende.
zu jemandem sagen: "Du bist ein Esel", und wenn er kein Esel ist, versteht er mich. Ich benutze im umgangssprachlichen Sinn eine Metapher, wenn ich von einem Menschen sage, er sei ein Esel, weil der Ausdruck "Esel" Eigenschaften des jeweiligen Menschen unterstellen, die von einem anderen Referenzobjektes des Ausdruckes "übertragen" werden. Metapher steht lax gesprochen für "uneigentliche Wortverwendung". Ein Mensch ist ja - im eigentlichen Sinn des Wortes - kein Esel. Uneigentliche Wortverwendung bedeutet, dass ich ein Wort nicht so verwende, wie ich es eigentlich verwenden sollte. Wobei natürlich unausgesprochen mitschwingt, dass jemand - auch für mich weiss - wie ich das Wort eigentlich verwenden sollte.
Ich gebe ein zweites Beispiel: Ich kann zu jemandem sagen, der auf einer Bank sitzt: "Bring Dein Geld auf die Bank". Und wenn er kein Esel ist, versteht er, dass ich nicht meine, er solle sein Geld auf die Sitzbank legen, auf welcher er gerade sitzt. Bank ist in diesem Fall keine Metapher, sondern ein Homonym. Als Homonym bezeichne ich einen Ausdruck, für den in derselben (Einzel)-Sprache verschiedene Vereinbarungen oder Wortbedeutungen gelten. Der Ausdruck "Bank" steht in diesem Sinn als arbiträr oder zufällig gewählte Buchstabenkette für ein Sitzmöbel und für eine Finanzinstitution. Ich muss in jedem Fall durch den Kontext erkennen, was gerade gemeint ist.
Dass es Homonyme gibt, ist eine eigenartige Sache. Synonyme - also eine Art Inversion zum Homonym, in welcher dasselbe Referenzobjekt durch zwei verschiedene Ausdrücke bezeichnet wird - gibt es nämlich nicht. Darüber will ich hier aber nicht weiter nachdenken, hier interessiert mich die Idee der Metapher.
Als Metapher bezeichne ich ein erkenntnisleitendes Konstrukt, das auf der Grundlage von Homonymen beruht. Wenn ich Homonyme als Metaphern auffasse, postuliere ich eine Übertragung eines Ausdruckes von einem Geber- zu einem Nehmergebiet und frage, welche Eigenschaften damit übertragen werden. Homonyme bezeichne ich also genau dann als Metaphern, wenn die doppelte Verwendung des Ausdruckes etwas über eine Beziehung zwischen den Referenzobjekten des Ausdruckes aussagen soll. "Bank" könnte zufällig für "Geldinstitut" und für "Sitzgelegenheit" stehen, dann würde ich von einem Homonym sprechen. Es könnte aber auch sein, dass ich zwischen den beiden Referenzobjekten irgendeine Verwandtschaft erkenne, dann würde ich von einer Metapher sprechen, und untersuchen, worin die Verwandtschaft besteht. Es gibt auch viele Vorschläge dazu, inwiefern Finanzinstitute und Sitzbänke verwandt sind, die mir bekannten leuchten mir einfach nicht ein.
Unter dem Gesichtspunkt einer uneigentlichen Wortverwendung kann ich mich fragen, welche Wortverwendung die eigentlich und welche metaphorisch ist. Häufigkeitserwägungen helfen dabei keineswegs immer. Im städtischen Kontext etwa wird das Wort "Esel" sehr viel öfter für Menschen als für pferdeartige Tiere verwendet. Ich bezeichne - was auch nur eine Möglichkeit darstellt - diejenige Wortverwendung zu welcher ich eine Definition habe, als eigentlich. Habe ich verschiedene Definitionen, sehe ich den Ausdruck als Homonym.
Auch dazu ein Beispiel. Ein Teil des Computers wird oft als (Daten)speicher bezeichnet. Der Ausdruck Speicher wird aber auch für Kornspeicher verwendet. Wenn ich darin eine Metapher sehe, frage ich mich, was woher wohin übertragen wurde. Dass es Kornspeicher schon länger gibt als Computer, lasse ich dabei ausser Acht. Ich frage mich vielmehr, was ich als Speichern bezeichne. Englisch wird der Ausdruck Memory verwendet. "Gedächtnis" kann ichdeshalb auch als Metapher sehen. Ich kann so erkennen, dass verschiedene Differenzen ins Spiel gebracht werden (können).
Das Konstrukt der Metapher ist für mich also zunächst eine Art Denkform, die mir hilft Zusammenhänge zu sehen. Zum Problem wird diese Denkform, wenn ich sie nicht bewusst reflektiere, weil sie dann dazu führt, dass ich die implizierten Verwandtschaften als gegeben und nicht als von mir projiziert wahrnehme. Dialektisch wird die Denkform, wenn sie unbedacht auf eine andere stösst.
Als Problem erscheint mir die Metapher, wenn durch sie Zusammenhänge oder Verhältnisse postuliert werden, die ich nicht teile oder gar ablehne, weil ich darin quasi Denkfehler erkenne. Das passiert mir natürlich nie bei Metaphern, die ich selbst verwende.
[0 Kommentar]
Inhalt
Wem gehört das Geld? - Oktober 17, 2016
Prolog
 Ich habe eine 20-Franken-Banknote in der Hand und denke darüber nach mich, wem sie eigentlich gehört und woher sie kommt.
Von allen Differenzierung zwischen Besitz und Eigentum abgesehen, gehört sie mir, weil ich sie habe.
Wie ich zu genau dieser Banknote gekommen bin, weiss ich nicht, ich kann es der Banknote nicht ansehen. Vielleicht war sie ein Geschenk oder Teil einer Zahlung, die ich bekommen habe. Wahrscheinlich aber habe ich sie aus einem Bankomat. In jedem für mich denkbaren Fall gehörte die Banknote vor mir einer anderen Person. Wem gehörte sie wohl zuerst?
Ich habe eine 20-Franken-Banknote in der Hand und denke darüber nach mich, wem sie eigentlich gehört und woher sie kommt.
Von allen Differenzierung zwischen Besitz und Eigentum abgesehen, gehört sie mir, weil ich sie habe.
Wie ich zu genau dieser Banknote gekommen bin, weiss ich nicht, ich kann es der Banknote nicht ansehen. Vielleicht war sie ein Geschenk oder Teil einer Zahlung, die ich bekommen habe. Wahrscheinlich aber habe ich sie aus einem Bankomat. In jedem für mich denkbaren Fall gehörte die Banknote vor mir einer anderen Person. Wem gehörte sie wohl zuerst?
Jedes eigentliche Geld hat einen materiellen Träger, der als Atrefakt von der Zentralbank im Auftrag der Nation - früher aussschliesslich in Form von Münzen und Banknoten - hergestellt wurde. Das vermeintlich "digitale Geld" schafft mir zusätzliche Verwirrungen, auf die ich hier nicht eingehen will. Und Giralgeld betrachte ich gar nicht als Geld.
Dass ich Metall- und Papierstücke der Zentralbank überhaupt als Geld beobachte, beruht - wie erziehungsvermittelt auch immer - auf der Währung, also auf jener Verfassung der Nation, in welcher steht, dass diese Produkte der Zentralbank als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Mit Banknoten kann ich meine Schulden begleichen oder Güter kaufen, wobei die Banknoten ihren Besitzer wechseln. Da ich meine 20-Franken-Banknote geschenkt bekommen oder aus einem Bankomaten habe könnte, gibt es offenbar auch andere Formen Geld in die Hand zu bekommen.
Als Artefakt gehören die Geldstücke der Zentralbank, es ist mir beispielsweise verboten Geldmünzen, die mir gehören, einzuschmelzen, was zeitweise getan wurde, weil ihr Metallwert höher war als ihr Geldwert. Als Artefakte sind die Geldstücke eine Leihgabe, sie werden von der Nation im Prinzip gratis zur Verfügung gestellt und deren Herstellung wird mit Steuergeldern bezahlt. In diesem Sinne sind die Geldstücke wie Nationalstrassen oder militärische Sturmgewehre. Sinn der Geldstücke ist nicht, dass ich sie behalte, sondern dass ich sie vorübergehend ausgeliehen bekomme und mehr oder weniger bald danach weitergebe. Nach einer gewissen Zeit gehen sie in die Zentralbank zurück, sie werden vernichtet und durch neue Geldstücke ersetzt.
Als Geld repräsentieren die Geldstücke einen Wert, der sich darin zeigt, dass ich sie gegen wertvolle Güter eintauschen kann. Während das Artefakt im Eigentum der Zentralbank bleibt, mir also nur geliehen ist, ist der repräsentierte Wert von Banknoten, die mir gehören, mein Eigentum. Auch das ist genau in dem Sinne der Fall, als es so in der Verfassung steht.
Wie aber bekommt die Banknote ihren Wert?
Ich unterscheide zwei Fälle:
• Die Zentralbank ist eine nationale Behörde (einer entwickelten Zivilgesellschaft)
• Die Zentralbank ist eine Bank, die ein Geschäft betreibt (beispielsweise in einer kapitalistische Gesellschaft)
Welcher Fall je aktuell ist, ist in der je gültigen Währung geregelt (Siehe dazu beispielsweise die schweizerische Vollgeld-Initiative, die die entsprechende Verfassung ändern will)
Die Zentralbank ist eine Behörde
Solange die Geld-Artefakte in der Zentralbank sind, sind sie kein Geld. Die Zentralbank hat den Auftrag, Geldartefakte in einer vernünftigen Menge herauszugeben. Die vernünftige Menge ist ein politischer Entscheid, sie kann beispielsweise an Warenkorbpreis-Stabilität orientiert sein oder an einer gewünschten Inflationsrate oder an relativer Vollbeschäftigung, usw.
Die Zentralbank kann das Geld beispielsweise in die Staatskasse geben, womit sie den Bedarf des Staates an Steuereinkommen reduziert. Der Staat kann dann diese Artefakte in dem Sinne zu Geld machen, als er damit Güter bezahlt und so das Geld auch in Umlauf bringt.
In diesem Fall bekommt das Geld seinen Wert durch die damit bezahlten Güter, also durch die erste Verwendung der Artefakte als Geld. Jeder Empfänger des Geldes wird es nur gegen Güter mit demselben Wert weitergeben.
Der Staat könnte unter bestimmten Bedingungen (etwa auf Geheiss der Zentralbank (Monetative)) Geld an die Zentralbank zurückgeben, dabei würde das Geld seinen Wert wieder verlieren.
In diesem Fall gibt es keine Urschuld, die Banknote kann nicht als Schuldschein gesehen werden, weil sie kein Schuldverhältnis repräsentiert.
Die Zentralbank ist eine Bank, die ein Geschäft betreibt
Historisch beruht Geld auf monarchischen Protostaaten, in welchen Fürsten sich bei Bankiers verschuldeten, etwa die iberischen Könige bei norditalienischen Bankhäusern. Die Fürsten vergaben das Münzregal als Schuldtilgung oder als Sicherheit an die Bankiers. Es handelt sich dabei nicht um Geld, weil es nicht auf einer Währung beruht, sondern um private Schuldverhältnisse der Königshäuser.
Im Merkantilismus wurde die Finanzierung des Staatswesen von den privaten Haushalten der Fürsten getrennt und dabei immer stärker verfasst. Die Bankiers waren aber bereits mächtig genug, um Geldregale zu behalten. Das Fed beispielsweise, die grösste Zentralbank, die es gibt, gehört immer noch anonymen Bankiers. Auch die schweizerische Zentralbank ist eine private Aktiengesellschaft.
Die Zentralbank kann beispielsweise als Aktiengesellschaft betrieben werden. Dazu braucht sie ein Regal der Nation und muss dafür Konzession bezahlen, weil eine Seigniorage und andere Gewinne zu Lasten der Nation anfallen. Im aktuellen Fall der Schweiz besteht die Konzession in einer Gewinnausschüttung an den Staat.
In diesem Fall stellt die Zentralbank nicht nur Geldartefakte, sondern Geld her und ist Eigentümerin dieses selbsthergestellten Geldes, das in ihrer Buchhaltung als Passiven erscheint, wie bei anderen Unternehmen das Eigenkapital.
Die Zentralbank muss dieses Geld verleihen, damit es in Umlauf kommt. Banken, die Geld bei der Zentralbank als Kredit aufnehmen, machen also Schulden, so dass jedes Geld im Umlauf im Prinzip mit einer Ur-Schuld belastet ist. Daraus leitet die politische Okonomie den relativen Widersinn ab, das Geld Schulden sei.
Die finanzkapitalistisch entwickelte Geldpraxis ist etwas kompliziert, weil die Banknoten nur noch einen kleinen Teil des des Girovermögens in Form von sogenanntem Buchgeld ausmachen. Giralgeld ist natürlich immer eine Schuld, aber eigentlich nur eine Schuld und gar kein Geld. Und mit Banknoten hat es ohnehin fast nichts zu tun, davon abgesehen, dass ich mit Banknoten jede Schuld begleichen kann. Im Prinzip wenigstens, weil es natürlich viel zu wenig Banknoten gibt, um Giralschulden zu begleichen.
Die politische Okonomie, die Geld als Schulden begreift, verallgemeinert diesen Spezialfall der Banknotenherstellung. Meine 20-Franken-Banknote gehört dann nicht nur als Artefakt der Zentralbank, sondern auch der Wert der Note bleibt im Eigentum der Zentralbank, die mir diesen Wert lediglich als Kredit zur Verfügung stellt. Wenn ich mit einer solchen Banknote eine Ware "bezahle", mache ich den Warenverkäufer zum Schuldner der Zentralbank.
Die Finanzbuchhaltungen insgesamt kennen keine Schuld, weil jede Schuld in einer beliebigen Buchhaltung als Guthaben in einer anderen Buchhaltung erscheinen muss. Wenn ich in meiner Buchhaltung schreibe, dass ich 20 Franken Guthaben in meiner Kasse habe, dann schreibt die Zentralbank, dass sie 20 Franken Eigenkapital in meiner Kasse hat. Wenn ich die 20 Franken weitergebe, erscheinen sie in einer anderen Buchhalten als Guthaben und weiterhin bei der Zentralbank als Schulden. Und wenn die Banknote schlieslich wieder zur Zentralbank zurückgeflossen ist, vergrössert sich deren Eintrag in der Kasse zugunsten des Eintrages bei den Schuldnern (Debitoren).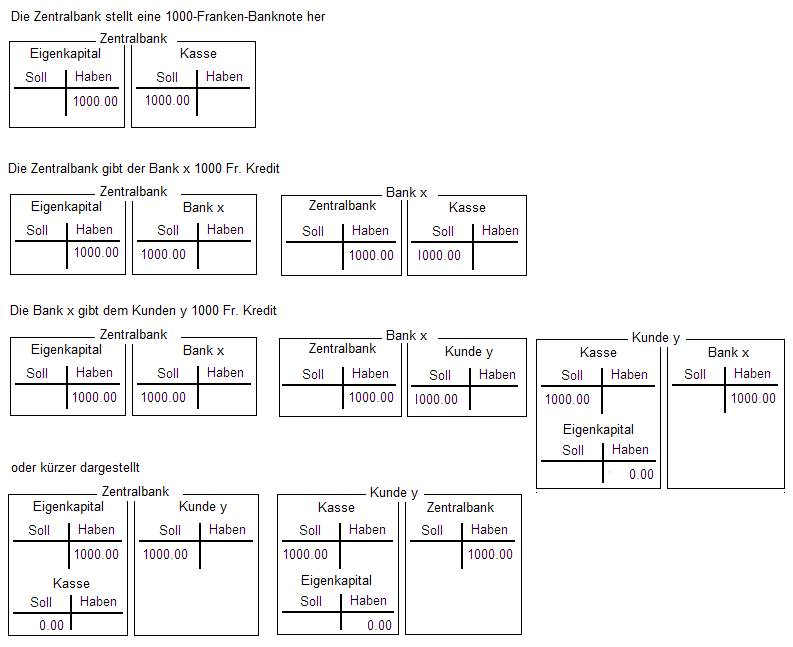 Nicht nur, was Geld ist, wird durch die Währung festgestellt, sondern auch, wem es gehört. Die Währung aber widerspiegelt einfach die Machtverhältnisse, in welchen das jeweilige Geld verwendet wird. Wenn die politische Ökonomie also behauptet, dass Geld Schulden seien, dann hat sie in Bezug auf bestimmtes Geld recht, aber natürlich nicht in Bezug auf Geld überhaupt. Geld an sich war eine sehr sinnvolle Sache, nur Geld von privaten Banken und privaten Zentralbanken verweist auf unmenschliche gesellschaftliche Verhältnisse.
Hier habe ich nur den einfachsten Fall von Geld, nämlich die Banknote behandelt. Die Banknote ist aber unabhängig davon, ob sogenanntes Bargeld verboten wird oder nicht, am Aussterben. In unserer Gesellschaft brauchen wir kein Geld mehr, weil wir auch alles mit Giralgeld finanzieren können. Und weil unser Geld ohnehin auch als Schuld gehandelt wird, spielt es innerhalb der aktuellen Verhältnisse keine Rolle, ob wir Giralgeld verwenden. Aber auch in Bezug auf Giralgeld kann ich natürlich darüber nachdenken, wem es gehört und woher es kommt. Ich kann es nur nicht in die Hände nehmen. (Fortsetzung folgt)
Nicht nur, was Geld ist, wird durch die Währung festgestellt, sondern auch, wem es gehört. Die Währung aber widerspiegelt einfach die Machtverhältnisse, in welchen das jeweilige Geld verwendet wird. Wenn die politische Ökonomie also behauptet, dass Geld Schulden seien, dann hat sie in Bezug auf bestimmtes Geld recht, aber natürlich nicht in Bezug auf Geld überhaupt. Geld an sich war eine sehr sinnvolle Sache, nur Geld von privaten Banken und privaten Zentralbanken verweist auf unmenschliche gesellschaftliche Verhältnisse.
Hier habe ich nur den einfachsten Fall von Geld, nämlich die Banknote behandelt. Die Banknote ist aber unabhängig davon, ob sogenanntes Bargeld verboten wird oder nicht, am Aussterben. In unserer Gesellschaft brauchen wir kein Geld mehr, weil wir auch alles mit Giralgeld finanzieren können. Und weil unser Geld ohnehin auch als Schuld gehandelt wird, spielt es innerhalb der aktuellen Verhältnisse keine Rolle, ob wir Giralgeld verwenden. Aber auch in Bezug auf Giralgeld kann ich natürlich darüber nachdenken, wem es gehört und woher es kommt. Ich kann es nur nicht in die Hände nehmen. (Fortsetzung folgt)
[2 Kommentar]
Inhalt
Kollaboration versus Kooperation - Kollaboration versus Kooperation
Als Kollaboration wird - auch - die kriegspolitische Haltung von sogenannten Kollaborateuren bezeichnet, also von Menschen, die freiwillig mit Besetzungsmächten "zusammenarbeiten". Diese Wortbedeutung hat sich während des sogenannten 2. Weltkrieges in den von Deutschen besetzten Ländern eingebürgert, während im englischen Sprachraum der Ausdruck Kollaboration von dieser spezifischen Konnotation freigeblieben ist und sich im Kontext von labor und work mehr in der hier erläuterten Bedeutung etabliert hat.
Ich verwende den Ausdruck Kollaboration für die im Englischen explizite Differenz, in welcher die subjektive, funktionale Seite der Arbeit als labour bezeichnet wird und die entfremdete, industrielle Seite als work. Die Labour-Party meinte mit ihrer Selbstbezeichnung ursprünglich die anarchistische Utopie, in welcher Menschen ihre Zusammenarbeit selbst bestimmen. Dabei ging es gerade darum, jene perfekt entwickelte Kooperation aufzuheben, in welcher die Beteiligten in der industriellen Arbeitsteilung aufeinander abgestimmte Teiloperationen ausführen (müssen). Kollaboration hat dann in der spezifischen Perspektive des Industrieeigentümers auch etwas mit Verrat zu tun, weil in dieser Perspektive die Labour-Party als fremde Macht und ihre Mitglieder als Kollaborateure erscheinen.
Als Kollaboration bezeichne ich mithin eine nicht fremdbestimmte und hierarchiefreie Zusammenarbeit, in welcher jeder alles tut und alle das gleiche tun. Als Kooperation bezeichne ich dagegen das koordinierte Operieren, in welchem die Beiträge der Beteiligten arbeitsteilig auf ein fremdbestimmtes Produkt ausgerichtet sind. In der Kooperation macht jeder den ihm zugewiesenen Job. In der Kollaboration ist jede angeordnete Kooperation aufgehoben.
Ich erläutere die Differenz anhand von Enzyklopädien wie dem Brockhaus und der Wikipedia. Die ersten Enzyklopädien der Neuzeit waren als geordnete Darstellungen eines für objektiv gehaltenen Wissens gedacht. Die Verleger im Umfeld von D. Diderot und J. D’Alembert realisierten Mitte des 18. Jhd., dass Enzyklopädien als Bücher Geld einbringen könnten, sie machten die Enzyklopädie zur industriellen Ware, wobei die Produktion der Bücher manufakturmässig organisiert war, während die Inhalte der Bücher noch von sogenannten Autoren hervorgebracht wurden, die noch keine Lohnarbeiter waren. Wenig später wurde auch der Brockhaus gegründet, der bis zum Erscheinen der Wikipedia als konventionelles Verlagshaus mit einer ausdifferenzierten Redaktion fungierte. Die Brockhaus-Lexika waren industrielle Produkte, die von Lohnarbeitern in arbeitsteiliger Kooperation hergestellt wurden.
Die Wikipedia wird gemeinhin als Konkurrenz von Brockhaus und Konsorten gesehen und dabei als Lexikon aufgefasst, in welchem wie in jedem Lexikon Wissen nachgeschlagen 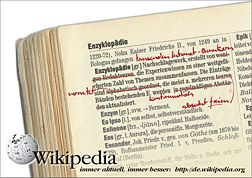 werden kann. Anfänglich versuchten die etablierten Verlage das Wissen aus der Wikipedia diskreditieren. Nachdem der Inhalt der Wikipedia rasch nicht mehr vom Inhalt vom Brockhaus unterschieden werden konnte, wurde immer klarer, was das Wissen der konventionellen Lexika war: ein Sammelsurium, dessen einzige Ordnung in der alphabetischen Anordnung der Stichworte lag. Als Lexikon ist die Wikipedia so gut oder schlecht wie jedes andere Lexikon.
Die Wikipedia kann aber auch als kollaboratives Schreibprojekt gesehen werden. Dabei geht es nicht darum, irgendwelches Wissen nachzuschlagen, sondern darum, in einem kollaborativen Schreibprozess zu erkunden, was aktuell gerade von der Schreibgemeinschaft als Wissen akzepiert wird. Jeder, der mit einem Text in der Wikipedia nicht einverstanden ist, verändert den Text, der dann wiederum allen andern als aktuelle Variante vorliegt, die weiter verbessert werden kann. In diesem Prozess wird Wissen nicht nachgeschlagen, sondern hervorgebracht. Und wer nicht total verblendet mitschreibt, weiss, um was für eine Art Wissen es sich dabei handelt. Es handelt sich um schlichten Commonsense, als welcher sich rückblickend auch Lexika wie der Brockhaus entpuppen.
Hier geht es nicht um irgendeine objektive Qualität der Wikipedia, sondern um den darin wenigstens angedachten kollaborativen Prozess, in welchem alle Beteiligten dasselbe tun. Alle schreiben die Wikipedia - im Prinzip.
Das Prinzip wird in zwei Hinsichten gebrochen. Zum einen braucht die Wikipedia natürlich wie jedes herkömmliche Lexikon Hardware, die hergestellt und verwaltet werden muss. Und wie bei D. Diderot und J. D’Alembert wird dieser Aspekt sehr industriell bewirtschaftet. Die Wikipedia ist jenseits davon, was im Lexikon steht, auch eine IT-Firma mit ausgeprägter Arbeitsteilung in Form von Lohnarbeit. Zum andern haben sich unter den Mitschreibenden durch eine Rollendifferenzierung sehr rasch Machtverhältnisse institutionalisiert, unter welchen die Kollaboration aufgehoben ist. Man kann darin eine Art ursprünglicher Akkumulation erkennen, die in Adel mündet.
Auch wenn in der Wikipedia nicht alle Beteiligten dasselbe tun (können), ist die Kollaboration doch partiell erkennbar. Die Beteiligten schreiben an demselben Hypertext. Und wenn ich in der Wikipedia schreibe, geht es mir nicht darum, ein Lexikon als eine Ware für andere herzustellen. Niemand hat mir solche Anweisung gegeben und niemand bezahlt mich dafür. Vielmehr erkenne ich darin eine Kommunikation unter den Mitschreibenden, mit welchen ich kollaborativ Formulierungen suche, die in dem Sinne gemeinsam sind, als sie für alle hinreichend viabel sind oder passen. Dieses kollaborative Schreiben ist eine Praxis, also eine Tätigkeit, die sich selbst genügt.
werden kann. Anfänglich versuchten die etablierten Verlage das Wissen aus der Wikipedia diskreditieren. Nachdem der Inhalt der Wikipedia rasch nicht mehr vom Inhalt vom Brockhaus unterschieden werden konnte, wurde immer klarer, was das Wissen der konventionellen Lexika war: ein Sammelsurium, dessen einzige Ordnung in der alphabetischen Anordnung der Stichworte lag. Als Lexikon ist die Wikipedia so gut oder schlecht wie jedes andere Lexikon.
Die Wikipedia kann aber auch als kollaboratives Schreibprojekt gesehen werden. Dabei geht es nicht darum, irgendwelches Wissen nachzuschlagen, sondern darum, in einem kollaborativen Schreibprozess zu erkunden, was aktuell gerade von der Schreibgemeinschaft als Wissen akzepiert wird. Jeder, der mit einem Text in der Wikipedia nicht einverstanden ist, verändert den Text, der dann wiederum allen andern als aktuelle Variante vorliegt, die weiter verbessert werden kann. In diesem Prozess wird Wissen nicht nachgeschlagen, sondern hervorgebracht. Und wer nicht total verblendet mitschreibt, weiss, um was für eine Art Wissen es sich dabei handelt. Es handelt sich um schlichten Commonsense, als welcher sich rückblickend auch Lexika wie der Brockhaus entpuppen.
Hier geht es nicht um irgendeine objektive Qualität der Wikipedia, sondern um den darin wenigstens angedachten kollaborativen Prozess, in welchem alle Beteiligten dasselbe tun. Alle schreiben die Wikipedia - im Prinzip.
Das Prinzip wird in zwei Hinsichten gebrochen. Zum einen braucht die Wikipedia natürlich wie jedes herkömmliche Lexikon Hardware, die hergestellt und verwaltet werden muss. Und wie bei D. Diderot und J. D’Alembert wird dieser Aspekt sehr industriell bewirtschaftet. Die Wikipedia ist jenseits davon, was im Lexikon steht, auch eine IT-Firma mit ausgeprägter Arbeitsteilung in Form von Lohnarbeit. Zum andern haben sich unter den Mitschreibenden durch eine Rollendifferenzierung sehr rasch Machtverhältnisse institutionalisiert, unter welchen die Kollaboration aufgehoben ist. Man kann darin eine Art ursprünglicher Akkumulation erkennen, die in Adel mündet.
Auch wenn in der Wikipedia nicht alle Beteiligten dasselbe tun (können), ist die Kollaboration doch partiell erkennbar. Die Beteiligten schreiben an demselben Hypertext. Und wenn ich in der Wikipedia schreibe, geht es mir nicht darum, ein Lexikon als eine Ware für andere herzustellen. Niemand hat mir solche Anweisung gegeben und niemand bezahlt mich dafür. Vielmehr erkenne ich darin eine Kommunikation unter den Mitschreibenden, mit welchen ich kollaborativ Formulierungen suche, die in dem Sinne gemeinsam sind, als sie für alle hinreichend viabel sind oder passen. Dieses kollaborative Schreiben ist eine Praxis, also eine Tätigkeit, die sich selbst genügt.
[0 Kommentar]
Inhalt
Team Teaching - September 29, 2016
Der folgenden Text beruht auf einem Gast-Vortrag an Schauspiel Akademie Zürich, den 1999 gehalten habe.
1. Die Aufgabe
Ich will hier praktizieren, was ich Ihnen vorschlage; Sie können es "Team Teaching" nennen - wenn Sie wollen. Ihr Herr Direktor, der mich freundlicherweise eingeladen hat, sagte mir zunächst, Sie hätten gerne 10 Kriterien zum TeamTeaching, die Sie bei Ihren Projekten berücksichtigen könn(t)en. Auf meine Nachfrage hin, sagte er, dass sich Ihre Diskussion häufig dahin verlaufe, dass man die Schauspielerei eigentlich nicht lehren könne, was irgendwie wahr, aber für eine Schauspiel-Akademie naheliegenderweise auch irgendwie unbefriedigend sei. So ungefähr wissen wir also, was unser Thema ist, und wir wissen relativ gut, zu welchen irgendwie unbefriedigenden Schlüssen wir nicht kommen wollen.
Ich frage mich zunächst, wie die Kompetenzen zu unserem Thema in unserem Kreise liegen. Ich frage mich, was jeder von uns hier von den andern lernen könnte? Meiner Erfahrung nach ist diese Frage konstitutiv für jedes gemeinsame Lernen. Wenn ich mit angehenden Schauspielern zusammen die Schauspielerei lernen wollte, würde ich mich nichts anderes fragen, als was ich jetzt mit Ihnen zusammen erörtern möchte.
Wenn nämlich ein junger Mensch sich in einer Schauspielakademie meldet, dann weiss er unerhört viel über die Schauspielerei, sonst käme er ja gar nicht auf die Idee, in diese Ausbildung zu kommen. Die Frage ist, was er wie weiss. Und Sie wissen über Ihre Arbeit hier natürlich auch unerhört viel. Und dafür interessiere ich mich jetzt, weil Sie mich eingeladen haben, mich mit Ihrer Aufgabe auseinanderzusetzen, respektive mich mit Ihnen über Ihre Aufgabe zusammenzusetzen.
2. Das Team
Ich schlage Ihnen also "Teamarbeit" vor. Den Ausdruck "Team" verwende ich allerdings nur, weil Herr Danzeisen das vorgeschlagen hat. Der Ausdruck Team suggeriert ein gemeinsames Ziel. Das will ich im Laufe meiner Vorstellung etwas relativieren.
Und den Ausdruck "Teaching" will ich gar nicht mehr verwenden, weil ich mit "Teaching" Erziehung und Lehren, also Ziehen und Belehren verbinde. Wo ich Be-Lehrern begegnet bin, habe ich innerlich immer den bekannte Schlager "We dont need no education, we dont need no thougth controll ...." gesungen.
Wenn ich hier und jetzt kein Teacher bin, was bin ich denn dann?
3. Vorstellung statt Teaching
Ich gebe Ihnen eine Vorstellung. Ich gebe Ihnen eine Vorstellung meiner Vorstellung. Und dabei, also in bezug auf die Vorstellung fühle ich mich hier an der Schauspielakademie natürlich in der Höhle der Löwen. Ich schlage Ihnen vor, meinen Beitrag unter den Gesichtspunkten einer Vorstellung zu betrachten. Wenn wir uns mit der Ausbildung von Schauspielern beschäftigen, scheint mir dies eine adäquate Form.
Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns über Vorstellungen unterhalten, über unsere Vorstellungen über das, was wir in unseren Vorstellungen tun. Wenn Sie meiner Einladung folgen, sitzen wir jetzt nicht mehr in einem Schulzimmer, sondern im Theater. Wir sind mitten drin in den Vorstellungen.
Ich will Ihnen etwas vormachen anstelle von etwas beibringen. Ich habe immer dort am meisten gelernt, wo ich von der Vorstellung, von der Performance beeindruckt war. Wenn jemand etwas kann, ist das für mich ansteckend, dann will ich das auch lernen.
4. Performance
Ich fasse meine jetztige Tätigkeit hier in diesem Theater als Kunst auf, das heisst praktische Erwägungen gelten mir im hegelschen Sinne aufgehoben. Als Lehrer würde ich Ihnen sagen, was Sie machen sollen und was Sie falsch machen. Ich würde Sie über Sie belehren. Als Künstler mache ich keine Mitteilungen, als Künstler suche ich den richtigen Ausdruck. Mein Werk gibt (auch mir) Auskunft über mich.
Ich gestalte mich in meinem Werk. Es wird mir Gegenstand und Widerstand, es zeigt mir, welche meiner Vorstellungen funktionieren und welche nicht. Mein Werk ist mein Spiegel. Ein Gemälde, eine Skulptur, ein Text, eine Aufführung sind physische Gegenstände, die ich mit meinen Vorstellungen vergleichn kann. Erst wenn ich produziere, kann ich meine Vorstellungen mit meinen Wahrnehmungen kritisieren.
Ich gestalte mein Werk autonom, nicht in Vor- oder Rücksicht auf Applaus oder Einschaltquoten. Wenn ich mich um Zustimmung in Form von Einschaltquoten kümmere, dann bin Verkäufer, nicht Künstler. Wenn ich mich hier um praktischen Nutzen meiner Vorstellung kümmern würde, wäre ich bestensfalls Kunsthandwerker. Dann würde ich etwas für Sie produzieren, nicht (für) mich. Kunst ist autonom. Ich mache Kunst für mich, nicht für andere. Meine Vorstellung muss mir gefallen. Natürlich nehme ich in Kauf, dass sie andern auch gefällt. Und wo ich ähnlich wie andere Menschen bin, rechne ich sogar damit, dass was für mich gut ist, andern auch gefallen kann.
Was mir gefällt, finde ich in mir. Wie aber könnte ich wissen, was Sie brauchen, was Ihnen gefällt? Wenn ich nicht mir vertraute, blieben nur Einschaltquoten.
5. Practise
Wie Sie sehen, haben wir keine Zuschauer. Wir können also frei und unbelastet üben. Frei von Vorstellungen, was die Zuschauer - und irgendwelche Lehrer und Kritiker - gerne sehen würden. In gewisser Weise haben wir aber natürlich ganz kritische Zuschauer - nämlich uns selbst. Wir erkennen leicht, ob unsere Vorstellung gut ist - gut für uns.
Ich würde beispielsweise gerne etwas vorsingen, ich merke aber, dass ich das nicht gut genug kann. Nich gut genug für meine Ansprüche. Ob es Ihnen vielleicht trotzdem gefallen würde, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir aber auch kein Kriterium, in meiner Kunst muss ich mir genügen.
Meine Frage ist also, was kann ich gut genug, um es hier aufzuführen. Wenn wir zusammenarbeiten, ohne uns zu belehren, ist das eine mögliche Frage für alle Beteiligten. Dann stellen sich sofort auch die Bedingungen des Uebens ein. Ich mache auch etwas, was ich noch nicht gut genug kann, weil ich am Lernen bin.
6. Ursprüngliche Regie
Im Schauspiel gibt es Rollen. Es gibt zwei sehr verschiedene Rollen. Es gibt die Rollen innerhalb der Aufführung, die Masken, den König, den Romeo und den Frosch. Und es gibt die Rollen ausserhalb der Aufführung, die Rollen des Schauspielers und jene des Regisseurs, der weiss, was die Schauspieler tun sollen. Was ich aus der Theatergeschichte weiss - ich weiss es ganz unabhängig davon, in welchem objektiven Sinne es wahr sein könnte - ist, dass das Schauspiel lange Zeit keine Regie kannte. Die Schauspieler überlegten jeweils, wessen Kompetenzen für das aktuelle Spiel geeignet waren, die Ueberzähligen mussten raussitzen. Die machten sich dann mit allerhand Zwischenrufen wichtig, weil sie nicht mitspielen durften. So etablierte sich die Regie. Ich verstehe Ihre Einladung in diesem Sinne der ursprünglichen Regie, als Einladung zu Zwischenrufen, weil ich von Ihrem Unterrichts-Schauspiel nicht so viel wie Sie verstehe.
Dieses Verständnis des Unterrichtens liegt immer auch ganz nahe, wo etwa im Sport ein Trainer einen Weltmeister trainiert. Wenn dort der Lehrer besser wäre als der Schüler, dann wäre der Lehrer Weltmeister, nicht der Schüler. Je mehr eine Sportart in chauvinistisch-militärischem Nationalismus eingebunden ist, verkehren sich die Rollen und die Regisseure und die Trainer gewinnen Macht. Und in der Schule im engeren Sinne sind die Rollen ganz verkehrt, dort weiss der Schüler gar nichts und der Lehrer alles.
Im Ursprung des Wortes Pädagoge steckt ein römischer Diener, der vom Vater des Schülers - in der heutigen Zeit vom Staat - bezahlt wird. Aber nicht um den Schüler zu lehren, sondern um den Schüler sicher zu den Orten zu führen, wo er etwas lernen kann.
7. Lernen im Dialog
Lernen im Dialog bedeutet, dass alle Beteiligten lernen. Die Ausdrücke Monolog und Dialog sagen im hier gemeinten Sinn nichts über die Anzahl der beteiligten Personen, sondern etwas über die Anzahl der Sichtweisen. Monolog heisst die Einheit der Sichtweisen, wie sie von Lehrern angestrebt, respektive durchgesetzt wird. Die Schüler lernen, was der Lehrer weiss, am Schluss wissen alle dasselbe, nämlich das, was der Lehrer schon wusste.
Im Dialog wird gemeinsam erforscht, was jeder weiss. Dazu stellt jeder seine Vorstellungen vor. Jeder gibt seine Performance. Dabei lernt jeder das, was ihm lernenswert erscheint. Ziel des Dialoges ist Vielfalt, nicht Einfalt.
8. Lernen als Co-Evolution
Als Co-Evolution bezeichne ich die Evolutionen von verschiedenen Systemen, die einander gegenseitig voraussetzen. Grünpflanzen etwa produzieren im Metabolismus ihrer Autopoiese (Selbstorganisation) als Abfallprodukt Sauerstoff, den die Menschen für ihre Autopoiese brauchen. Menschen produzieren umgekehrt CO2, was die Grünpflanzen brauchen. Beide tun dies jedoch nicht für die je anderen Lebewesen, sondern beide sind für die je andern unabdingbare, aber einfach - also nicht aufgrund von Intention oder Koordination - vorhandene Milieueigenschaften. Normalerweise atmen Menschen nicht, damit die Planzen Stickstoff haben, und die Pflanzen haben schon Sauerstoff produziert, lange bevor es Menschen gab. Beide Systeme kümmern sich um ihre Bedürfnisse und nehmen die strukturelle Koppelung, die Co-Evolution lediglich in Kauf.
Wenn jeder das lernt, was für ihn gut ist, dann ist das in bestimmten Umgebungen auch für alle andern gut. Wenn ich hier eine Vorstellung gebe, die mir gefällt, dann kann die Vorstellung auch Ihnen gefallen.
9. Reflektion: Konstruktivismus und Systemtheorie
Ich will noch einige Anmerkungen zum theoretischen Hintergrund meiner Vorstellung machen. Wir können, wenn Sie wollen, in der Diskussion mehr darauf eingehen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach etwas mehr darüber lesen.
Der Volksmund macht sich über den Nürnberger Trichter lustig, also über die Idee, dass man den Schülern das Wissen eintrichtern könne. Vielen Pädagogen ist klar, dass die Schüler selbst lernen müssen. Die Frage, die ich mir als Pädagoge stelle, lautet deshalb, was kann ich Sinnvolles beitragen, wenn die Schüler doch alles selbst tun müssen?
Es gibt in dieser Diskussion über Lernen seit einiger Zeit systemtheoretische Ansätze unter Namen wie Radikaler Konstruktivismus, Systemtheorie 2. Ordnung oder Neue Lernkultur. Diese Ansätze gehen alle davon aus, dass jeder Mensch seine Welt selbst konstruiert. Es gibt keine Realität, die man erkennen kann oder muss. Es gibt nur die Welt, die man selbst hervorbringt. Es gibt dazu eine breite erkenntnistheoretische Diskussion. Ich verstehe diese Ansätze aber viel mehr pragmatisch. Meine Frage ist, woher kann ich wissen, was andere Menschen wissen müssten. Als Pädagoge kann ich Sie fragen, was Sie gerne wissen wollen.
Diese Ansätze haben einen ethischen Aspekt. Wenn ich meine Welt selbst hervorbringe, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich nur erzähle, wie die Welt wirklich ist, dann kann ich nichts dafür. Und natürlich ist hier mit Welt insbesondere unsere Unterrichtssituation gemeint. Wenn ich den Schülern etwas beibringen würde, dann müsste ich das verantworten. Was die Schüler selbst lernen, liegt in deren Veranwortung.
Diese Ansätze sind alle sehr subjektorientiert. Ich lade Sie ein, einmal zu versuchen, etwas für sich, anstatt etwas für die Schüler zu tun.
10. Rekursion: Alles nochmals
Wenn Sie am Anfang meines Vortrages gewusst hätten, was Sie jetzt (über diesen Vortrag) wissen, dann hätten Sie einen völlig anderen Vortrag gehört. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich erzähle Ihnen deshalb den ganzen Vortrag nochmals. Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass ich wieder zu diesem Schluss gelange.
Ich stelle mir vor, dass Ihnen beim 2. Hören einige Punkte praktischer erscheinen. Schliesslich wollten Sie so etwas wie 10 Anweisungen.
Der 1. Punkt ist, dass wir klären, was wir nicht wollen. In unserem Falle war das, dass wir nicht finden wollen, dass man gar nicht lehren kann.
Der 2. Punkt ist, dass wir klären, was wir tun können, wenn wir nicht belehren wollen. Wir erforschen die Kompetenzen im Team. Wir machen eine Liste, wo jeder reinschreibt, was er gut kann.
Der 3. Punkt ist das Selbstverständnis, das wir einnehmen, wenn wir tun, was wir tun. Ich kann zu Ihnen als Lehrer sprechen und Ihnen mitteilen, was Sie tun sollen. Ich kann aber auch fast dasselbe tun und sagen und das als ansteckende Aufführung auffassen. Wir kritisieren uns unter ästhetischen Gesichtspunkten: Ich sage nicht, dass etwas nicht richtig ist, sondern warum mir die Vorstellung gefällt.
Der 4. Punkt ist das Referenzsystem: mache ich etwas für andere, bin ich fremdbestimmt. Mache ich etwas für mich, bin ich autonom. Kunst ist autonom, wenn ich als Pädagoge auftrete, dann im Sinne einer Performance.
Der 5. Punkt ist das Ueben. Es geht darum, dass ich im geschützten Raum der Akademie das Vorzeigen üben kann. Beim Ueben übe ich auch die Selbstbeurteilung.
Der 6. Punkt ist Regie. Als Pädagoge sehe ich mich als derjenige, der draussen sitzt und Zwischenrufe macht. Ich übernehme damit eine reflektierende Aussensicht. Im besten Falle mache ich vor, wie das aussieht, was auf der Bühne gemacht wird. Natürlich spielen alle Rollenträger auch diese Rolle.
Der 7. Punkt ist der Dialog. Es gibt keine richtige Lösung, die für alle gut wäre. Jeder trägt seine Sicht bei, alle wählen unter den beigetragenen Sichten das aus, was zu ihnen passt. Die Lehre besteht darin, möglichst viele Möglichkeiten, wie man etwas tun kann, aufzulisten.
Der 8. Punkt ist die Einsicht und das Vertrauen auf die Co-Evolution. Wenn jeder das tut, was für ihn gut ist, trägt er am meisten zum Gesamtnutzen bei. Jeder Unterricht wird langweilig, wenn man etwas für andere, insbesondere für den Lehrer tun muss.
Der 9. Punkt ist die Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Welt ist nicht vorgegeben. Jeder ist verantwortlich für das, was er wahrnimmt.
Der 10. Punkt ist die Rekursion. Do it again. Wir wiederholen die Aufführung, solange sie uns unterhält, solange wir in ihr etwas Neues finden können.
Literatur
Ich nenne hier einige Texte, in welchen Sie etwas mehr über die Grundlagen meiner Vorstellungen nachlesen können.
•Maturana, Humberto R. u. Francisco J. Varela (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern (Scherz).
•Todesco, Rolf (1999): Hyperkommunikation: SchriftUmSteller statt Schriftsteller. In: Beat Suter u. Michael Böhler (Hrsg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Basel/Frankfurt (Stroemfeld).
•von Foerster, Heinz: (1993): Wissen und Gewissen. Frankfurt (Suhrkamp, stw).
•von Glasersfeld, Ernst (1996): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt (Suhrkamp)
Ihr Herr Direktor, der mich freundlicherweise eingeladen hat, sagte mir zunächst, Sie hätten gerne 10 Kriterien zum TeamTeaching, die Sie bei Ihren Projekten berücksichtigen könn(t)en. Auf meine Nachfrage hin, sagte er, dass sich Ihre Diskussion häufig dahin verlaufe, dass man die Schauspielerei eigentlich nicht lehren könne, was irgendwie wahr, aber für eine Schauspiel-Akademie naheliegenderweise auch irgendwie unbefriedigend sei. So ungefähr wissen wir also, was unser Thema ist, und wir wissen relativ gut, zu welchen irgendwie unbefriedigenden Schlüssen wir nicht kommen wollen.
Ich frage mich zunächst, wie die Kompetenzen zu unserem Thema in unserem Kreise liegen. Ich frage mich, was jeder von uns hier von den andern lernen könnte? Meiner Erfahrung nach ist diese Frage konstitutiv für jedes gemeinsame Lernen. Wenn ich mit angehenden Schauspielern zusammen die Schauspielerei lernen wollte, würde ich mich nichts anderes fragen, als was ich jetzt mit Ihnen zusammen erörtern möchte.
Wenn nämlich ein junger Mensch sich in einer Schauspielakademie meldet, dann weiss er unerhört viel über die Schauspielerei, sonst käme er ja gar nicht auf die Idee, in diese Ausbildung zu kommen. Die Frage ist, was er wie weiss. Und Sie wissen über Ihre Arbeit hier natürlich auch unerhört viel. Und dafür interessiere ich mich jetzt, weil Sie mich eingeladen haben, mich mit Ihrer Aufgabe auseinanderzusetzen, respektive mich mit Ihnen über Ihre Aufgabe zusammenzusetzen.
2. Das Team
Ich schlage Ihnen also "Teamarbeit" vor. Den Ausdruck "Team" verwende ich allerdings nur, weil Herr Danzeisen das vorgeschlagen hat. Der Ausdruck Team suggeriert ein gemeinsames Ziel. Das will ich im Laufe meiner Vorstellung etwas relativieren.
Und den Ausdruck "Teaching" will ich gar nicht mehr verwenden, weil ich mit "Teaching" Erziehung und Lehren, also Ziehen und Belehren verbinde. Wo ich Be-Lehrern begegnet bin, habe ich innerlich immer den bekannte Schlager "We dont need no education, we dont need no thougth controll ...." gesungen.
Wenn ich hier und jetzt kein Teacher bin, was bin ich denn dann?
3. Vorstellung statt Teaching
Ich gebe Ihnen eine Vorstellung. Ich gebe Ihnen eine Vorstellung meiner Vorstellung. Und dabei, also in bezug auf die Vorstellung fühle ich mich hier an der Schauspielakademie natürlich in der Höhle der Löwen. Ich schlage Ihnen vor, meinen Beitrag unter den Gesichtspunkten einer Vorstellung zu betrachten. Wenn wir uns mit der Ausbildung von Schauspielern beschäftigen, scheint mir dies eine adäquate Form.
Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns über Vorstellungen unterhalten, über unsere Vorstellungen über das, was wir in unseren Vorstellungen tun. Wenn Sie meiner Einladung folgen, sitzen wir jetzt nicht mehr in einem Schulzimmer, sondern im Theater. Wir sind mitten drin in den Vorstellungen.
Ich will Ihnen etwas vormachen anstelle von etwas beibringen. Ich habe immer dort am meisten gelernt, wo ich von der Vorstellung, von der Performance beeindruckt war. Wenn jemand etwas kann, ist das für mich ansteckend, dann will ich das auch lernen.
4. Performance
Ich fasse meine jetztige Tätigkeit hier in diesem Theater als Kunst auf, das heisst praktische Erwägungen gelten mir im hegelschen Sinne aufgehoben. Als Lehrer würde ich Ihnen sagen, was Sie machen sollen und was Sie falsch machen. Ich würde Sie über Sie belehren. Als Künstler mache ich keine Mitteilungen, als Künstler suche ich den richtigen Ausdruck. Mein Werk gibt (auch mir) Auskunft über mich.
Ich gestalte mich in meinem Werk. Es wird mir Gegenstand und Widerstand, es zeigt mir, welche meiner Vorstellungen funktionieren und welche nicht. Mein Werk ist mein Spiegel. Ein Gemälde, eine Skulptur, ein Text, eine Aufführung sind physische Gegenstände, die ich mit meinen Vorstellungen vergleichn kann. Erst wenn ich produziere, kann ich meine Vorstellungen mit meinen Wahrnehmungen kritisieren.
Ich gestalte mein Werk autonom, nicht in Vor- oder Rücksicht auf Applaus oder Einschaltquoten. Wenn ich mich um Zustimmung in Form von Einschaltquoten kümmere, dann bin Verkäufer, nicht Künstler. Wenn ich mich hier um praktischen Nutzen meiner Vorstellung kümmern würde, wäre ich bestensfalls Kunsthandwerker. Dann würde ich etwas für Sie produzieren, nicht (für) mich. Kunst ist autonom. Ich mache Kunst für mich, nicht für andere. Meine Vorstellung muss mir gefallen. Natürlich nehme ich in Kauf, dass sie andern auch gefällt. Und wo ich ähnlich wie andere Menschen bin, rechne ich sogar damit, dass was für mich gut ist, andern auch gefallen kann.
Was mir gefällt, finde ich in mir. Wie aber könnte ich wissen, was Sie brauchen, was Ihnen gefällt? Wenn ich nicht mir vertraute, blieben nur Einschaltquoten.
5. Practise
Wie Sie sehen, haben wir keine Zuschauer. Wir können also frei und unbelastet üben. Frei von Vorstellungen, was die Zuschauer - und irgendwelche Lehrer und Kritiker - gerne sehen würden. In gewisser Weise haben wir aber natürlich ganz kritische Zuschauer - nämlich uns selbst. Wir erkennen leicht, ob unsere Vorstellung gut ist - gut für uns.
Ich würde beispielsweise gerne etwas vorsingen, ich merke aber, dass ich das nicht gut genug kann. Nich gut genug für meine Ansprüche. Ob es Ihnen vielleicht trotzdem gefallen würde, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir aber auch kein Kriterium, in meiner Kunst muss ich mir genügen.
Meine Frage ist also, was kann ich gut genug, um es hier aufzuführen. Wenn wir zusammenarbeiten, ohne uns zu belehren, ist das eine mögliche Frage für alle Beteiligten. Dann stellen sich sofort auch die Bedingungen des Uebens ein. Ich mache auch etwas, was ich noch nicht gut genug kann, weil ich am Lernen bin.
6. Ursprüngliche Regie
Im Schauspiel gibt es Rollen. Es gibt zwei sehr verschiedene Rollen. Es gibt die Rollen innerhalb der Aufführung, die Masken, den König, den Romeo und den Frosch. Und es gibt die Rollen ausserhalb der Aufführung, die Rollen des Schauspielers und jene des Regisseurs, der weiss, was die Schauspieler tun sollen. Was ich aus der Theatergeschichte weiss - ich weiss es ganz unabhängig davon, in welchem objektiven Sinne es wahr sein könnte - ist, dass das Schauspiel lange Zeit keine Regie kannte. Die Schauspieler überlegten jeweils, wessen Kompetenzen für das aktuelle Spiel geeignet waren, die Ueberzähligen mussten raussitzen. Die machten sich dann mit allerhand Zwischenrufen wichtig, weil sie nicht mitspielen durften. So etablierte sich die Regie. Ich verstehe Ihre Einladung in diesem Sinne der ursprünglichen Regie, als Einladung zu Zwischenrufen, weil ich von Ihrem Unterrichts-Schauspiel nicht so viel wie Sie verstehe.
Dieses Verständnis des Unterrichtens liegt immer auch ganz nahe, wo etwa im Sport ein Trainer einen Weltmeister trainiert. Wenn dort der Lehrer besser wäre als der Schüler, dann wäre der Lehrer Weltmeister, nicht der Schüler. Je mehr eine Sportart in chauvinistisch-militärischem Nationalismus eingebunden ist, verkehren sich die Rollen und die Regisseure und die Trainer gewinnen Macht. Und in der Schule im engeren Sinne sind die Rollen ganz verkehrt, dort weiss der Schüler gar nichts und der Lehrer alles.
Im Ursprung des Wortes Pädagoge steckt ein römischer Diener, der vom Vater des Schülers - in der heutigen Zeit vom Staat - bezahlt wird. Aber nicht um den Schüler zu lehren, sondern um den Schüler sicher zu den Orten zu führen, wo er etwas lernen kann.
7. Lernen im Dialog
Lernen im Dialog bedeutet, dass alle Beteiligten lernen. Die Ausdrücke Monolog und Dialog sagen im hier gemeinten Sinn nichts über die Anzahl der beteiligten Personen, sondern etwas über die Anzahl der Sichtweisen. Monolog heisst die Einheit der Sichtweisen, wie sie von Lehrern angestrebt, respektive durchgesetzt wird. Die Schüler lernen, was der Lehrer weiss, am Schluss wissen alle dasselbe, nämlich das, was der Lehrer schon wusste.
Im Dialog wird gemeinsam erforscht, was jeder weiss. Dazu stellt jeder seine Vorstellungen vor. Jeder gibt seine Performance. Dabei lernt jeder das, was ihm lernenswert erscheint. Ziel des Dialoges ist Vielfalt, nicht Einfalt.
8. Lernen als Co-Evolution
Als Co-Evolution bezeichne ich die Evolutionen von verschiedenen Systemen, die einander gegenseitig voraussetzen. Grünpflanzen etwa produzieren im Metabolismus ihrer Autopoiese (Selbstorganisation) als Abfallprodukt Sauerstoff, den die Menschen für ihre Autopoiese brauchen. Menschen produzieren umgekehrt CO2, was die Grünpflanzen brauchen. Beide tun dies jedoch nicht für die je anderen Lebewesen, sondern beide sind für die je andern unabdingbare, aber einfach - also nicht aufgrund von Intention oder Koordination - vorhandene Milieueigenschaften. Normalerweise atmen Menschen nicht, damit die Planzen Stickstoff haben, und die Pflanzen haben schon Sauerstoff produziert, lange bevor es Menschen gab. Beide Systeme kümmern sich um ihre Bedürfnisse und nehmen die strukturelle Koppelung, die Co-Evolution lediglich in Kauf.
Wenn jeder das lernt, was für ihn gut ist, dann ist das in bestimmten Umgebungen auch für alle andern gut. Wenn ich hier eine Vorstellung gebe, die mir gefällt, dann kann die Vorstellung auch Ihnen gefallen.
9. Reflektion: Konstruktivismus und Systemtheorie
Ich will noch einige Anmerkungen zum theoretischen Hintergrund meiner Vorstellung machen. Wir können, wenn Sie wollen, in der Diskussion mehr darauf eingehen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach etwas mehr darüber lesen.
Der Volksmund macht sich über den Nürnberger Trichter lustig, also über die Idee, dass man den Schülern das Wissen eintrichtern könne. Vielen Pädagogen ist klar, dass die Schüler selbst lernen müssen. Die Frage, die ich mir als Pädagoge stelle, lautet deshalb, was kann ich Sinnvolles beitragen, wenn die Schüler doch alles selbst tun müssen?
Es gibt in dieser Diskussion über Lernen seit einiger Zeit systemtheoretische Ansätze unter Namen wie Radikaler Konstruktivismus, Systemtheorie 2. Ordnung oder Neue Lernkultur. Diese Ansätze gehen alle davon aus, dass jeder Mensch seine Welt selbst konstruiert. Es gibt keine Realität, die man erkennen kann oder muss. Es gibt nur die Welt, die man selbst hervorbringt. Es gibt dazu eine breite erkenntnistheoretische Diskussion. Ich verstehe diese Ansätze aber viel mehr pragmatisch. Meine Frage ist, woher kann ich wissen, was andere Menschen wissen müssten. Als Pädagoge kann ich Sie fragen, was Sie gerne wissen wollen.
Diese Ansätze haben einen ethischen Aspekt. Wenn ich meine Welt selbst hervorbringe, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich nur erzähle, wie die Welt wirklich ist, dann kann ich nichts dafür. Und natürlich ist hier mit Welt insbesondere unsere Unterrichtssituation gemeint. Wenn ich den Schülern etwas beibringen würde, dann müsste ich das verantworten. Was die Schüler selbst lernen, liegt in deren Veranwortung.
Diese Ansätze sind alle sehr subjektorientiert. Ich lade Sie ein, einmal zu versuchen, etwas für sich, anstatt etwas für die Schüler zu tun.
10. Rekursion: Alles nochmals
Wenn Sie am Anfang meines Vortrages gewusst hätten, was Sie jetzt (über diesen Vortrag) wissen, dann hätten Sie einen völlig anderen Vortrag gehört. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich erzähle Ihnen deshalb den ganzen Vortrag nochmals. Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass ich wieder zu diesem Schluss gelange.
Ich stelle mir vor, dass Ihnen beim 2. Hören einige Punkte praktischer erscheinen. Schliesslich wollten Sie so etwas wie 10 Anweisungen.
Der 1. Punkt ist, dass wir klären, was wir nicht wollen. In unserem Falle war das, dass wir nicht finden wollen, dass man gar nicht lehren kann.
Der 2. Punkt ist, dass wir klären, was wir tun können, wenn wir nicht belehren wollen. Wir erforschen die Kompetenzen im Team. Wir machen eine Liste, wo jeder reinschreibt, was er gut kann.
Der 3. Punkt ist das Selbstverständnis, das wir einnehmen, wenn wir tun, was wir tun. Ich kann zu Ihnen als Lehrer sprechen und Ihnen mitteilen, was Sie tun sollen. Ich kann aber auch fast dasselbe tun und sagen und das als ansteckende Aufführung auffassen. Wir kritisieren uns unter ästhetischen Gesichtspunkten: Ich sage nicht, dass etwas nicht richtig ist, sondern warum mir die Vorstellung gefällt.
Der 4. Punkt ist das Referenzsystem: mache ich etwas für andere, bin ich fremdbestimmt. Mache ich etwas für mich, bin ich autonom. Kunst ist autonom, wenn ich als Pädagoge auftrete, dann im Sinne einer Performance.
Der 5. Punkt ist das Ueben. Es geht darum, dass ich im geschützten Raum der Akademie das Vorzeigen üben kann. Beim Ueben übe ich auch die Selbstbeurteilung.
Der 6. Punkt ist Regie. Als Pädagoge sehe ich mich als derjenige, der draussen sitzt und Zwischenrufe macht. Ich übernehme damit eine reflektierende Aussensicht. Im besten Falle mache ich vor, wie das aussieht, was auf der Bühne gemacht wird. Natürlich spielen alle Rollenträger auch diese Rolle.
Der 7. Punkt ist der Dialog. Es gibt keine richtige Lösung, die für alle gut wäre. Jeder trägt seine Sicht bei, alle wählen unter den beigetragenen Sichten das aus, was zu ihnen passt. Die Lehre besteht darin, möglichst viele Möglichkeiten, wie man etwas tun kann, aufzulisten.
Der 8. Punkt ist die Einsicht und das Vertrauen auf die Co-Evolution. Wenn jeder das tut, was für ihn gut ist, trägt er am meisten zum Gesamtnutzen bei. Jeder Unterricht wird langweilig, wenn man etwas für andere, insbesondere für den Lehrer tun muss.
Der 9. Punkt ist die Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Welt ist nicht vorgegeben. Jeder ist verantwortlich für das, was er wahrnimmt.
Der 10. Punkt ist die Rekursion. Do it again. Wir wiederholen die Aufführung, solange sie uns unterhält, solange wir in ihr etwas Neues finden können.
Literatur
Ich nenne hier einige Texte, in welchen Sie etwas mehr über die Grundlagen meiner Vorstellungen nachlesen können.
•Maturana, Humberto R. u. Francisco J. Varela (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern (Scherz).
•Todesco, Rolf (1999): Hyperkommunikation: SchriftUmSteller statt Schriftsteller. In: Beat Suter u. Michael Böhler (Hrsg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Basel/Frankfurt (Stroemfeld).
•von Foerster, Heinz: (1993): Wissen und Gewissen. Frankfurt (Suhrkamp, stw).
•von Glasersfeld, Ernst (1996): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt (Suhrkamp)
[0 Kommentar]
Inhalt
(miss)Kredit - September 24, 2016
Jedes Missverständnis, dass ich in Bezug auf Kredit finden kann, wurzelt darin, dass Kredit als Geld gesehen wird und vice versa, dass Geld als Kredit gesehen wird. Geld hat seine Funktion im Tausch, noch vor dem Warentausch. Geld ist materiell. Kredit ist etwas ganz anderes. Es ist aber üblich geworden, Kredit in GeldFORM auszudrücken. Nur deswegen sollte man Geld und Kredit weder verwechseln noch vermengen - es sei denn, man erreiche dadurch eine Begründung, die einem wohlfeil ist. Um eine Analogie zu geben (oder zwei): C. Shannon hat in die Kommunikationstheorie einen InformationsGEHALT einführt. Viele Menschen sprechen dagegen von Information, eben wie bei Krediten von Geld statt von GeldFORM sprechen. Ebenso bei der sogenannten Energie. Wir verbrauchen materielle EnergieTRÄGER, viele Menschen sprechen von einem EnergieVERBRAUCH.
Ich verwende den Ausdruck Kredit für ein Darlehen,  wenn ich das Darlehen im Kontext des Warentausches wahrnehme. Wenn ich Waren kaufe, vollziehe ich einen Tausch gegen Geld. Solange ich das Geld noch nicht bezahlt habe, bezeichne ich es als Kredit, das heisst der Verkäufer ist mein Kreditor
, der - dem Wortsinn Gläubiger gemäss - glaubt, dass ich bezahlen werde. In diesem Sinn ist der Kredit eine Nichtbar-Bezahlung, was ich invers als Darlehen meines Kreditors auffassen kann.
Eine spezielle Variante des Kredits involviert eine Bank. Sie bezahlt dem Verkäufer an meiner Stelle, wodurch sie mein Kreditor wird. Ich kann in diesem Sinne Waren auf Kredit kaufen oder Kredit im Sinne eines Darlehens aufnehmen, um Waren zu kaufen.
In meiner Buchhaltungssprache unterscheide ich die beiden Fälle, indem ich im ersten Fall von einem Kreditor spreche und die Warenlieferung in Form einer offenen Rechnung in die Buchhaltung eintrage, womit ich auf einen zeitversetzten Tausch verweise. Die Bank dagegen, von welcher ich einen Kredit erhalte, bezeichne ich in der Buchhaltung nicht als Kreditor und umgekehrt sieht mich die Bank auch nicht als Kreditor, wenn ich mein Geld auf ein Sparkonto lege, weil wir dabei nicht ans Tauschen denken.
wenn ich das Darlehen im Kontext des Warentausches wahrnehme. Wenn ich Waren kaufe, vollziehe ich einen Tausch gegen Geld. Solange ich das Geld noch nicht bezahlt habe, bezeichne ich es als Kredit, das heisst der Verkäufer ist mein Kreditor
, der - dem Wortsinn Gläubiger gemäss - glaubt, dass ich bezahlen werde. In diesem Sinn ist der Kredit eine Nichtbar-Bezahlung, was ich invers als Darlehen meines Kreditors auffassen kann.
Eine spezielle Variante des Kredits involviert eine Bank. Sie bezahlt dem Verkäufer an meiner Stelle, wodurch sie mein Kreditor wird. Ich kann in diesem Sinne Waren auf Kredit kaufen oder Kredit im Sinne eines Darlehens aufnehmen, um Waren zu kaufen.
In meiner Buchhaltungssprache unterscheide ich die beiden Fälle, indem ich im ersten Fall von einem Kreditor spreche und die Warenlieferung in Form einer offenen Rechnung in die Buchhaltung eintrage, womit ich auf einen zeitversetzten Tausch verweise. Die Bank dagegen, von welcher ich einen Kredit erhalte, bezeichne ich in der Buchhaltung nicht als Kreditor und umgekehrt sieht mich die Bank auch nicht als Kreditor, wenn ich mein Geld auf ein Sparkonto lege, weil wir dabei nicht ans Tauschen denken.
[0 Kommentar]
Inhalt
Lügen alle Kreter? - September 18, 2016
 Ich befasse mich gerade wieder mal mit Paradoxien und lese dabei auch, was ich früher dazu geschrieben habe:
Lügen alle Kreter?
Im Alten Testament findet sich eine noch verallgemeinerte Form (Psalm 116,11) "Ich sprach in meiner Bestürzung: Alle Menschen sind Lügner!"
Die Grundlage für das scheinbare Paradoxon steht im Neuen Testament, Titus 1,12:
- Dementsprechend wurde die Aussage auch gegen die Kreter verwendet. In der Bibel schreibt Paulus von Tarsus im Brief des Paulus an Titus 1,12: "Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet: 'Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche'. Dies Zeugnis ist wahr.''
Hier wird das Zitat, welches von Clemens von Alexandria (150-215 n.Chr) dem Kreter Epimenides (6./7.Jh. v.Chr.) zugeschrieben wurde, erstmals in den Zusammenhang gestellt, dass das Zitat selbst von einem Kreter stammt.
Ich befasse mich gerade wieder mal mit Paradoxien und lese dabei auch, was ich früher dazu geschrieben habe:
Lügen alle Kreter?
Im Alten Testament findet sich eine noch verallgemeinerte Form (Psalm 116,11) "Ich sprach in meiner Bestürzung: Alle Menschen sind Lügner!"
Die Grundlage für das scheinbare Paradoxon steht im Neuen Testament, Titus 1,12:
- Dementsprechend wurde die Aussage auch gegen die Kreter verwendet. In der Bibel schreibt Paulus von Tarsus im Brief des Paulus an Titus 1,12: "Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet: 'Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche'. Dies Zeugnis ist wahr.''
Hier wird das Zitat, welches von Clemens von Alexandria (150-215 n.Chr) dem Kreter Epimenides (6./7.Jh. v.Chr.) zugeschrieben wurde, erstmals in den Zusammenhang gestellt, dass das Zitat selbst von einem Kreter stammt.
[0 Kommentar]
Inhalt
Materialismus - September 14, 2016
Ich verwende den Ausdruck Materialismus für eine spezifische erkenntnistheoretische Position, die ich im Folgenden erläutere. Der Ausdruck wird aber quasi homonym auch für andere sehr verschiedene Auffassungen verwendet: umgangssprachlicher Materialismus, wissenschaftstheoretischer (philosophischer) Materialismus, dialektischer Materialismus, historischer Materialismus.
Im Ausdruck "Materialismus" steckt das Wort Material, was ein ganz anderes Wort ist als Materie. In vielen Verwendungen müsste anstelle von "Materialismus" quasietymologisch von "Materie-ismus" gesprochen werden.
Zur gängigen Wort-Geschichte und dem Unterschied zwischen Materie und Material:
Als "Materialismus" gilt - seit G.Leibniz anfangs des 18. Jh. Materialisten und Idealisten unterschieden hat - gemeinhin eine erkenntnistheoretische Position, in welcher physikalischen Prozessen ein ontologisches Sein zugesprochen wird, dem jedes Erkennen Rechnung tragen müsse. Materialismus war in der Aufklärung zunächst als Kampfbegriff vor allem gegen religiöse Anschauungen gedacht, quasi Naturgesetze anstelle des Willen Gottes.
Die Philosophen haben dann auf dem Höhepunkt der Aufklärung unter dem Einfluss von I. Kant, der Ontologie eine Epistemologie entgegengesetzt, in welcher dem Geistigideellen in Form von a priori Kategorien das erkenntnisleitende Primat zugesprochen wird. G. Hegel hat schliesslich auf dem Höhepunkt dieses Idealimus die beiden Positionen in seiner logischen Dialektik aufgehoben, aber nicht - wie später K. Marx - wirkliche aufheben können.
Jenseits der Philosophie - auch wenn lange nicht ausdifferenziert - entwickelte sich eine Naturwissenschaft, die im 19. Jh. praktisch und erfolgreich wurde. Als Materialismus wurde ab 1850 zunehmend auch eine Position bezeichnet, in welcher nur naturwissenschaftliche Erklärungen zugelassen wurden. Im sogenannten Reduktionismus wird alles auf physikalische Prozesse zurückgeführt, im konventionellen Materialismus wird der Spiritualität eine gewisse Eigenständigkeit zugestanden. Auf dem Höhepunkt des naturwissenschaftlichen Materialismus, wie er etwa von L. Feuerbach vertreten wurde, kritisierte K. Marx die Ausblendung der gesellschaftlichen Verhältnisse, der er seine Geschichtauffassung entgegensetzte, die F. Engels dann viel später als Historischen Materialismus bezeichnet hat. Als materialistisch bezeichnete K. Marx eine Geschichtsauffassung, in deren Zentrum die Entwicklung der Produktionsverhältnisse steht, die - in relativierter Anlehnung an C. Darwin - als evolutionäre Entwicklungen begründet werden. Materiell bezeichnet dabei aber kein naturwissenschaftliches Verständnis und schon gar keine Reduktion auf Physik, sondern die tätige Aneignung als Gegenstand der Beobachtung. Historisch bezeichnet dabei, dass die materielle Produktion der Lebensmittel - wie die Naturgeschichte des Menschen - als Evolutionsgeschichte begriffen und dargestellt wird. Dieser Materialismus bezieht sich nicht auf eine naturwissenschaftlich gemeinte, ontologische Materie, sondern auf die materiellen Voraussetzungen jeder herstellenden Tätigkeit, die gemeinhin als Material bezeichnet werden. Dieses Material kann zwar naturwissenschaftlich beobachtet werden, als Gegenstand aber ist in der herstellenden Tätigkeit begründet.
Materialismus im engeren Wortsinn
Als Materialismus bezeichne ich meine Auffassung, in welcher ich als toolmaking animal die herstellende Tätigkeit als Aneignung reflektiere und dabei primär zwei Unterscheidungen verwende: Form und Material. Wenn ich ein Artefakt herstelle, forme ich Material.
• Als Form bezeichne ich in einem operativen Sinn, genau das, was ich zeichnen kann. Jede Zeichnung repräsentiert die Form.
• Als Material bezeichne ich das, was ich forme, wenn ich beispielsweise ein Schwert oder eine Sichel schmiede. Das, was ich forme, bestimme ich durch herstellungsrelevante Eigenschaften. Materialien wie Bronze und Silber, oder allgemeiner wie Metalle sind in diesem Sinne Verdinglichungen dieser Eigenschaften, die ich - quasi-ontologisch formuliert - am Material wahrnehme. “Metall” bedeutet in diesem Sinne “glänzend, stromleitend, schwer, …” und “Silber” bedeutet “Metall, helle Farbe, nicht oxidierend, …”.
Als Materialismus bezeichne ich in diesem Sinne das Resultat einer vortheoretischen Entscheidung, die in entsprechenden Theorien als vorausgesetzte Setzung erkennbar wird. Die verwendeten Unterscheidungen sind nicht von einer wirklichen Beschaffenheit einer gegeben Welt abhängig, sondern davon, wie ich ich mir die tätige Aneignung der Welt durch eine doppelte Differenz vorstelle.
Ich kann um im Beispiel zu bleiben, eine Sichel sehr verschieden formen, aber ich kann sie nicht formlos machen. Für eine Sichel kann ich sehr verschiedene Materialien verwenden, aber ich kann sie nicht ohne Material herstellen.
Die Einheit der operationellen Differenz zwischen Form und Material ist die Herstellung.
Materialien entstehen in doppelter Hinsicht mit ihren Formungen. Als Material bezeichne ich sekundär alles, was eine (tautologischerweise zeichenbare) Form hat und logisch primär das, was sich durch die herstellende Formgebung konstituiert. Das Referenzobjekt des Ausdruckes Bronze beispielsweise kann als Barren, Klumpen, Ohrring oder Statue, aber nicht ohne Form existieren. Jede Herstellung ist deshalb eine Umformung.
Wenn ich vom Material spreche, abstrahiere ich von dessen Form. Wenn ich dieses Material in einer physikalischen Perspektive beobachte, bezeichne ich es als Materie. Materie aber ist ein sich in Quanten auflösendes Konstrukt der Physik, also gerade kein Material (Zu dieser Konstitution siehe auch Luhmann über Medium in Die Kunst der Gesellschaft 1995:167).
In der Herstellung von Artefakten unterscheide ich drei Herstellungsaspekte:
• Beim Konstruieren verwende ich Halbfabrikate, die nicht konstruiert sind, beispielsweise Blech
• Bei der Herstellung von elementaren Halbfabrikaten forme ich Material, ich walze oder giese beispielsweise Stahl
• Beim Beschaffen von Material ist mir dessen Form nicht wichtig, ich wähle Eigenschaften, Stahl beispielsweise ist härter als Eisen
Die Produktion von Stahl kann ich als Herstellung begreifen. Ich kann Stahl nicht formlos herstellen, auch wenn mich die Form im Prinzip nicht interesssiert. Wenn ich aber ein Material wie Stahl herstelle, weiss ich wozu und damit verbunden auch, in welcher Form es mir als Halbfabrikat am besten dient. Das Herstellen von Material erscheint unter entwickelten Produktionsverhältnissen insofern als primäre Herstellungsart, als ich zuerst Stahl haben muss, bevor ich aus Stahlträgern eine Brücke konstruieren kann. Aber jede mir bekannte Materialherstellung setzt einerseits konstruierte Werkzeuge voraus und lässt sich als Aspekt neuer Werkzeugentwicklungen verstehen. Deshalb spreche ich von toolmaking animals und nicht von materialmaking animals.
Im so verstandenen Materialismus begreife ich die Entwicklung der Lebensverhältnisse als materielle Produktion in deren Zentrum die Werkzeugherstellung steht. Was Menschen denken oder glauben, oder was für Ideen und Ideale sie haben, und wie sie darüber sprechen, ist dabei so sekundär, wie die physikalische Perspektive auf die sogenannte Materie. Es geht dabei nicht um Erkenntnis, sondern um Aneignung, die Erkenntnis einschliesst.
Erläuterung am Beispiel der Kybernetik
In der Kybernetik verwende ich hochentwickelte Werkzeuge, also Automaten als Erklärungungen. Das, was ich erkläre, bezeichne ich als Phänomen. Als Standardbeispiel gilt der Thermostat als Erklärung für das Phänomen, dass die Temperatur in einem Raum konstant bleibt. Es spielt dabei keine Rolle, warum Menschen gerne konstante Raumtemperaturen haben, weil es nicht darum geht, Menschen zu erklären.
Die konstante Raumtemperatur dient hier als Beispiel für eine hergestellte Umwelt. Die Räume, die Heizungen und die Thermostaten sind materielle Produkte und mithin durch Tätigkeiten geformtes Material. Wenn ich den Raum mit konstanter Temperatur noch nicht habe, dient mir die Erklärung als Herstellungsanweisung.
In gewisser Hinsicht beginnt die Kybernetik mit Phänomenen. Hinter jedem kybernetischen Phänomen steht aber ein Beobachter, der eine Erklärung will. Was als Phänomen in Frage kommt, wird in dieser materialistischen Auffassung durch das bestimmt, was toolmaking animals herstellen wollen.
Der sozialhistorische Materialismus
Wenn ich von der Entwicklung des Menschen spreche, unterscheide ich eine naturhistorische Entwicklung innerhalb des Tierreiches, die mit dem Auftreten des Menschen abgeschlossen ist, und eine sozialhistorisch Entwicklung des Menschen, die mit dem Auftreten des Menschen beginnt und in welcher sich nicht mehr der Mensch, sondern dessen Lebensverhältnisse als Kultur entwickeln. Wenn ich den Menschen als toolmaking animal beobachte, beobachte ich im Tierreich eine Entwicklung hin zur Verwendung von Objekten, welche am Schluss den Menschen als Herstellenden hervorbringt, und eine zweite Entwicklung, in welcher sich die Menschen dadurch entwickeln, dass sie ihre Werkzeuge, ihre Lebensmittel und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse entwickeln.
In die Kultur gehört alles, was nicht auch in der Natur vorhanden ist. Die Geschichte des Menschen beinhaltet, was Tiere auch tun und was Tiere nicht auch tun. Mit dem Ausdruck toolmaking animal bezeichne ich den Oberbegriff und die Differenz. Menschen leben als naturgeschichtliche Wesen wie andere Tiere. Die quasi natürlichste Aneignung bezeichne ich Konsumtion. Alle Tiere nehmen Nahrung aus ihrer Umwelt auf. Viele Tiere konsumieren auch Material, mit welchem sie ihre Umwelten einrichten. Bestimmte Vögel beispielsweise bauen Nester. Bei dieser Art des Konsumierens bleibt das Material in der Herstellung in veränderter Form erhalten und wird in diesem Sinne erst beim Konsumieren des Nestes verbraucht. Menschen konsumieren auch Materiel, wenn sie Werkzeuge herstellen und natürlich konsumieren sie auch die Werkzeuge und mithin das Material, aus welchem die Werkzeuge gemacht sind, wenn sie mit Werkzeugen ihre Lebensmittel produzieren.
In der Produktion ihrer Lebensmittel gehen Menschen bestimmte Produktionsverhältnisse ein, die sich historisch mit der Entwicklungsstufe der jeweilig materiellen Produktivkräfte zusammen entwickeln. Als sozialhistorischen Materialismus bezeichne ich die Geschichtsschreibung, in welcher die Produktionsverhältnisse als spezifischer Aspekt der materiellen Produktion erscheinen. K. Marx sprach von einer notwendigen Entwicklung der Produktionsverhältnisse, während sie mir als zufällig, also nur historisch gegeben erscheinen. Diese materialistische Notwendigkeit ist eine evolutionstheoretisch zurückgeschaute, nicht eine deterministische. Ich weiss nie, was kommen muss, sondern immer nur was kommen musste.
Die - unter materialistischen Gesichtspunkten sozialhistorisch beobachtete - relevante Konsumtion ist die Produktion, in welcher Werkzeuge zur Herstellung von Werkzeugen wendet werden. Wo die Produktionsmittel nicht Eigentum jener sind, die damit arbeiten, unterscheide ich verschiedene Produktionsverhältnisse. Unter kapitalistischen Verhältnissen wird im Produktionsprozess Lohnarbeit konsumiert. Die Konsumtion der Arbeitskraft vollzieht sich wie jede andere Konsumtion ausserhalb des Markts oder der Zirkulationssphäre in ihrer unmittelbaren Verwendung.
Anti-Materialismen
Der herkömmlichen Auffassung von Materialismus wurde philosophiegeschichtlich gesehen ein Idealismus entgegengesetzt, der die Entseelung der Materie durch eine Vergeistigung aufgehoben hat. Jenseits der Differenz zwischen Materie und Geist hat K. Marx einen Materialismus begründet, den er selbst kaum ausgeführt hat und der auch in der Psychologie der Tätigkeit, etwa bei A. Leontjew und K. Holzkamp in Bezug auf Material sehr abstrakt geblieben ist. Auch dieser an Arbeit orientierte Materialismus - der wegen Lenins dialektisch-historischem Materialismus immer auch in politischen Konnotationen verstrickt war - ist wie der ursprünglichere Materialismus erst durch die Kritik an seinen idealistischen Gegenpositionen als solcher hervorgetreten.
In der Neuzeit hat der Materialismus zwei prominente Gegenpositionen, die Informationstheorie und Medientheorie.
In der Informationstheorie (die bei ihrem Erfinder C. Shannon noch mathematische Kommunikationstheorie geheissen hat) gibt es eine quasi rein geistige Information, die keinen materiellen Träger hat und sozusagen als etwas Drittes neben Materie und Energie fungieren soll. Auf Konstruktionen wird ganz verzichtet, weil jede Operation durch beliebige Konstruktionen realisiert werden kann.
Es handelt sich um eine Art Wiederholung der hegelschen Logik gegen den Materialismus.
In der Medientheorie, wie sie beispielsweise durch F. Heider eingeführt wurde, wurd das Geformte als Ding bezeichnet und anstelle von Materie der Ausdruck Medium verwendet. Differenztheoretisch kann dieses Medium durch die Differenz zwischen Material und Medium gesehen werden, wobei Medium für die nicht aktualisierte Form steht, also keine Eigenschaft hat, während die Materialbezeichnung Eigenschaften bezeichnet und auch eine konkrete Form impliziert.
Es handelt sich um eine Art Idealismus, die von der doppelten Bestimmung der Herstellung abstrahiert und nur die quasi geistige Form beobachtet.
die herstellende Tätigkeit als Aneignung reflektiere und dabei primär zwei Unterscheidungen verwende: Form und Material. Wenn ich ein Artefakt herstelle, forme ich Material.
• Als Form bezeichne ich in einem operativen Sinn, genau das, was ich zeichnen kann. Jede Zeichnung repräsentiert die Form.
• Als Material bezeichne ich das, was ich forme, wenn ich beispielsweise ein Schwert oder eine Sichel schmiede. Das, was ich forme, bestimme ich durch herstellungsrelevante Eigenschaften. Materialien wie Bronze und Silber, oder allgemeiner wie Metalle sind in diesem Sinne Verdinglichungen dieser Eigenschaften, die ich - quasi-ontologisch formuliert - am Material wahrnehme. “Metall” bedeutet in diesem Sinne “glänzend, stromleitend, schwer, …” und “Silber” bedeutet “Metall, helle Farbe, nicht oxidierend, …”.
Als Materialismus bezeichne ich in diesem Sinne das Resultat einer vortheoretischen Entscheidung, die in entsprechenden Theorien als vorausgesetzte Setzung erkennbar wird. Die verwendeten Unterscheidungen sind nicht von einer wirklichen Beschaffenheit einer gegeben Welt abhängig, sondern davon, wie ich ich mir die tätige Aneignung der Welt durch eine doppelte Differenz vorstelle.
Ich kann um im Beispiel zu bleiben, eine Sichel sehr verschieden formen, aber ich kann sie nicht formlos machen. Für eine Sichel kann ich sehr verschiedene Materialien verwenden, aber ich kann sie nicht ohne Material herstellen.
Die Einheit der operationellen Differenz zwischen Form und Material ist die Herstellung.
Materialien entstehen in doppelter Hinsicht mit ihren Formungen. Als Material bezeichne ich sekundär alles, was eine (tautologischerweise zeichenbare) Form hat und logisch primär das, was sich durch die herstellende Formgebung konstituiert. Das Referenzobjekt des Ausdruckes Bronze beispielsweise kann als Barren, Klumpen, Ohrring oder Statue, aber nicht ohne Form existieren. Jede Herstellung ist deshalb eine Umformung.
Wenn ich vom Material spreche, abstrahiere ich von dessen Form. Wenn ich dieses Material in einer physikalischen Perspektive beobachte, bezeichne ich es als Materie. Materie aber ist ein sich in Quanten auflösendes Konstrukt der Physik, also gerade kein Material (Zu dieser Konstitution siehe auch Luhmann über Medium in Die Kunst der Gesellschaft 1995:167).
In der Herstellung von Artefakten unterscheide ich drei Herstellungsaspekte:
• Beim Konstruieren verwende ich Halbfabrikate, die nicht konstruiert sind, beispielsweise Blech
• Bei der Herstellung von elementaren Halbfabrikaten forme ich Material, ich walze oder giese beispielsweise Stahl
• Beim Beschaffen von Material ist mir dessen Form nicht wichtig, ich wähle Eigenschaften, Stahl beispielsweise ist härter als Eisen
Die Produktion von Stahl kann ich als Herstellung begreifen. Ich kann Stahl nicht formlos herstellen, auch wenn mich die Form im Prinzip nicht interesssiert. Wenn ich aber ein Material wie Stahl herstelle, weiss ich wozu und damit verbunden auch, in welcher Form es mir als Halbfabrikat am besten dient. Das Herstellen von Material erscheint unter entwickelten Produktionsverhältnissen insofern als primäre Herstellungsart, als ich zuerst Stahl haben muss, bevor ich aus Stahlträgern eine Brücke konstruieren kann. Aber jede mir bekannte Materialherstellung setzt einerseits konstruierte Werkzeuge voraus und lässt sich als Aspekt neuer Werkzeugentwicklungen verstehen. Deshalb spreche ich von toolmaking animals und nicht von materialmaking animals.
Im so verstandenen Materialismus begreife ich die Entwicklung der Lebensverhältnisse als materielle Produktion in deren Zentrum die Werkzeugherstellung steht. Was Menschen denken oder glauben, oder was für Ideen und Ideale sie haben, und wie sie darüber sprechen, ist dabei so sekundär, wie die physikalische Perspektive auf die sogenannte Materie. Es geht dabei nicht um Erkenntnis, sondern um Aneignung, die Erkenntnis einschliesst.
Erläuterung am Beispiel der Kybernetik
In der Kybernetik verwende ich hochentwickelte Werkzeuge, also Automaten als Erklärungungen. Das, was ich erkläre, bezeichne ich als Phänomen. Als Standardbeispiel gilt der Thermostat als Erklärung für das Phänomen, dass die Temperatur in einem Raum konstant bleibt. Es spielt dabei keine Rolle, warum Menschen gerne konstante Raumtemperaturen haben, weil es nicht darum geht, Menschen zu erklären.
Die konstante Raumtemperatur dient hier als Beispiel für eine hergestellte Umwelt. Die Räume, die Heizungen und die Thermostaten sind materielle Produkte und mithin durch Tätigkeiten geformtes Material. Wenn ich den Raum mit konstanter Temperatur noch nicht habe, dient mir die Erklärung als Herstellungsanweisung.
In gewisser Hinsicht beginnt die Kybernetik mit Phänomenen. Hinter jedem kybernetischen Phänomen steht aber ein Beobachter, der eine Erklärung will. Was als Phänomen in Frage kommt, wird in dieser materialistischen Auffassung durch das bestimmt, was toolmaking animals herstellen wollen.
Der sozialhistorische Materialismus
Wenn ich von der Entwicklung des Menschen spreche, unterscheide ich eine naturhistorische Entwicklung innerhalb des Tierreiches, die mit dem Auftreten des Menschen abgeschlossen ist, und eine sozialhistorisch Entwicklung des Menschen, die mit dem Auftreten des Menschen beginnt und in welcher sich nicht mehr der Mensch, sondern dessen Lebensverhältnisse als Kultur entwickeln. Wenn ich den Menschen als toolmaking animal beobachte, beobachte ich im Tierreich eine Entwicklung hin zur Verwendung von Objekten, welche am Schluss den Menschen als Herstellenden hervorbringt, und eine zweite Entwicklung, in welcher sich die Menschen dadurch entwickeln, dass sie ihre Werkzeuge, ihre Lebensmittel und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse entwickeln.
In die Kultur gehört alles, was nicht auch in der Natur vorhanden ist. Die Geschichte des Menschen beinhaltet, was Tiere auch tun und was Tiere nicht auch tun. Mit dem Ausdruck toolmaking animal bezeichne ich den Oberbegriff und die Differenz. Menschen leben als naturgeschichtliche Wesen wie andere Tiere. Die quasi natürlichste Aneignung bezeichne ich Konsumtion. Alle Tiere nehmen Nahrung aus ihrer Umwelt auf. Viele Tiere konsumieren auch Material, mit welchem sie ihre Umwelten einrichten. Bestimmte Vögel beispielsweise bauen Nester. Bei dieser Art des Konsumierens bleibt das Material in der Herstellung in veränderter Form erhalten und wird in diesem Sinne erst beim Konsumieren des Nestes verbraucht. Menschen konsumieren auch Materiel, wenn sie Werkzeuge herstellen und natürlich konsumieren sie auch die Werkzeuge und mithin das Material, aus welchem die Werkzeuge gemacht sind, wenn sie mit Werkzeugen ihre Lebensmittel produzieren.
In der Produktion ihrer Lebensmittel gehen Menschen bestimmte Produktionsverhältnisse ein, die sich historisch mit der Entwicklungsstufe der jeweilig materiellen Produktivkräfte zusammen entwickeln. Als sozialhistorischen Materialismus bezeichne ich die Geschichtsschreibung, in welcher die Produktionsverhältnisse als spezifischer Aspekt der materiellen Produktion erscheinen. K. Marx sprach von einer notwendigen Entwicklung der Produktionsverhältnisse, während sie mir als zufällig, also nur historisch gegeben erscheinen. Diese materialistische Notwendigkeit ist eine evolutionstheoretisch zurückgeschaute, nicht eine deterministische. Ich weiss nie, was kommen muss, sondern immer nur was kommen musste.
Die - unter materialistischen Gesichtspunkten sozialhistorisch beobachtete - relevante Konsumtion ist die Produktion, in welcher Werkzeuge zur Herstellung von Werkzeugen wendet werden. Wo die Produktionsmittel nicht Eigentum jener sind, die damit arbeiten, unterscheide ich verschiedene Produktionsverhältnisse. Unter kapitalistischen Verhältnissen wird im Produktionsprozess Lohnarbeit konsumiert. Die Konsumtion der Arbeitskraft vollzieht sich wie jede andere Konsumtion ausserhalb des Markts oder der Zirkulationssphäre in ihrer unmittelbaren Verwendung.
Anti-Materialismen
Der herkömmlichen Auffassung von Materialismus wurde philosophiegeschichtlich gesehen ein Idealismus entgegengesetzt, der die Entseelung der Materie durch eine Vergeistigung aufgehoben hat. Jenseits der Differenz zwischen Materie und Geist hat K. Marx einen Materialismus begründet, den er selbst kaum ausgeführt hat und der auch in der Psychologie der Tätigkeit, etwa bei A. Leontjew und K. Holzkamp in Bezug auf Material sehr abstrakt geblieben ist. Auch dieser an Arbeit orientierte Materialismus - der wegen Lenins dialektisch-historischem Materialismus immer auch in politischen Konnotationen verstrickt war - ist wie der ursprünglichere Materialismus erst durch die Kritik an seinen idealistischen Gegenpositionen als solcher hervorgetreten.
In der Neuzeit hat der Materialismus zwei prominente Gegenpositionen, die Informationstheorie und Medientheorie.
In der Informationstheorie (die bei ihrem Erfinder C. Shannon noch mathematische Kommunikationstheorie geheissen hat) gibt es eine quasi rein geistige Information, die keinen materiellen Träger hat und sozusagen als etwas Drittes neben Materie und Energie fungieren soll. Auf Konstruktionen wird ganz verzichtet, weil jede Operation durch beliebige Konstruktionen realisiert werden kann.
Es handelt sich um eine Art Wiederholung der hegelschen Logik gegen den Materialismus.
In der Medientheorie, wie sie beispielsweise durch F. Heider eingeführt wurde, wurd das Geformte als Ding bezeichnet und anstelle von Materie der Ausdruck Medium verwendet. Differenztheoretisch kann dieses Medium durch die Differenz zwischen Material und Medium gesehen werden, wobei Medium für die nicht aktualisierte Form steht, also keine Eigenschaft hat, während die Materialbezeichnung Eigenschaften bezeichnet und auch eine konkrete Form impliziert.
Es handelt sich um eine Art Idealismus, die von der doppelten Bestimmung der Herstellung abstrahiert und nur die quasi geistige Form beobachtet.
[63 Kommentar]
Inhalt
Was heisst Dialog? - September 12, 2016
Im Dialog kann ich erkennen, wie andere Menschen sprechen, wie sie welche Worte verwenden. Dabei wird mir bewusst, wie ich spreche und wie ich sprechen könnte. Im Dialog kann ich auch erkennen, dass der Ausdruck "Dialog" sehr verschieden verwendet  wird. Gemeinhin wird der Ausdruck "Dialog" für ernst gemeinte oder ernsthaft geführte Vermittlungsgespräche verwendet, etwa als Dialog zwischen Religionen oder zwischen Kriegsparteien. Als Vermittlungsgespräche unterscheiden sich Dialoge von den Monologen, die dort, wo Vermittlung notwendig wird, üblicherweise geführt werden. "Dialog" bezeichnet auch eine rhetorische Form, etwa als sokratischer Dialog oder galileischer Diskurs, in welcher ein eigentlicher Monolog durch einen fiktiven Idioten, der Fragen stellt, "dialogisiert" wird. Dia-log wird in diesen Interpretationen als Zwiegespräch von einem Mono-log unterschieden, in welchem eben nur einer oder nur eine Meinung spricht.
Ich verwende den Ausdruck "Dialog" in Anlehnung an M. Buber und D. Bohm. Ich interpretiere dabei Dialog quasi-etymologisch als "dia logos", was ich mit "durch das Wort" oder "mittels des Wortes" übersetze. Dabei stelle ich mir die Frage, was ich "durch das Wort" gewährleisten will.
Ich unterscheide Dialog und Monolog nicht in bezug auf die Anzahl der beteiligten oder sprechenden Personen, sondern in bezug auf die Anzahl der Sichtweisen, die angestrebt werden. Als Monolog bezeichne ich das Ziel einer Diskussion, also die Entwicklung einer richtigen oder wahren Sichtweise. Als Dialog bezeichne ich die Entwicklung von möglichst vielen Sichtweisen. Der Dialog, von welchem ich spreche, steht quasi unter dem ethischen Imperativ von H. von Foerster "Erhöhe die Anzahl der Möglichkeiten". In der Diskussion geht es darum, verschiedene Sichtweise zugunsten der besten Sichtweise aufzulösen, im Dialog geht es darum, verschiedene Sichtweisen zu erkennen. V. Flusser hat in seiner Kommunikationslehre vorgeschlagen, in Gesprächen zwischen Dialogen und Diskussionen abzuwechseln. D. Bohm bezeichnete den Dialog als Gespräch am Ende der Diskussionen. Ich sehe im Dialog eine Möglichkeiten die Differenz zwischen Diskussion und Dialog aufzuheben.
wird. Gemeinhin wird der Ausdruck "Dialog" für ernst gemeinte oder ernsthaft geführte Vermittlungsgespräche verwendet, etwa als Dialog zwischen Religionen oder zwischen Kriegsparteien. Als Vermittlungsgespräche unterscheiden sich Dialoge von den Monologen, die dort, wo Vermittlung notwendig wird, üblicherweise geführt werden. "Dialog" bezeichnet auch eine rhetorische Form, etwa als sokratischer Dialog oder galileischer Diskurs, in welcher ein eigentlicher Monolog durch einen fiktiven Idioten, der Fragen stellt, "dialogisiert" wird. Dia-log wird in diesen Interpretationen als Zwiegespräch von einem Mono-log unterschieden, in welchem eben nur einer oder nur eine Meinung spricht.
Ich verwende den Ausdruck "Dialog" in Anlehnung an M. Buber und D. Bohm. Ich interpretiere dabei Dialog quasi-etymologisch als "dia logos", was ich mit "durch das Wort" oder "mittels des Wortes" übersetze. Dabei stelle ich mir die Frage, was ich "durch das Wort" gewährleisten will.
Ich unterscheide Dialog und Monolog nicht in bezug auf die Anzahl der beteiligten oder sprechenden Personen, sondern in bezug auf die Anzahl der Sichtweisen, die angestrebt werden. Als Monolog bezeichne ich das Ziel einer Diskussion, also die Entwicklung einer richtigen oder wahren Sichtweise. Als Dialog bezeichne ich die Entwicklung von möglichst vielen Sichtweisen. Der Dialog, von welchem ich spreche, steht quasi unter dem ethischen Imperativ von H. von Foerster "Erhöhe die Anzahl der Möglichkeiten". In der Diskussion geht es darum, verschiedene Sichtweise zugunsten der besten Sichtweise aufzulösen, im Dialog geht es darum, verschiedene Sichtweisen zu erkennen. V. Flusser hat in seiner Kommunikationslehre vorgeschlagen, in Gesprächen zwischen Dialogen und Diskussionen abzuwechseln. D. Bohm bezeichnete den Dialog als Gespräch am Ende der Diskussionen. Ich sehe im Dialog eine Möglichkeiten die Differenz zwischen Diskussion und Dialog aufzuheben.
[1 Kommentar]
Inhalt
Medium – Medien - August 31, 2016
Das Homonym "Medium" wird für sehr verschiedene Vorstellungen in oft sehr diffus gesehenen "Vermittlungszusammenhängen" verwendet. Ich rekonstruiere einige mir gängige Verwendungen des Ausdruckes, indem ich sie als Metaphern interpretiere. Als Ausgangspunkt der Metaphern wähle ich pseudo-etymologisch begründet den "Äther", den Aristoteles als Quintessence, also als das, was hinter allem ist, einführte. Im anschaulichsten Fall ist das Medium ein "Material", in welchem eine "Wirkung" weitergegeben wird.
Medium in der Wellenträger-Metapher (Beispiel Schallwellen: Luft als Medium)
In der technologischen Perspektive der Kybernetik bezeichne ich den "Träger" eines Energieflusses als Medium. Luft ist beispielsweise das Trägermaterial, in welchem sich (Schall)Wellen fortpflanzen, was durch einen entsprechenden Empfänger wie etwa das Ohr als Übertragung von Schall interpretiert wird. Das Ohr ist am Schall interessiert, die Luft ist nur Mittel zum Zweck oder eben Medium.
Die Welle erscheint als Energiefluss, der gehörte Schall ist die Wirkung, die sich auch als Schwingung einer Membran zeigen kann. Die Äther-Energie-Vorstellung ist eine primitive Abstraktion dieses Verhältnisses.
Medium in der Kanal-Metapher (Beispiel: Telefonsignale: Leitung/Kabel als Medium)
Beim Festnetz-Telefon fliessen die Signale durch einen Kupferdraht. Das Kupfer ist also Trägermaterial der "elektrischen Wellen".Technologisch bezeichne ich den Draht als Kanal und das Kupfer als Medium der Signale. In der Metapher erscheint die Leitung anstelle des Materials der Leitung als Medium, weil die Leitung für Kanal und Material steht. Die Signale fliessen in der verkürzten Redeweise durch das Kabel statt durch das Kupfer.
Flusser (:271) fragt: Was ist das Medium im Falle des Telefons: die Drähte oder die Sprache. Er kann sich nicht entscheiden und verwirft die Frage. Dann beantwortet er die Frage: Was ist ein Medium? Medien sind Strukturen in denen Codes funktionieren. Leider bleibt unbestimmt, was Codes sind, so dass sie in Strukturen funktionieren können.
Medium in der Metapher der elektrischen Massen-Medien (Beispiel: "Äther" als Medium für Radiosignale)
Beim Radio (das in der Entwickling der Technik das Telefon als Konzertübertragungsmittel abglöst hat) entfällt die Leitung, aber nicht das Sender- und das Empfängergerät. Das Radio ist ein Telefon ohne Kabel. Die Leitung erscheint als - gedachtes - Trägermaterial der Radiowellen, der Kanal erscheint als - gedachte - Verbindung zwischen Sender und Radiogerät. Weil überdies ein Vielzahl von Radiogeräten gespiesen werden können, wird der Kanal zum Massenkanal. In der Metapher erscheint die Menge der Kanäle als Medium. Radio heisst dabei nicht das Radioempfangsgerät, sondern die Institution, durch die die Radiosignale fliessen. Und weil sich Radio an die Massen richtet, spreche ich in dieser Metapher von einem Massen-Medium.
Die Signale fliessen in der verkürzten Redeweise durch die "massenhafte Verbindung" zwischen elektrischen Geräten, die Radio genannt wird, statt durch den Äther.
Medium in der Metapher der gedruckten Massen-Medien (Beispiel: "Zeitung" als Medium)
Das gesprochene Wort fliesst als Schallwelle durch die Luft. Das geschriebene Wort "fliesst" mit dem Brief oder mit der Zeitung zum Leser. Natürlich fliesst die Zeitung nicht, sie wird vom Postboten getragen. Die Zeitung wird durch eine Analogie zum Radio zum Medium, die darauf beruht, dass die Institutionen durch Redaktionen bestimmt sind. Massenmedien sind Massenmedien, weil sie Redaktionen haben. Der Ausdruck Massenmedium wird dabei zum Eigenname jenseits des Begriffs Medium. Aber natürlich fliesst auch bei der Zeitung ein Signal durch den Äther, der Text muss nämlich vom Zeitungspapier vor den Augen in die Auge des Lesers kommen.
In der Metapher, die eine Zeitung zum Medium macht, wird ganz viel verkürzt, was darin seinen Ausdruck findet, dass auch die Schrift als Medium bezeichnet wird.
Medium in der Schrift-Metapher
Wo von Schrift die Rede ist, ist oft Text gemeint, also Geschriebenes. Das geschriebene Wort steuert das Licht in den Augen des Lesers. Nicht der Text (etwa die Druckerschwärze der Zeitung) fliesst in die Augen des Lesers, sondern Licht. Ich sehe beim Lesen aber nicht das Licht, sondern die Buchstaben vor meinen Augen. In diesem Sinne wird die Schrift zum Medium anstelle der Lichtwellen im Äther, die durch die Schrift gesteuert werden.
Die Zeitung trägt die Schrift zum Leser, die Schrift steht als Medium für verdrängte Signale, die ins Auge fliessen.
Medium in der Sprache-Metapher
Schrift erscheint neben dem gesprochenen Wort als Repräsentant von Sprache, wodurch Sprache als Medium erscheint, wenn man hinreichend abstrakt beobachtet und sich unter Sprache nichts mehr vorstellt als gesprochene und geschrieben Worte.
In der Metapher, die Sprache zum Medium macht, wird Sprache anstelle von Schrift und anstelle des Schalls des gesprochenen Wortes gesetzt. Durch die Sprache werden die sich ausbreitenden Schallwellen und Radiosignale, die durch den Äther fliessen, als Nachricht oder Mitteilung gedeutet, wobei die Signale Symbole, also Worte repräsentieren. Und wo die Unterscheidung zwischen den Signalen und ihrer Symbolhaftigkeit aufgehoben wird, erscheint in der Metapher das Medium nicht als Signal, sondern als Symbol. Das Wort ist das Medium der Mitteilung.
Medium in der Computer-Metapher
Computer sind elektromechanische Geräte, die der Symbolproduktion dienen. Der Bildschirm fungiert wie eine Zeitung als Übertragungsmaterial von Zeichen und wird deshalb als Medium gesehen. Die Signale vom Bildschirm ins Auge des Benutzers fliessen, sind durch Signale bestimmt, die den Bildschirminhalt erzeugen. und diese Signal werden im Computer aufgrund von verhergehenden Eingaben berechnet. Der Computer vermittelt in dieser Metapher zwischen Ein- und Ausgaben und erscheint so als Medium, das von sich aus nichts beiträgt, sondern nur die Signale weiterträgt.
Medium in der Esoterik (Beispiel: Autor)  Den Ausdruck Medium verwende ich für Menschen, die zwischen Feinstofflichem und Stofflichem vermitteln. In der Esoterik wird der Überbringer als Medium (oder synonym als Kanal (Channeling)) bezeichnet.
"Autor" bedeutet ursprünglich autorisierter Stellvertreter des Schöpfers, also eine Art autorisiertes Medium, das für das Gesagte nicht eigentlich verantwortlich ist. Später oder emanzipierter schreibt der Autor selbst(bewusst), was andere wissen müssen, aber immer noch, weil er aufgrund seiner Kanäle autorisiert ist. Der Autor N. Luhmann schreibt: "Fast nichts stammt vom Autor ..."
Die Metapher wird also immer ver- oder entrückter, was dazu führt, dass so verschiedene Sachen wie Sprache, Zeitung und Luft als Medium bezeichnet werden. In den bisherigen Metaphern lässt sich - wie entrückt auch immer - der Äther noch als Träger von Wellen erkennen. Die Metapher entfaltet sich aber auch in eine andere Richtung. Nachdem erkannt ist, dass Radiowellen keinen Äther brauchen, der sie trägt, wird die Form der Radiowelle von der Radiowelle unterschieden.
Die (Äther-)Welle als Medium (Form anstelle von Materie und Energie)
Die Radiowelle wird so zum Träger ihrer eigenen Form und mithin zum Medium. Das Medium ist dabei nicht irgendeine Art von Material, sondern das Unsichtbare, nicht Wahrnehmbare, das die Form zulässt. Anstelle von Material, das die Welle zulässt, tritt die Welle, die eine Form der Welle zulässt. Das Medium übernimmt dabei den Platz von Material, das nicht gedacht werden will, weil nur die Form interessiert oder erscheint.
H. Duerr erzählt die Geschichte der Physik wie folgt: Man wollte wissen, was Material jenseits seiner Form ist. Also zerlegte man das Material bis hin zum Atom. Das Atom war gedacht als materielles Element. Leider hat das Atom aber Teile, einen Kern und Elektronen, die nicht Atom heissen können, weil der Ausdruck für das Kleinste eben schon vergeben war. Dann aber machte die Quantenphysik ein spezielles Experiment, das zeigte, dass man nicht sinnvoll von einem "Kleinsten" sprechen kann, weil es irgendwie "verschmiert" ist also keinen scharfen Ort hat (Heisenbergs Unschärfe). Man muss nun von Wellen sprechen, aber Wellen sind eine Form. Man ist also wieder dort, wo man anfänglich weg wollte: Man wollte Materie jenseits der Form und hat nur Formen gefunden.
Das Nichtbeobachtete als Medium (Die nicht-markierte Seite)
N. Luhmann formalisiert das Medium mittels G. Spencer-Brown's Pseudomathematik. Jede Beobachtung markiert eine Form durch eine Unterscheidung. Das, was nicht bezeichnet ist, ist zusammen mit dem, was bezeichnet ist, das Medium der Unterscheidung. Das Medium existiert nicht und trägt keinen Energiefluss. Medium bezeichnet ein durch eine Operation negativ bestimmtes Potential.
Innerhalb der Kommunikation beispielsweise wird etwas gesagt. Das Gesagte ist eine Wahl. Alles was auch gesagt werden könnte, ist das Medium des Gesagten. Hier geht es also nicht um Sprache oder Worte, sondern um das Nichtgesagte oder um die nicht markierte Seite der Form.
“Ein Medium ist eine unbestimmte, aber bestimmbare Menge von Möglichkeiten, in ihm bestimmte Formen zu bilden. Nur die Form ist bestimmt, deswegen ist auch nur sie beobachtbar” (Baecker, S. 182).
Den Ausdruck Medium verwende ich für Menschen, die zwischen Feinstofflichem und Stofflichem vermitteln. In der Esoterik wird der Überbringer als Medium (oder synonym als Kanal (Channeling)) bezeichnet.
"Autor" bedeutet ursprünglich autorisierter Stellvertreter des Schöpfers, also eine Art autorisiertes Medium, das für das Gesagte nicht eigentlich verantwortlich ist. Später oder emanzipierter schreibt der Autor selbst(bewusst), was andere wissen müssen, aber immer noch, weil er aufgrund seiner Kanäle autorisiert ist. Der Autor N. Luhmann schreibt: "Fast nichts stammt vom Autor ..."
Die Metapher wird also immer ver- oder entrückter, was dazu führt, dass so verschiedene Sachen wie Sprache, Zeitung und Luft als Medium bezeichnet werden. In den bisherigen Metaphern lässt sich - wie entrückt auch immer - der Äther noch als Träger von Wellen erkennen. Die Metapher entfaltet sich aber auch in eine andere Richtung. Nachdem erkannt ist, dass Radiowellen keinen Äther brauchen, der sie trägt, wird die Form der Radiowelle von der Radiowelle unterschieden.
Die (Äther-)Welle als Medium (Form anstelle von Materie und Energie)
Die Radiowelle wird so zum Träger ihrer eigenen Form und mithin zum Medium. Das Medium ist dabei nicht irgendeine Art von Material, sondern das Unsichtbare, nicht Wahrnehmbare, das die Form zulässt. Anstelle von Material, das die Welle zulässt, tritt die Welle, die eine Form der Welle zulässt. Das Medium übernimmt dabei den Platz von Material, das nicht gedacht werden will, weil nur die Form interessiert oder erscheint.
H. Duerr erzählt die Geschichte der Physik wie folgt: Man wollte wissen, was Material jenseits seiner Form ist. Also zerlegte man das Material bis hin zum Atom. Das Atom war gedacht als materielles Element. Leider hat das Atom aber Teile, einen Kern und Elektronen, die nicht Atom heissen können, weil der Ausdruck für das Kleinste eben schon vergeben war. Dann aber machte die Quantenphysik ein spezielles Experiment, das zeigte, dass man nicht sinnvoll von einem "Kleinsten" sprechen kann, weil es irgendwie "verschmiert" ist also keinen scharfen Ort hat (Heisenbergs Unschärfe). Man muss nun von Wellen sprechen, aber Wellen sind eine Form. Man ist also wieder dort, wo man anfänglich weg wollte: Man wollte Materie jenseits der Form und hat nur Formen gefunden.
Das Nichtbeobachtete als Medium (Die nicht-markierte Seite)
N. Luhmann formalisiert das Medium mittels G. Spencer-Brown's Pseudomathematik. Jede Beobachtung markiert eine Form durch eine Unterscheidung. Das, was nicht bezeichnet ist, ist zusammen mit dem, was bezeichnet ist, das Medium der Unterscheidung. Das Medium existiert nicht und trägt keinen Energiefluss. Medium bezeichnet ein durch eine Operation negativ bestimmtes Potential.
Innerhalb der Kommunikation beispielsweise wird etwas gesagt. Das Gesagte ist eine Wahl. Alles was auch gesagt werden könnte, ist das Medium des Gesagten. Hier geht es also nicht um Sprache oder Worte, sondern um das Nichtgesagte oder um die nicht markierte Seite der Form.
“Ein Medium ist eine unbestimmte, aber bestimmbare Menge von Möglichkeiten, in ihm bestimmte Formen zu bilden. Nur die Form ist bestimmt, deswegen ist auch nur sie beobachtbar” (Baecker, S. 182).
[0 Kommentar]
Inhalt
George Spencer-Brown - August 28, 2016
Anmerkungen zu einer persönlichen Begegnung
Nachdem G. Spencer-Brown, Autor von Laws of Form, in der Konstruktivisten-Szene 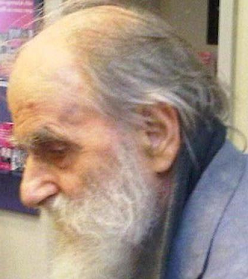 durch H. von Foersters Zitat zum Guru avancierte, wurde er wieder entdeckt und zu einem Lehrauftrag an die Uni Heidelberg eingeladen, für den er nach eigenen Angaben nicht wie vereinbart bezahlt wurde. 1998 war er als Gastredner am Complex-Change-Kongress der Fachstelle für Weiterbildung der Universität Zürich.
"G. Spencer-Brown" ist eine komplexe Figur, die radikal für die "Philosophie" steht, die mit seinen verschiedenen Namen und Darstellungen verbunden ist. Er selbst beschreibt sich als erleuchtet (in: Dieses Spiel geht nur zu zweit). In der Anwendung seines Kalküls erscheint die Erleuchtung als re-entry auf einen Zustand, der zuvor als Geisteskrankheit konstruiert wird. G. Spencer-Brown ist ein beautiful mind in der expliziten Form.
Mich behandelte G. Spencer-Brown jedenfalls in gröbster Art, als ich anlässlich seines Besuches unserer Veranstaltung in Zürich für drei Tage auf ihn aufpassen musste, weil er sich in einer fremden Umgebung krankheitsbedingt räumlich nicht orientieren kann. Das war allerdings nur meine Wahrnehmung. Er selbst hatte dazu eine ganz andere Interpretation: Er sagte mir ganz direkt ins Gesicht, ich sei ein ganz normaler Idiot, der seine eigenen Wahrnehmungen für wirklich nehme.
Re-entry: Wenn mir jemand sagt, ich sei ein Idiot und dabei sagt, was mich zu
Idioten macht, nämlich dass ich etwas für-Wahr-nehme, beobachte ich die Differenz. Man kann die Unterscheidung treffen, wonach es eine Wirklichkeit gibt. Ich habe beispielsweis für wirklich gehalten, dass ich drei Tage lang auf Herrn Spencer-Brown aufpassen musste und er mich dabei laufend beleidigte. Wenn ich aber meine Unterscheidung nicht so gezogen hätte - was er als Idiotie bezeichnete - hätte ich etwas ganz anderes erlebt. Ich hätte dann erlebt, dass er in seiner Radikalität über Idioten spricht und merkt, dass die Idioten das nicht verstehen, also Demonstrationen brauchen. Also demonstrierte er seine Theorie so, dass ich nicht umhin kam, seine Theorie (Anschauung) ernst zu nehmen, oder ihn als verrückt zu sehen.
Mittlerweile sehe ich, dass sich das Muster reproduziert. Wer Aussagen wie "ich habe die Enkelin von Russel vergewaltigt" auf eine Wirklichkeit bezieht, hat von LoF nicht die geringste Ahnung.
Ich halte LoF für einen ultimativen Ausdruck von Wahnsinn (vom Wahnsinn, der in der Standardauffassung von Mathematik überhaupt steckt). Herr Spencer-Brown hat mir durch seine Beleidigungen (ich bezeichne sie als die 4. Beleidigung des menschlichen Verstandes) soviel eröffnet, wie C. Darwin, der mich glauben machen will, ich würde von Affen abstammen.
durch H. von Foersters Zitat zum Guru avancierte, wurde er wieder entdeckt und zu einem Lehrauftrag an die Uni Heidelberg eingeladen, für den er nach eigenen Angaben nicht wie vereinbart bezahlt wurde. 1998 war er als Gastredner am Complex-Change-Kongress der Fachstelle für Weiterbildung der Universität Zürich.
"G. Spencer-Brown" ist eine komplexe Figur, die radikal für die "Philosophie" steht, die mit seinen verschiedenen Namen und Darstellungen verbunden ist. Er selbst beschreibt sich als erleuchtet (in: Dieses Spiel geht nur zu zweit). In der Anwendung seines Kalküls erscheint die Erleuchtung als re-entry auf einen Zustand, der zuvor als Geisteskrankheit konstruiert wird. G. Spencer-Brown ist ein beautiful mind in der expliziten Form.
Mich behandelte G. Spencer-Brown jedenfalls in gröbster Art, als ich anlässlich seines Besuches unserer Veranstaltung in Zürich für drei Tage auf ihn aufpassen musste, weil er sich in einer fremden Umgebung krankheitsbedingt räumlich nicht orientieren kann. Das war allerdings nur meine Wahrnehmung. Er selbst hatte dazu eine ganz andere Interpretation: Er sagte mir ganz direkt ins Gesicht, ich sei ein ganz normaler Idiot, der seine eigenen Wahrnehmungen für wirklich nehme.
Re-entry: Wenn mir jemand sagt, ich sei ein Idiot und dabei sagt, was mich zu
Idioten macht, nämlich dass ich etwas für-Wahr-nehme, beobachte ich die Differenz. Man kann die Unterscheidung treffen, wonach es eine Wirklichkeit gibt. Ich habe beispielsweis für wirklich gehalten, dass ich drei Tage lang auf Herrn Spencer-Brown aufpassen musste und er mich dabei laufend beleidigte. Wenn ich aber meine Unterscheidung nicht so gezogen hätte - was er als Idiotie bezeichnete - hätte ich etwas ganz anderes erlebt. Ich hätte dann erlebt, dass er in seiner Radikalität über Idioten spricht und merkt, dass die Idioten das nicht verstehen, also Demonstrationen brauchen. Also demonstrierte er seine Theorie so, dass ich nicht umhin kam, seine Theorie (Anschauung) ernst zu nehmen, oder ihn als verrückt zu sehen.
Mittlerweile sehe ich, dass sich das Muster reproduziert. Wer Aussagen wie "ich habe die Enkelin von Russel vergewaltigt" auf eine Wirklichkeit bezieht, hat von LoF nicht die geringste Ahnung.
Ich halte LoF für einen ultimativen Ausdruck von Wahnsinn (vom Wahnsinn, der in der Standardauffassung von Mathematik überhaupt steckt). Herr Spencer-Brown hat mir durch seine Beleidigungen (ich bezeichne sie als die 4. Beleidigung des menschlichen Verstandes) soviel eröffnet, wie C. Darwin, der mich glauben machen will, ich würde von Affen abstammen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Arbeitsteilung - August 27, 2016
Umgangssprachlich wird der Ausdruck Arbeitsteilung für zwei ganz verschiedene Verhältnisse verwendet. In beiden Verhältnissen führen verschiedene Menschen verschiedene Tätigkeiten aus. Als Teilätigkeiten erscheinen diese Tätigkeiten, wenn eine noch ungeteilte ursprüngliche Gesamttätigkeit vorausgesetzt wird. In Bezug auf diese Gesamttätigkeit erscheint die Arbeitsteilung als Differenzierung, und in Bezug auf die so gesehenen Teiltätigkeiten als Spezialisierung.
Mit Arbeitsteilung ist in diesem umgangssprachlichen Sinn nicht gemeint, dass die Menge der Arbeit geteilt wird, wie es der Fall ist, wenn verschiedene Menschen eine bestimmte Arbeit gemeinsam erledigen und dabei dasselbe tun. Gemeint ist, dass die Beteiligten verschiedenes tun.
Ich unterscheide in Anlehnung an H. Braverman eine naturwüchsige und eine intendierte, innerbetriebliche Arbeitsteilung.
- Als naturwüchsige Arbeitsteilung bezeichne ich die Tatsache, dass Menschen verschiedene gewerbliche, freiberufliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten ausübern, indem sie etwa als Schlosser, als Arzt oder als Bauer arbeiten.
Wenn von dieser Arbeitsteilung gesprochen wird, werden diese Tätigkeiten als Teile einer Gesamttätigkeit aufgefasst, die genau durch die Summe der Teiltätigkeiten begriffen wird. Impliziert wird, wenn von Teilung gesprochen wird, dass ohne die Teilung der einzelne Mensch diese Gesamttätigkeit in einer noch nicht differenzierten Form ausführen müsste oder ursprünglich ausgeführt habe.
Zu dieser naturwüchsigen Vorstellung gehört auch, dass die Menschen ihre Arbeitsprodukte ursprünglich nicht teilten, sondern wie Waren getauscht haben.
- Als intendierte, innerbetriebliche Arbeitsteilung bezeichne ich die organisierte
 Zerlegung von Produktionstätigkeiten innerhalb eines Betriebes. Das Standardbeispiel stammt von A. Smith, der beschrieben hat, wie Nähnadeln in 18 verschiedenen Teiltätigkeiten von 18 verschiedenen Personen hergestellt wurden.
Wenn von dieser Arbeitsteilung gesprochen wird, werden die Tätigkeiten als Teile einer Gesamttätigkeit aufgefasst, die zur Herstellung des jeweiligen Produktes notwendig ist, und die im idealen Handwerk von einer einzigen Person ausgeführt wurde.
Die innerbetriebliche Arbeitsteilung begründet die Manufaktur und anschliessend die Fabrik, beides Aspekte der Industrie und mithin der Lohnarbeit.
A.Smith gilt immer noch als einer der bedeutendsten englischen Ökonomen. Er schrieb, dass die Vorteile der Arbeitsteilung vor allem in einer gesteigerten Geschicklichkeit der spezialisierten Arbeiter liege und in der Zeit, die gespart werde, dass der Einzelne sein Werkzeug nicht wechseln müssse. C. Babbage, einer der Väter des Computers, schrieb dagegen, dass die Aufspaltung eines Arbeitsprozesses in unterschiedlich anspruchsvolle Teilprozesse die Lohnkosten für die Produktion senke. Wenn jeder Arbeitende alles können muss, muss auch jeder den gleich grossen und eben grossen Lohn bekommen. C. Babbage formulierte dieses Prinzip erstmals in seinem 1832 in London erschienenen Werk On the Economy of Machinery and Manufactures.
Bei dieser Arbeitsteilung werden also auch die Arbeitenden in verschiedene Lohnklassen eingeteilt.
Zerlegung von Produktionstätigkeiten innerhalb eines Betriebes. Das Standardbeispiel stammt von A. Smith, der beschrieben hat, wie Nähnadeln in 18 verschiedenen Teiltätigkeiten von 18 verschiedenen Personen hergestellt wurden.
Wenn von dieser Arbeitsteilung gesprochen wird, werden die Tätigkeiten als Teile einer Gesamttätigkeit aufgefasst, die zur Herstellung des jeweiligen Produktes notwendig ist, und die im idealen Handwerk von einer einzigen Person ausgeführt wurde.
Die innerbetriebliche Arbeitsteilung begründet die Manufaktur und anschliessend die Fabrik, beides Aspekte der Industrie und mithin der Lohnarbeit.
A.Smith gilt immer noch als einer der bedeutendsten englischen Ökonomen. Er schrieb, dass die Vorteile der Arbeitsteilung vor allem in einer gesteigerten Geschicklichkeit der spezialisierten Arbeiter liege und in der Zeit, die gespart werde, dass der Einzelne sein Werkzeug nicht wechseln müssse. C. Babbage, einer der Väter des Computers, schrieb dagegen, dass die Aufspaltung eines Arbeitsprozesses in unterschiedlich anspruchsvolle Teilprozesse die Lohnkosten für die Produktion senke. Wenn jeder Arbeitende alles können muss, muss auch jeder den gleich grossen und eben grossen Lohn bekommen. C. Babbage formulierte dieses Prinzip erstmals in seinem 1832 in London erschienenen Werk On the Economy of Machinery and Manufactures.
Bei dieser Arbeitsteilung werden also auch die Arbeitenden in verschiedene Lohnklassen eingeteilt.
In der naturwüchsigen Arbeitsteilung tauschen die Produzenten ihre Arbeitsprodukte - in der heutigen Gesellschaft durch Geld vermittelt. Was aber tauschen Arbeitende, die in demselben Betrieb arbeiten?
In der innerbetrieblichen Arbeitsteilung teilen die Arbeitenden nichts, sie verrichten Teile einer von anderen geteilten Arbeit.
Arbeitsteilung ist ideologischer Ausdruck, der positive Konnotationen zu teilen transportieren soll, indem sehr verschiedene Verhältnisse gleich bezeichnet werden. Eine exemplarische Darstellung des ideologischen Commonsense (auf dem begrifflichen Niveau von A. Smith, wenn auch mit ein paar arbeitspsychologischen Anmerkungen) gibt beispielsweise T. Hildebrandt, ein Prof. der Ökonomie (!). Er spricht zwar explizit von einer "innerbetrieblichen Arbeitsteilung" ... :
Unter dem Begriff Arbeitsteilung versteht man folglich die Zerlegung der Produktion in Teilprozesse, die von speziell geschulten Arbeitern oder auch Betrieben durchgeführt werden. Hierbei sind mindestens drei Ebenen der Arbeitsteilung aufzuzeigen:
- Die innerbetriebliche Arbeitsteilung, bei der sich die Spezialisierung innerhalb eines Betriebs vollzieht und die Arbeitskräfte folglich nach ihren persönlichen Fähig- und Fertigkeiten eingesetzt werden.
- Die zwischenbetriebliche Arbeitsteilung vollzieht sich zwischen mindestens zwei (Produktions-) Betrieben, die für die Fertigung eines Erzeugnisses benötigten Rohstoffe, Baugruppen und Serviceleistungen zur Verfügung stellen.
- Die internationale (regionale) Arbeitsteilung, bei der sich die jeweiligen Volkswirtschaften (Regionen) auf die Produktion bestimmter Güter und Dienstleistungen spezialisieren, die anschließend über den Außenhandel wieder vereint werden. Das weltweite Zusammenwachsen der Märkte, die Globalisierung der Wirtschaftsstrukturen, wird mehr als Chance denn als Bedrohung betrachtet.
... er unterstellt aber die innerbetriebliche Arbeitsteilung als quasi kleiner Form der von ihm als zwischenbetriebliche Arbeitsteilung bezeichneten Differenzierung von industriellen Gewerben. Und dann erkennt er sogar dasselbe Muster in einer von ihm als internationale (regionale) Arbeitsteilung bezeichneten Differenzierung.
T. Hildebrandt verwischt damit alle Unterschiede auf groteske Weise, so dass sogar die ausgebeutetsten Nationen als Teile einer naturwüchsige Arbeitsteilung erscheinen.
Und selbst typische politische Ökonomen haben - im Unterschied zum "Hildebrandtschen" Commonsense - erkannt, dass der Gewinn der betrieblichen Arbeitsteilung einer Differenzierung der Lohnklassen entspringt.
PS:
In meinem Roman Walden III geht es um eine Aufhebung der Lohnarbeit, die als Aufhebung der innerbetrieblicher Arbeitsteilung erscheint. Eine Utopie, für viele Menschen nur als Utopie vorstellbar.
Bildquelle: www.aibobar.de/pikachu/667.html
[0 Kommentar]
Inhalt
Fliegen (nach Otto Lilienthal) - August 26, 2016
 ". . .to design an aeroplane is nothing; to build an aeroplane is something; but to fly an aeroplane is EVERYTHING!"
Otto Lilienthal (1849-1896) war einer der ersten Flieger. Er machte darüber einige markante Aeusserungen.
• Eine eher sozialutopische Ansicht von ihm:
In einem Brief an den Sozialreformer Moritz von Egidy aus dem Jahr 1894 schwärmt Lilienthal aber trotzdem von den friedensstiftenden Möglichkeiten der Fliegerei. "Die Grenzen der Länder würden Ihre Bedeutung verlieren, weil sie sich nicht mehr absperren lassen. Die Landesverteidigung, weil zur Unmöglichkeit geworden, würde aufhören, die besten Kräfte der Staaten zu verschlingen, und das zwingende Bedürfnis, die Streitigkeiten der Nationen auf andere Weise zu schlichten als den blutigen Kämpfen um die imaginär gewordenen Grenzen, würde uns den ewigen Frieden verschaffen."
• eine bionische Vorstellung habe ich im Buch Technische Intelligenz analysiert:
"Die Produkte der Ingenieure imitieren nicht die Natur (Das Verstehen der Natur ist für Ingenieure, die an Performanz interessiert sind, ”nur insofern notwendig, als es diese erleichtern würde” (Weizenbaum,1978, 220f)). Unsere Flugzeuge imitieren im Unterschied zum schliesslich abgestürzten Ikarus keineswegs die Vögel (Während sich die Flugzeugingenieure heute konstruktiv nicht mehr so sehr um das Fliegen der Vögel kümmern und eindeutig im Performanzmodus arbeiten, arbeiten viele ihrer Kollegen in der KI-Forschung immer noch unter dem Simulationsmodus daran, wie sie was vom Menschen kopieren können (vgl. Weizenbaum, 1978,220f).). O. Lilienthal, einer der Erfinder des Flugzeuges, schrieb anfänglich irritiert durch die Metapher, die er mitbegründete: "Mit welcher Ruhe, mit welcher vollendeten Sicherheit, mit welchen überraschend einfachen Mitteln sehen wir den Vogel auf der Luft dahin- gleiten! Das sollte der Mensch mit seiner Intelligenz, mit seinen mechanischen Hilfskräften, die ihn bereits wahre Wunderwerke schaffen liessen, nicht auch fertigbringen? Und doch ist es schwierig, ausserordentlich schwierig, nur annähernd zu erreichen, was der Natur so spielend gelingt" (Lilienthal, zit: Klemm, 1983,177). Die in der nicht bewussten Metapher begründete Verwechslung ist offensichtlich. "Mit überraschend einfachen Mitteln auf der Luft dahingleiten" sehen wir natürlich nicht die Vögel, sondern die - wenn man überhaupt Vergleiche anstellen wollte - extrem primitiven Gleiter, die O. Lilienthal konstruiert hat. Auf die wirkliche Konstruktionstätigkeit bezogen, schrieb er aber bereits während der langjährigen Entwicklungsphase des Flugzeuges, also lange bevor die ersten Flugzeuge wirklich flogen: "Ob nun dieses direkte Nachbilden des natürlichen Fluges (des Vogels) ein Weg von vielen oder der einzige ist, der zum Ziel führt, das bildet heute noch eine Streitfrage. Vielen Technikern erscheint beispielsweise die Flügelbewegung der Vögel zu schwer maschinell durchführbar, und sie wollen die im Wasser so liebgewonnene Schraube auch zur Fortbewegung in der Luft nicht missen" (Lilienthal,zit: Klemm, 1983,78) (Der Streit dauert an. Die kanadische Firma Battelle hat nach eigenen Angaben 1992 ein Patent für einen Flügelkippmechanismus angemeldet, mit welchem ein Ornithoper genanntes Flugzeug wie ein Vogel fliegen kann (Battelle today, zit. in: Tagesanzeiger, Zürich, 24.10.92, 88). LeonardodaVinci wollte den Streit auch nicht entscheiden. Neben technisch begründeten Beispielen musste auch der Flug des Vogels als Beweis dafür herhalten, dass seine konstruktiven Überlegungen zum Fliegen richtig waren: ”Mit einem (bewegten) Gegenstand übt man auf die Luft eine ebenso grosse Kraft aus wie die Luft auf diesen. Du siehst, wie die gegen die Luft geschwungenen Flügel dem schweren Adler ermöglichen, sich in der äusserst dünnen Luft nahe an der Sphäre des feurigen Elements zu halten. Weiter siehst du, wie die bewegte Luft über dem Meere das schwer beladene Schiff dahinziehen lässt, indem sie die geschwellten Segel stösst und zurückgeworfen wird” (Leonardo, zit: Klemm, 1983,79).). Sehr tiefschürfend konnte dieser Streit nicht gewesen sein, haben sich doch bislang immer die Ingenieure durchgesetzt, die die Natur nicht imitierten, sondern wie im Falle der "liebgewonnenen Schraube", die mittlerweile nur noch in der Luft Propeller heisst, ein Mittel erfunden haben, das dem gesetzten Zweck diente. Überdies gibt uns die Natur, wie man sich etwa anhand des Schiffes bewusst machen kann, für die meisten Produkte, die wir bauen, überhaupt keine Vorbilder. Schwimmen überhaupt war nie eine Motivation für Ingenieure, und wenn wir nur wie Vögel fliegen könnten, hätten wir ausser Spass nicht viel gewonnen.
". . .to design an aeroplane is nothing; to build an aeroplane is something; but to fly an aeroplane is EVERYTHING!"
Otto Lilienthal (1849-1896) war einer der ersten Flieger. Er machte darüber einige markante Aeusserungen.
• Eine eher sozialutopische Ansicht von ihm:
In einem Brief an den Sozialreformer Moritz von Egidy aus dem Jahr 1894 schwärmt Lilienthal aber trotzdem von den friedensstiftenden Möglichkeiten der Fliegerei. "Die Grenzen der Länder würden Ihre Bedeutung verlieren, weil sie sich nicht mehr absperren lassen. Die Landesverteidigung, weil zur Unmöglichkeit geworden, würde aufhören, die besten Kräfte der Staaten zu verschlingen, und das zwingende Bedürfnis, die Streitigkeiten der Nationen auf andere Weise zu schlichten als den blutigen Kämpfen um die imaginär gewordenen Grenzen, würde uns den ewigen Frieden verschaffen."
• eine bionische Vorstellung habe ich im Buch Technische Intelligenz analysiert:
"Die Produkte der Ingenieure imitieren nicht die Natur (Das Verstehen der Natur ist für Ingenieure, die an Performanz interessiert sind, ”nur insofern notwendig, als es diese erleichtern würde” (Weizenbaum,1978, 220f)). Unsere Flugzeuge imitieren im Unterschied zum schliesslich abgestürzten Ikarus keineswegs die Vögel (Während sich die Flugzeugingenieure heute konstruktiv nicht mehr so sehr um das Fliegen der Vögel kümmern und eindeutig im Performanzmodus arbeiten, arbeiten viele ihrer Kollegen in der KI-Forschung immer noch unter dem Simulationsmodus daran, wie sie was vom Menschen kopieren können (vgl. Weizenbaum, 1978,220f).). O. Lilienthal, einer der Erfinder des Flugzeuges, schrieb anfänglich irritiert durch die Metapher, die er mitbegründete: "Mit welcher Ruhe, mit welcher vollendeten Sicherheit, mit welchen überraschend einfachen Mitteln sehen wir den Vogel auf der Luft dahin- gleiten! Das sollte der Mensch mit seiner Intelligenz, mit seinen mechanischen Hilfskräften, die ihn bereits wahre Wunderwerke schaffen liessen, nicht auch fertigbringen? Und doch ist es schwierig, ausserordentlich schwierig, nur annähernd zu erreichen, was der Natur so spielend gelingt" (Lilienthal, zit: Klemm, 1983,177). Die in der nicht bewussten Metapher begründete Verwechslung ist offensichtlich. "Mit überraschend einfachen Mitteln auf der Luft dahingleiten" sehen wir natürlich nicht die Vögel, sondern die - wenn man überhaupt Vergleiche anstellen wollte - extrem primitiven Gleiter, die O. Lilienthal konstruiert hat. Auf die wirkliche Konstruktionstätigkeit bezogen, schrieb er aber bereits während der langjährigen Entwicklungsphase des Flugzeuges, also lange bevor die ersten Flugzeuge wirklich flogen: "Ob nun dieses direkte Nachbilden des natürlichen Fluges (des Vogels) ein Weg von vielen oder der einzige ist, der zum Ziel führt, das bildet heute noch eine Streitfrage. Vielen Technikern erscheint beispielsweise die Flügelbewegung der Vögel zu schwer maschinell durchführbar, und sie wollen die im Wasser so liebgewonnene Schraube auch zur Fortbewegung in der Luft nicht missen" (Lilienthal,zit: Klemm, 1983,78) (Der Streit dauert an. Die kanadische Firma Battelle hat nach eigenen Angaben 1992 ein Patent für einen Flügelkippmechanismus angemeldet, mit welchem ein Ornithoper genanntes Flugzeug wie ein Vogel fliegen kann (Battelle today, zit. in: Tagesanzeiger, Zürich, 24.10.92, 88). LeonardodaVinci wollte den Streit auch nicht entscheiden. Neben technisch begründeten Beispielen musste auch der Flug des Vogels als Beweis dafür herhalten, dass seine konstruktiven Überlegungen zum Fliegen richtig waren: ”Mit einem (bewegten) Gegenstand übt man auf die Luft eine ebenso grosse Kraft aus wie die Luft auf diesen. Du siehst, wie die gegen die Luft geschwungenen Flügel dem schweren Adler ermöglichen, sich in der äusserst dünnen Luft nahe an der Sphäre des feurigen Elements zu halten. Weiter siehst du, wie die bewegte Luft über dem Meere das schwer beladene Schiff dahinziehen lässt, indem sie die geschwellten Segel stösst und zurückgeworfen wird” (Leonardo, zit: Klemm, 1983,79).). Sehr tiefschürfend konnte dieser Streit nicht gewesen sein, haben sich doch bislang immer die Ingenieure durchgesetzt, die die Natur nicht imitierten, sondern wie im Falle der "liebgewonnenen Schraube", die mittlerweile nur noch in der Luft Propeller heisst, ein Mittel erfunden haben, das dem gesetzten Zweck diente. Überdies gibt uns die Natur, wie man sich etwa anhand des Schiffes bewusst machen kann, für die meisten Produkte, die wir bauen, überhaupt keine Vorbilder. Schwimmen überhaupt war nie eine Motivation für Ingenieure, und wenn wir nur wie Vögel fliegen könnten, hätten wir ausser Spass nicht viel gewonnen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Teilen - August 20, 2016
Homonym für sehr verschiedene Wortbedeutungen:
a) für in Teile zerlegen oder etwas als Teile von etwas auffassen
b) für gemeinsam nutzen
c) für Wissen teilen, mitteilen, vervielfältigen (etwa share im Facebook)
d) für Dividieren und andere Operationen wie Unterscheiden
Teilen hat entsprechend viele Vorsilben: mit-, zer-, ver-, zu-, ab-, auf-, ein-, um-, Ich behandle hier nicht alle Fälle, es geht mir mehr um Sprachkritik, in welcher ich mir meine Verwendungen des Wortes bewusst mache, weil ich umgangssprachlich ja auch von Arbeitsteilung rede.
Mit dem Verb teilen bezeichne ich sowohl das Aufteilen eines Aufwandes oder einer Ressource als auch ein gemeinsames Nutzen einer Ressource. Ich teile etwas auf, wenn ich die Sache zerteile und verteile, also wenn ich ein Ganzes zerlege und die Teile separiere, insbesondere an verschiedene Personen verteile. In diesem Sinne teile ich beispielsweise Kuchen mit anderen Menschen, indem ich den Kuchen zerteile und die Teile anderen Menschen schenke.
Bei dieser Art zu teilen sind die Ressource und die Teile gegenständlich. Wenn eine Person einen Teil besitzt, kann dieser Teil nicht auch von einer anderen Person besessen werden.
Ich teile den Aufwand mit anderen Personen, wenn diese sich entsprechend beteiligen. Oft wird dann auch der Ertrag geteilt. In diesem Sinne teile ich beispielsweise die Gartenarbeit mit meiner Frau, wobei wir dann auch das Gemüse zusammen essen, also wie Kuchen teilen. Bei dieser Art zu teilen bleibt offen, ob verschiedene Tätigkeiten oder die Menge des Aufwandes geteilt wird.
Ich teile etwas, wenn ich die Sache gemeinsam mit anderen Personen nutze. Die gemeinsame Nutzung hat einen räumlichen und einen zeitliche Aspekt. In diesem Sinne teile ich etwa einen Büroraum mit anderen Personen, die dann gleichzeitig denselben Raum benutzen. Ich teile aber auch etwa ein Fahrzeug, wenn dieses auch anderen Personen zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um ein zeitliches Teilen. Bei dieser Art zu teilen wird das relative Ganze geteilt, also beispielsweise das ganze Büro. Wenn wir einen Kuchen teilen, konsumiert nicht jeder den ganzen Kuchen, sondern jeder seinen ganzen Kuchenteil.
In Bezug auf das gemeinsamen Nutzen verliert das Teilen einen Teil des Wortsinnes, wenn die gemeinsame Nutzung wie etwa bei der innerbetriebliche Arbeitsteilung gesellschaftlich organisiert wird. Teilen kann als Aktivität des oder der Teilenden gesehen werden. Wenn aber die "Teilung" vorab von anderen vorgenommen wurde, sehe ich viel mehr eine fremdbestimmte Zuteilung.
Schliesslich verwende ich den Ausdruck teilen auch in einem ganz anderen Sinn, wo ich beispielsweise mein "Wissen" teile, also mitteile, was ich weiss. Bei dieser Art zu teilen wird nicht geteilt, es werden sozusagen Kopien verbreitet. Dabei wird der Aspekt des Schenkens hervorgehoben, weil diese Art des Teilens praktisch gratis ist. Ich verliere gar nichts und es kostest mich praktisch nichts, wenn ich Daten kopiere und sie anderen zur Verfügung stelle. Dabei wird allerdings ein Tauschgeschäftsmodell, in welchen Journalisten ihre Daten verbreiten, unterlaufen.
Und wenn ich Gemeinschaft und Gesellschaft dadurch unterscheide, dass in erstere geteilt und und letzter getausch wird, meine ich das Teilen natürlich in einem oikonomischen Sinn, der weniger mit gratis als mit einer Aufhebung des Schenkens zu tun hat.>
Ich teile etwas auf, wenn ich die Sache zerteile und verteile, also wenn ich ein Ganzes zerlege und die Teile separiere, insbesondere an verschiedene Personen verteile. In diesem Sinne teile ich beispielsweise Kuchen mit anderen Menschen, indem ich den Kuchen zerteile und die Teile anderen Menschen schenke.
Bei dieser Art zu teilen sind die Ressource und die Teile gegenständlich. Wenn eine Person einen Teil besitzt, kann dieser Teil nicht auch von einer anderen Person besessen werden.
Ich teile den Aufwand mit anderen Personen, wenn diese sich entsprechend beteiligen. Oft wird dann auch der Ertrag geteilt. In diesem Sinne teile ich beispielsweise die Gartenarbeit mit meiner Frau, wobei wir dann auch das Gemüse zusammen essen, also wie Kuchen teilen. Bei dieser Art zu teilen bleibt offen, ob verschiedene Tätigkeiten oder die Menge des Aufwandes geteilt wird.
Ich teile etwas, wenn ich die Sache gemeinsam mit anderen Personen nutze. Die gemeinsame Nutzung hat einen räumlichen und einen zeitliche Aspekt. In diesem Sinne teile ich etwa einen Büroraum mit anderen Personen, die dann gleichzeitig denselben Raum benutzen. Ich teile aber auch etwa ein Fahrzeug, wenn dieses auch anderen Personen zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um ein zeitliches Teilen. Bei dieser Art zu teilen wird das relative Ganze geteilt, also beispielsweise das ganze Büro. Wenn wir einen Kuchen teilen, konsumiert nicht jeder den ganzen Kuchen, sondern jeder seinen ganzen Kuchenteil.
In Bezug auf das gemeinsamen Nutzen verliert das Teilen einen Teil des Wortsinnes, wenn die gemeinsame Nutzung wie etwa bei der innerbetriebliche Arbeitsteilung gesellschaftlich organisiert wird. Teilen kann als Aktivität des oder der Teilenden gesehen werden. Wenn aber die "Teilung" vorab von anderen vorgenommen wurde, sehe ich viel mehr eine fremdbestimmte Zuteilung.
Schliesslich verwende ich den Ausdruck teilen auch in einem ganz anderen Sinn, wo ich beispielsweise mein "Wissen" teile, also mitteile, was ich weiss. Bei dieser Art zu teilen wird nicht geteilt, es werden sozusagen Kopien verbreitet. Dabei wird der Aspekt des Schenkens hervorgehoben, weil diese Art des Teilens praktisch gratis ist. Ich verliere gar nichts und es kostest mich praktisch nichts, wenn ich Daten kopiere und sie anderen zur Verfügung stelle. Dabei wird allerdings ein Tauschgeschäftsmodell, in welchen Journalisten ihre Daten verbreiten, unterlaufen.
Und wenn ich Gemeinschaft und Gesellschaft dadurch unterscheide, dass in erstere geteilt und und letzter getausch wird, meine ich das Teilen natürlich in einem oikonomischen Sinn, der weniger mit gratis als mit einer Aufhebung des Schenkens zu tun hat.>
[0 Kommentar]
Inhalt
Die Form der Kultur - August 5, 2016
D. Baecker hat 2003 einen Aufsatz "Die Form der Kultur" geschrieben, der mir ein paar Probleme bereitet, wenn ich ihn durch meine Brille lese:
D. Baecker entwickelt einen Kulturbegriff, in welchem er drei Begriffe, die sich gegenseiteig paralysierten, aufgehoben sieht. Er erkennt ein antike Kultur als Erziehung zum Wohl der Polis, und zwei moderne Kulturen, wobei die eine aus einem Kulturvergleich hervorgeht und die andere aus einer Abgrenzung des Technisch-Reationalen.
Den neuen - nicht ohne weiteres zitierbaren - Kulturbegriff entwickelt D. Baecker mittels der Form von G. Spencer-Brown. Als Nebenprodukt erscheint so eine Einführung dazu, wie Soziologen das Kalkül verwenden.
Kritik der Form-Ueberlegungen (zum Kulturverständnis liesse sich auch allerhand sagen, sage ich hier aber nichts):
D. Baecker schreibt, dass Wissenschaft auf Begriff/Gegenbegriff beruhe (was sehr interessant und viel plausibler als der Luhmann-Code wahr/nicht wahr ist). Dann schreibt er, dass die Wissenschaft in die Kriese gerate, wo sie keine Gegenbegriffe habe (was für mich extrem interessant ist, weil ich mir dazu keinen einzigen Fall vorstellen kann). Dann schreibt er "Kultur" sei ein Begriff ohne Gegenbegriff (was ich einfach nicht verstehen kann, weil ich Kultur als Gegenbegriff zu Natur sehe). D. Baecker schreibt, dass er Kultur durch den Formbegriff von G. Spencer-Brown verstehen wolle, der nicht auf Gegenbegriffen, sondern auf Differenzen beruhe. Er schreibt, dass im Materialismus Form und Materie Gegenbegriffe seien, während sein Formbegriff keinen Gegenbegriff habe (was ich nebenbei für einen extrem reduzierten Materialismus halte). Aber hier geht es um Form ohne Gegenbegriff (wobei mir unklar wird, was Gegenbebriff überhaupt heissen könnte).
Der Clou des von Spencer Brown entwickelten Kalküls besteht darin, daß er zur Aufnahme der Booleschen Algebra, zur Vermeidung des von Alfred North Whitehead und Bertrand Russell ausgesprochenen Sebstreferenzverbots und zur Einführung des Faktors Zeit in ein logisches Kalkül mit einer einzigen Operation, eben der Operation der Unterscheidung, und fünf Zeichen oder Werten auskommt: Innenseite der Unterscheidung („marked state“), Außenseite der Unterscheidung („unmarked state“), die Unterscheidung selbst („call“ beziehungsweise „cross“), das Gleichheitszeichen (interpretiert als „is confused with“) und ein Zeichen für die Wiedereinführung der Unterscheidung in den Raum der Unterscheidung („re-entry“).
D. Baecker verwendet dann (in der Luhmannschen Tradition) einen simplen Satz: Die Kultur macht einen Unterschied. Dann sagt er, dass die markierte Seite dieses Unterschiedes "Kultur" heisse. (Das ist eben die Autopoiese, in welcher sich bei H. Maturana ein Einzeller macht, indem der Einzeller etwas macht, was dann ein Einzeller ist - und (das ist der Hauptpunkt!) als Einzeller bezeichnet wird. (Die Argumentation verzichtet auf die Unterscheidung Zeichen/Referenzobjekt: sie tut (bei H. Maturana) so, als ob Einzeller oder Kulturen sich auch so benennen würden, und bei der D. Baecker so, als ob nur die Kommunikation existieren würde. Diese Abstraktion ist die Grundlage der Differenz ohne Gegenbegriff). Dann frägt D. Baecker aber nach "Zuständen", die die Markierung "Kultur" verdienen, allerdings um explizit betont nicht zu sagen, was mit Zuständen gemeint sein könnte (so dass diese Zustände obwohl markiert keinen Gegenbegriff darstellen (sollen)).
Die differenztheoretisch Fragen lauten dann: „welchen Unterschied macht die Kultur?“ und operational „wie macht sie diesen Unterschied?“
D. Baecker schreibt, dass er Kultur durch den Formbegriff von G. Spencer-Brown verstehen wolle, der nicht auf Gegenbegriffen, sondern auf Differenzen beruhe. Er schreibt, dass im Materialismus Form und Materie Gegenbegriffe seien, während sein Formbegriff keinen Gegenbegriff habe (was ich nebenbei für einen extrem reduzierten Materialismus halte). Aber hier geht es um Form ohne Gegenbegriff (wobei mir unklar wird, was Gegenbebriff überhaupt heissen könnte).
Der Clou des von Spencer Brown entwickelten Kalküls besteht darin, daß er zur Aufnahme der Booleschen Algebra, zur Vermeidung des von Alfred North Whitehead und Bertrand Russell ausgesprochenen Sebstreferenzverbots und zur Einführung des Faktors Zeit in ein logisches Kalkül mit einer einzigen Operation, eben der Operation der Unterscheidung, und fünf Zeichen oder Werten auskommt: Innenseite der Unterscheidung („marked state“), Außenseite der Unterscheidung („unmarked state“), die Unterscheidung selbst („call“ beziehungsweise „cross“), das Gleichheitszeichen (interpretiert als „is confused with“) und ein Zeichen für die Wiedereinführung der Unterscheidung in den Raum der Unterscheidung („re-entry“).
D. Baecker verwendet dann (in der Luhmannschen Tradition) einen simplen Satz: Die Kultur macht einen Unterschied. Dann sagt er, dass die markierte Seite dieses Unterschiedes "Kultur" heisse. (Das ist eben die Autopoiese, in welcher sich bei H. Maturana ein Einzeller macht, indem der Einzeller etwas macht, was dann ein Einzeller ist - und (das ist der Hauptpunkt!) als Einzeller bezeichnet wird. (Die Argumentation verzichtet auf die Unterscheidung Zeichen/Referenzobjekt: sie tut (bei H. Maturana) so, als ob Einzeller oder Kulturen sich auch so benennen würden, und bei der D. Baecker so, als ob nur die Kommunikation existieren würde. Diese Abstraktion ist die Grundlage der Differenz ohne Gegenbegriff). Dann frägt D. Baecker aber nach "Zuständen", die die Markierung "Kultur" verdienen, allerdings um explizit betont nicht zu sagen, was mit Zuständen gemeint sein könnte (so dass diese Zustände obwohl markiert keinen Gegenbegriff darstellen (sollen)).
Die differenztheoretisch Fragen lauten dann: „welchen Unterschied macht die Kultur?“ und operational „wie macht sie diesen Unterschied?“
[7 Kommentar]
Inhalt
Das Selbst im „Selbstverlag“ by Amazon - Juli 31, 2016
Die Buchproduktionsmittel haben sich im Laufe der Industriealisierung enorm entwickelt und ausdifferenziert. Der sagenhafte Gutenberg steht am Anfang dieser Entwicklung. Typischerweise war er kein Autor, er wollte nicht aus seinem Text ein Buch machen. Er wollte Bücher mit Texten machen, die er wohl für gut verkaufbar hielt. Dazu schuf er sich eine Manufaktur, die am Anfang der industriellen Ausdifferenzierung steht, aber bereits eine beachtlich innerbetriebliche Arbeitsteilung aufwies. Gutenberg war ein Kapitalist im besten Sinne des Wortes.
Die Besitzer von Buchproduktionsmitteln brauchen natürlich Texte um Bücher zu machen. Sie haben zwei Varianten der Textproduktion erkannt. Sie können Textproduzenten anstellen, wie es bei den Zeitungen üblich immer noch ist, oder Texte sozusagen als Halbfabrikate einkaufen. Im zweiten, für Buchproduzenten üblich gewordenen Fall hat sich die Verlagsinstitution aus differenziert. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verleger die Buchproduktionsmittel selbst besitzt oder diese ebenfalls mietet. Der Verleger vermietet die Buchproduktionsmittel nicht, er benutzt sie selbst. Er produziert Bücher mit Texten, die er auf Provisionsbasis mietet.
Als Autor habe ich deshalb die Möglichkeit entweder die Buchproduktionsmittel selbst zu mieten oder meinen Text einem Verleger auf Provisionsbasis zu vermieten. Weil die Verleger auf Provisionsbasis arbeiten, schätzen sie ab, mit welchen Texten sie Geld machen können. Sie werden so zu Gatekeeper im Sinne von K. Lewin, die entscheiden, welche Texte zu Büchern werden.
Die Verleger monopolisierten die hergebrachten Vertriebskanäle immer stärker, was ihnen die Macht gab, sich von unbekannten Autoren ihre Kosten als so genannten Druckkostenzuschuss bezahlen zu lassen, also das Provisionsgeschäft ohne Risiko zu betreiben.
Die technische Entwicklung brachte dann ein Buchproduktionsmittel auf den Markt, das unter der Bezeichnung Book on Demand bekannt wurde und den Autoren direkt vermietet wurde, weil die Buchproduktion erheblich billiger wurde. Diese Technik liess eine neue Art von Verlegern entstehen, die praktisch kein Handelsrisiko tragen und deshalb ihre Gatekeeperfunktion aufgegeben haben. Die klassischen Verleger machen sinnigerweise Propaganda gegen Verfahren, das ihnen viel Wasser abgräbt, indem sie suggerieren, dass Texte, die nicht von ihnen sanktioniert seien, nicht viel taugen. Aber das kümmert die neuen Verleger wenig, gerade weil sie finanziell nichts riskieren.
In der Übergangszeit bezeichneten sich aber auch die neuen Verleger als Verleger, weil sie vom vermeintlichen Renommee dieser Bezeichnung profitieren wollten. Da sie aufgrund der Interessenlage nicht glaubhaft machen konnten, das sie nicht jeden Text annehmen, haben sie die Qualität der Texte den Autoren zurückverantwortet. Sie haben den Selbstverleger erfunden. Sie vermieten die Buchproduktionsmittel also nicht den Autoren, sondern Verlegern, die für die Qualität der Texte zuständig sind.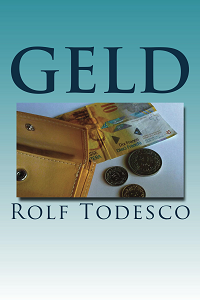 Die technische Entwicklung hat nun den letzten Schritt getan und diese neuen Verleger jeder Funktion enthoben. Wenn ich bei Amazon ein Buch herstelle, verwende ich eine Computerinfrastruktur, die mir Amazon gegen Provision zur Verfügung stellt. Amazon ist Besitzer der Buchproduktionsmittel, aber tritt nicht als Verleger auf, sondern als Vermieter ihrer Infrastruktur, die weit über alles hinausgeht, was sich Verleger je vorstellen konnten.
Bücher sind immer noch Bücher, "gebundenes" bedrucktes Papier, aber alle Vorstellungen, die das kapitalistische Verlagswesen - das sich keineswegs mit Büchern begründete - hervorgebracht hat, sind aufgehoben. Bücher bleiben Bücher, aber das Verlagswesen löst sich auf.
Die technische Entwicklung hat nun den letzten Schritt getan und diese neuen Verleger jeder Funktion enthoben. Wenn ich bei Amazon ein Buch herstelle, verwende ich eine Computerinfrastruktur, die mir Amazon gegen Provision zur Verfügung stellt. Amazon ist Besitzer der Buchproduktionsmittel, aber tritt nicht als Verleger auf, sondern als Vermieter ihrer Infrastruktur, die weit über alles hinausgeht, was sich Verleger je vorstellen konnten.
Bücher sind immer noch Bücher, "gebundenes" bedrucktes Papier, aber alle Vorstellungen, die das kapitalistische Verlagswesen - das sich keineswegs mit Büchern begründete - hervorgebracht hat, sind aufgehoben. Bücher bleiben Bücher, aber das Verlagswesen löst sich auf.
[0 Kommentar]
Inhalt
Der letzte Marxianer - Juni 30, 2016
Der letzte Mohikaner ist insofern eine Fiktion, als es Mohikaner nie gegeben hat; die mit dem Ausdruck bezeichneten Stämme aber heute noch Nachfahren haben, also  nicht ausgestorben sind. Der letzte Mohikaner bezeichnet in diesem Sinne nicht einen einzelnen Menschen, sondern viel mehr eine personalisierten Vertretung einer aussterbenden Haltung, die im Fallle des letzten Mohikaner in einer Art edlen Wildheit bestand. Im Krieg zwischen England und Frankreich um das freie Land, das die Mohikaner bewohnten, hat der letzte Mohikaner sein Leben in den Dienst der Eroberer dieses freien Landes gestellt. Er hat musste erkennen, dass sein Land nicht frei bleiben konnte ...
Der letzte Marxianer ist insofern eine Fiktion, als es eigentlich nur einen Marxianer gegeben hat, der sich gegen all die Marxisten, die ihm folgten, nie durchsetzen konnte. Anfänglich gab es unter den Marxisten noch ein paar Fraktionen, die sich auf den Kern der Theorie von K. Marx berufen haben, aber bald haben die Marxisten das Finanzkapital entdeckt, das bei K. Marx keine Rolle spielte, weil es gerade nicht durch Mehrwertabschöpfung von Lohnarbeit begründet wird. Der letzte Marxianer muss erkennen, dass sich die verbliebenen Marxisten wie die politischen Ökonomen nur noch für das Finanzkapital interessieren und dass es kaum mehrLohnarbeiter gibt, die sich als Lohnarbeiter sehen oder gar in der Lohnarbeit das Wesen jedes Kapitalismuses erkennen.
nicht ausgestorben sind. Der letzte Mohikaner bezeichnet in diesem Sinne nicht einen einzelnen Menschen, sondern viel mehr eine personalisierten Vertretung einer aussterbenden Haltung, die im Fallle des letzten Mohikaner in einer Art edlen Wildheit bestand. Im Krieg zwischen England und Frankreich um das freie Land, das die Mohikaner bewohnten, hat der letzte Mohikaner sein Leben in den Dienst der Eroberer dieses freien Landes gestellt. Er hat musste erkennen, dass sein Land nicht frei bleiben konnte ...
Der letzte Marxianer ist insofern eine Fiktion, als es eigentlich nur einen Marxianer gegeben hat, der sich gegen all die Marxisten, die ihm folgten, nie durchsetzen konnte. Anfänglich gab es unter den Marxisten noch ein paar Fraktionen, die sich auf den Kern der Theorie von K. Marx berufen haben, aber bald haben die Marxisten das Finanzkapital entdeckt, das bei K. Marx keine Rolle spielte, weil es gerade nicht durch Mehrwertabschöpfung von Lohnarbeit begründet wird. Der letzte Marxianer muss erkennen, dass sich die verbliebenen Marxisten wie die politischen Ökonomen nur noch für das Finanzkapital interessieren und dass es kaum mehrLohnarbeiter gibt, die sich als Lohnarbeiter sehen oder gar in der Lohnarbeit das Wesen jedes Kapitalismuses erkennen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Vertrauen - Juni 20, 2016
Als Vertrauen bezeichne ich eine spezifische Aufhebung eines impliziten Vertrages. Umgangssprachlich vertraue ich einem anderen Menschen, wenn ich unterstelle, dass er sich an unsere impliziten Abmachungen hält, mich also beispielsweise nicht anlügt. In einem übertragenen Sinn vertraue ich darauf, dass technische Geräte funktionieren. Dabei vertraue ich darauf, dass der Hersteller zu Rechenschaft gezogen würde. Und in einem metaphorischen Sinn vertraue ich auf Gott, etwa in dem Sinne, dass die Naturgesetze in Kraft bleiben, dass also morgen die Sonne wieder aufgehen wird.
Jeder Vertrag ersetzt Vertrauen. Aber bei jedem Vertrag muss ich darauf vertrauen, dass ich den Vertrag durchsetzen kann . Differenztheoretisch sehe ich damit Vertrauen als eine Differenz zwischen Vertrauen und Vertrag, wobei das Vertrauen auf der Seite des Vertrages als re-entry wieder erscheint, weil ich auch im Vertragsverhältnis vertrauen muss. Jeder Vertrag wird durch eine vertragsschützende Macht gedeckt, welcher ich in Form eines impliziten Vertrages vertraue. Im entfalteten Staat etwa vertraue ich darauf, dass meine Verträge durch die Verfassung geschützt werden, obwohl ich die Verfassung nie unterschrieben habe. Weil die Verfassung kein Vertrag ist, bezeichne ich sie differentiell als Gesellschaftsvertrag und leite daraus einen für mich verbindlichen impliziten Vertrag ab. Ich vertraue darauf, dass die Verfassung wie ein Vertrag durchgesetzt wird.
Mein Vertrauen in die Verfassung hat zwei Gründe. Zum einen rechne ich damit, dass meine individuellen Verletzungen des verfassten Rechts, wo sie angezeigt werden, bestraft werden. Wider besseres Wissen verallgemeinere ich diesen von mir
wahrgenommenen Tatbestand auf alle Subjekte der Verfassung, so dass sich die Verfassung quasi selbst durchsetzt. Eigentlich vertraue ich darauf, dass der Souverän die Verfassung schützt. Ich impliziere dabei einen Vertrag zwischen mir und dem Souverän, der oft als Menschenrechte bezeichnet wird. Weil dieser Vertrag nicht existiert, vertraue ich.
Die Standardtheorie zum Geld besagt, dass Geld hat keine materielle Wertbasis habe,  sondern auf einer kollektiven oder sozialen Vertrauenskonstruktion beruhe, weil es sich beim Geld eigentlich um Zahlungsverpflichtungen handle. Wenn mir jemand 20 Franken schuldet, habe ich dieser Theorie zufolge 20 Franken, wie wenn ich eine 20-Franken-Banknote habe, die ja auch keinen materiellen Wert repräsentiere. In solchen Theorien wird die Unterscheidung zwischen Geld und Giralgeld systematisch negiert. Geld erscheint so auch als sein Gegenteil, nämlich als Geld, das nicht nur keine materielle Basis hat, sondern gar nicht existiert, wenn mein Schuldner kein Geld hat.
Geld erscheint dabei als ein Vertrauen in Schuldscheine, die dann als Geld bezeichnet werden, wenn sie von einer Zentralbank in Form von Banknoten herausgegeben worden sind oder eben als Buchgeld in den Kontokorrenten von Geschäftsbanken stehen. Das sind die wesentlichen Fälle, die in der Währungsverfassung vorgesehen sind. Viele Vertreter solcher Geldheorien suggerieren, dass das Vertrauen in Geld einer sehr verbreiteten Wahnvorstellung entspreche, was eben deshalb funktioniere, weil diese Wahnvorstellung so verbreitet sei. Das halte ich für eine Wahnvorstellung.
Ich vertraue bei Geld wie bei jeder anderen Sache darauf, dass ich mein Recht, also meine legitimen Ansprüche geltend machen kann. Dabei unterscheide ich, ob ich eine Banknote besitze oder ob mir jemand etwas oder eine Banknote schuldig ist. Diese Fälle beruhen auf sehr verschiedenen Verträgen. Nur Idioten würden einer Banknote vertrauen oder gegebenfalls nicht mehr vertrauen. Welchen Vertrag könnte ich mit einer Banknote abschliessen? Eine Banknote repräsentiert kein Vertrauensverhältnis, sondern eine gesellschaftlich institutionalisierte Praxis, in welcher Tauschwert in Währungseinheiten ausgedrückt wird, wozu unter anderem Banknoten dienen. Diese gesellschaftliche Praxis hängt in keiner Weise davon ab, ob irgendjemand dem Geld vertraut - was immer das heissen sollte.
sondern auf einer kollektiven oder sozialen Vertrauenskonstruktion beruhe, weil es sich beim Geld eigentlich um Zahlungsverpflichtungen handle. Wenn mir jemand 20 Franken schuldet, habe ich dieser Theorie zufolge 20 Franken, wie wenn ich eine 20-Franken-Banknote habe, die ja auch keinen materiellen Wert repräsentiere. In solchen Theorien wird die Unterscheidung zwischen Geld und Giralgeld systematisch negiert. Geld erscheint so auch als sein Gegenteil, nämlich als Geld, das nicht nur keine materielle Basis hat, sondern gar nicht existiert, wenn mein Schuldner kein Geld hat.
Geld erscheint dabei als ein Vertrauen in Schuldscheine, die dann als Geld bezeichnet werden, wenn sie von einer Zentralbank in Form von Banknoten herausgegeben worden sind oder eben als Buchgeld in den Kontokorrenten von Geschäftsbanken stehen. Das sind die wesentlichen Fälle, die in der Währungsverfassung vorgesehen sind. Viele Vertreter solcher Geldheorien suggerieren, dass das Vertrauen in Geld einer sehr verbreiteten Wahnvorstellung entspreche, was eben deshalb funktioniere, weil diese Wahnvorstellung so verbreitet sei. Das halte ich für eine Wahnvorstellung.
Ich vertraue bei Geld wie bei jeder anderen Sache darauf, dass ich mein Recht, also meine legitimen Ansprüche geltend machen kann. Dabei unterscheide ich, ob ich eine Banknote besitze oder ob mir jemand etwas oder eine Banknote schuldig ist. Diese Fälle beruhen auf sehr verschiedenen Verträgen. Nur Idioten würden einer Banknote vertrauen oder gegebenfalls nicht mehr vertrauen. Welchen Vertrag könnte ich mit einer Banknote abschliessen? Eine Banknote repräsentiert kein Vertrauensverhältnis, sondern eine gesellschaftlich institutionalisierte Praxis, in welcher Tauschwert in Währungseinheiten ausgedrückt wird, wozu unter anderem Banknoten dienen. Diese gesellschaftliche Praxis hängt in keiner Weise davon ab, ob irgendjemand dem Geld vertraut - was immer das heissen sollte.
[0 Kommentar]
Inhalt
Nicht privates Eigentum - Juni 20, 2016
Nicht privates Eigentum beruht auf einer Inversion von Besitz. Privates Eigentum ist immer im Besitz des Eigentümers oder im Besitz eines Mieters. Die Inversion schreibt jedem Besitz einen Eigentümer zu. Als Besitz gilt dabei ein verfasstes Verfügungsrecht, das ohne Eigentumsverhältnisse nicht denkbar ist.
Wenn beispielsweise sogenannte indigene Völker Teile des Amazonasgebietes  besitzen, fungieren sie einen Staat, durch dessen Verfassung sie als Besitzer erscheinen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie diesen Staat selbst gründen oder ob sie ihren Besitz innerhalb eines ihnen übergeordneten Staates erlangen. In beiden Fällen erscheint ein naturwüchsiger Eigentümer.
Wenn Bündnisse europäischer Städte Besitzverhältnisse im Amazonasgebiet anerkennen oder gar durchsetzen, treten sie als militärische Aneignungsmächte auf, die Eigentum begründen. Eigentum ist aber in all diesen Fällen die fiktive Legitimation der jeweiligen Besitzverhältnisse, weil solches Eigentum niemandem gehört, wie etwa die Strassen einer Kommune, die in keiner Buchhaltung als Vermögen erscheinen.
Nicht privates Eigentum ist Utopie und sehr oft Ideologie.
besitzen, fungieren sie einen Staat, durch dessen Verfassung sie als Besitzer erscheinen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie diesen Staat selbst gründen oder ob sie ihren Besitz innerhalb eines ihnen übergeordneten Staates erlangen. In beiden Fällen erscheint ein naturwüchsiger Eigentümer.
Wenn Bündnisse europäischer Städte Besitzverhältnisse im Amazonasgebiet anerkennen oder gar durchsetzen, treten sie als militärische Aneignungsmächte auf, die Eigentum begründen. Eigentum ist aber in all diesen Fällen die fiktive Legitimation der jeweiligen Besitzverhältnisse, weil solches Eigentum niemandem gehört, wie etwa die Strassen einer Kommune, die in keiner Buchhaltung als Vermögen erscheinen.
Nicht privates Eigentum ist Utopie und sehr oft Ideologie.
[0 Kommentar]
Inhalt
Was ist ein Buch? (nochmals) - Juni 16, 2016
wegen der Kommentare wiederholt
[0 Kommentar]
Inhalt
Was ist ein Buch? - Juni 12, 2016
Ich habe heute beschlossen, mit meinem Text über Geld - so wie er jetzt gerade ist - ein Buch zu machen. Es handelt sich um einen Text, an welchem ich während mehreren Jahren immer wieder mal geschrieben habe. Ich könnte das ohne weiteres weiterhin tun. Wenn ich mit meinem Text über Geld - so wie er jetzt gerade ist - ein Buch mache, heisst das vor allem, das ich den Text so stehen lasse. Das hat etwas damit zu tun, dass ich immer mehr Sätze und Abschnitte im Text stehen lasse und immer weniger neue Zeichen einfüge. Das Schriftumstellen verliert seine Motivation.
Verkürzt sage ich dann, dass ich ein Buch geschrieben habe. Aber Bücher werden natürlich nicht geschrieben, sondern beispielsweise  aus bedrucktem Papier gebunden. Was im Buch geschrieben steht, ist für dessen Buchsein unerheblich, beliebig und gleichgültig. Dass ich ein Buch in den Händen habe, sehe ich lange vor jedem Wort in diesem Buch.
Tautologischerweise sage ich also, dass ich einen Text geschrieben habe. Als Schreiben bezeichne ich das Herstellen von Text, also ist jeder Text geschrieben. Als Text ist mein Werkstück zu jeder Zeit eine linear angeordnete Menge von Zeichen, was mit einem Buch gar nichts zu tun hat. Das Herstellen des Textes besteht nicht nur im Anfügen weiterer Zeichen, sondern in einem fortgesetzten Umformen des bereits vorhandenen Textes. Solange ich an einem Text schreibe, verändert sich nicht nur dessen Länge, sondern auch dessen Struktur.
Man könnte fragen, was im Buch stehe. Man kann aber auch das Buch anschauen. Im Buch ist der Text in einem Zustand konserviert. Im Buch ist das Schreiben aufgehoben. Ein Buch zu machen, heisst den Prozess abzubrechen. Na ja, ich kann ja einen Baum pflanzen oder noch ein Buch schreiben ...
PS Derrida schreibt in "Maschinen Papier" (S. 20) auch dass das tithemi in biblio-theke auf das setzen, stellen legen hinweist ("etwas einer stabilisierenden Unbewglichkeit anvertrauen") und dass biblion nicht erst Buch heisst, sondern anfang auch schon die materielle Unterlage bezeichnet auf die geschrieben wird, also die Papyrosrolle.
PSPS N. Luhmann hat F. Kittler einmal vorgeworfen, dass er sich nicht für den Inhalt der Bücher, sondern für deren Buchsein interessiere. F. Kittler hat geantwortet, dass es es ohne Bücher ja auch keine Buchinhlte geben würde
aus bedrucktem Papier gebunden. Was im Buch geschrieben steht, ist für dessen Buchsein unerheblich, beliebig und gleichgültig. Dass ich ein Buch in den Händen habe, sehe ich lange vor jedem Wort in diesem Buch.
Tautologischerweise sage ich also, dass ich einen Text geschrieben habe. Als Schreiben bezeichne ich das Herstellen von Text, also ist jeder Text geschrieben. Als Text ist mein Werkstück zu jeder Zeit eine linear angeordnete Menge von Zeichen, was mit einem Buch gar nichts zu tun hat. Das Herstellen des Textes besteht nicht nur im Anfügen weiterer Zeichen, sondern in einem fortgesetzten Umformen des bereits vorhandenen Textes. Solange ich an einem Text schreibe, verändert sich nicht nur dessen Länge, sondern auch dessen Struktur.
Man könnte fragen, was im Buch stehe. Man kann aber auch das Buch anschauen. Im Buch ist der Text in einem Zustand konserviert. Im Buch ist das Schreiben aufgehoben. Ein Buch zu machen, heisst den Prozess abzubrechen. Na ja, ich kann ja einen Baum pflanzen oder noch ein Buch schreiben ...
PS Derrida schreibt in "Maschinen Papier" (S. 20) auch dass das tithemi in biblio-theke auf das setzen, stellen legen hinweist ("etwas einer stabilisierenden Unbewglichkeit anvertrauen") und dass biblion nicht erst Buch heisst, sondern anfang auch schon die materielle Unterlage bezeichnet auf die geschrieben wird, also die Papyrosrolle.
PSPS N. Luhmann hat F. Kittler einmal vorgeworfen, dass er sich nicht für den Inhalt der Bücher, sondern für deren Buchsein interessiere. F. Kittler hat geantwortet, dass es es ohne Bücher ja auch keine Buchinhlte geben würde
[0 Kommentar]
Inhalt
Spielen - Mai 11, 2016/small>
Als bezeichne ich ein Verhalten, in welchem ich keine fremdreferentiellen Zwecke erkennen kann. Wenn ich spiele, verfolge ich in diesem Sinne keine Absicht jenseits des Spieles, insbesondere auch keine Erholung oder Ablenkung und dergleichen ("Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt" (F. Schiller: Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. In: WW (Nationalausgabe) XX, pp. 309ff - 15. Brief, S. 359).
"Spiel" dient mir als Handlungszusammenhang: Bestimmte Verhaltensweisen kann ich als Spielen deuten.
Ich unterscheide zwei Arten den Spielens, ein eigentliches, kindliches, unreflektiertes Spielen und ein Spielen, in welchem Regeln reflektiert werden, die als Spiel aufgefasst werden können. Differenztheoretisch: Ich kann spielen oder ein Spiel spielen.
Spiele sind durch Settings wie Spielfeld, Figuren, usw. und Regeln bestimmt.
Ich unterscheide Prozess- und Ergebnisspiele. Im Ergebnisspiel wird das Ergebnis 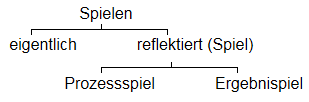 zum Zweck des Spieles, was das Spiel aufhebt (Pseudospiel). Varianten des Ergebnisspiels sind das Vorspielen (statt spielen) etwa von Musik (das Anerkennung bringen soll), das Rollenspiel (das Erkenntnis bringen soll), das Glücksspiel (das Geld bringen soll).
Bestimmte Ergebnisspiele werden in der Spieltheorie (das ist ein Eigenname, der für etwas anderes steht, als für "Theorie des Spiels") beschrieben. Diese "Spiele" beruhen auf einem eigenständigen, formalen Spielbegriff, der vielmehr mit Kriegsspiel als mit eigentlichem Spielen und mit Prozessspielen zu tun hat.
zum Zweck des Spieles, was das Spiel aufhebt (Pseudospiel). Varianten des Ergebnisspiels sind das Vorspielen (statt spielen) etwa von Musik (das Anerkennung bringen soll), das Rollenspiel (das Erkenntnis bringen soll), das Glücksspiel (das Geld bringen soll).
Bestimmte Ergebnisspiele werden in der Spieltheorie (das ist ein Eigenname, der für etwas anderes steht, als für "Theorie des Spiels") beschrieben. Diese "Spiele" beruhen auf einem eigenständigen, formalen Spielbegriff, der vielmehr mit Kriegsspiel als mit eigentlichem Spielen und mit Prozessspielen zu tun hat. Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen einem Spiel und der Wirklichkeit ("Das Gegenteil von Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit (S. Freud); Das Leben ist ein Spiel (Volksmund)). Ich unterscheide zwischen Spiel und Wirklichkeit und problematisiere die Wirklichkeit als Spiel. Im Spiel mache ich das gleiche wie in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit spiele ich ein Spiel, beispielsweise Rollen.
Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen Prozess-Spiel und Ergebnis-Spiel. Ich kann im Ergebnisspiel Punkte zählen, damit das Spiel "funktioniert". Ich fahre beispielsweise Motorad und schaue dabei auf die Rundenzeit (Ergebnis), obwohl mich diese Zeit im Sinne des Wettbewerbes nicht interessiert. Ich verwende diese Zeit als externes Kriterium zur Kritik meines Gefühls dafür, ob die Fahrt gelungen ist.
Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen einem Spiel und der Wirklichkeit ("Das Gegenteil von Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit (S. Freud); Das Leben ist ein Spiel (Volksmund)). Ich unterscheide zwischen Spiel und Wirklichkeit und problematisiere die Wirklichkeit als Spiel. Im Spiel mache ich das gleiche wie in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit spiele ich ein Spiel, beispielsweise Rollen.
Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen Prozess-Spiel und Ergebnis-Spiel. Ich kann im Ergebnisspiel Punkte zählen, damit das Spiel "funktioniert". Ich fahre beispielsweise Motorad und schaue dabei auf die Rundenzeit (Ergebnis), obwohl mich diese Zeit im Sinne des Wettbewerbes nicht interessiert. Ich verwende diese Zeit als externes Kriterium zur Kritik meines Gefühls dafür, ob die Fahrt gelungen ist.
[8 Kommentar]
Inhalt
Sozialdemokraten auf dem Abstellgleis - Mai 10, 2016
H. Flassbeck sagt den Sozialdemokraten, wie sie sich auf das Abstellgleis manövrierten. Seine These ist, dass die Sozialdemokraten sich zum Neoliberalismus bekennen, weil sie keine Alternative dazu kennen.
Man könnte bedenken, dass sich die Gegner der Sozialdemokraten auch zum 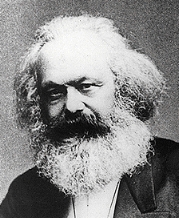 Neoliberalismus bekennen, ob sie nun Alternativen kennen oder nicht. Und wo die Sozialdemokraten Stimmen verlieren - egal wie viele - werden diese Stimmen von bekennenden Neoliberalen gwonnen, weil es gar keine andere Parteien gibt.
Man könnte meinen - und H. Flassbeck tut das offenbar, obwohl oder weil er sich nicht als Sozialdemokrat outet -, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten Erfolg hätten, wenn sie keine Neoliberale wären.
Parteien aber, die keine Neoliberale sind, wären wohl Kommunisten, aber solche Parteien gibt es nicht, nicht einmal im heutigen Griechenland, wo sich die SYRIZA sofort auflöste, als sie gewählt wurde. Es gibt aber viele Berater wie H. Flassbeck, die sehr genau wüssten, was eine Partei tun müsste. Nur scheinen die Parteien keine Berater zu brauchen, sie haben ja Führer, die dann und wann abtreten - wie heute in Österreich und morgen in Deutschland.
Neoliberalismus bekennen, ob sie nun Alternativen kennen oder nicht. Und wo die Sozialdemokraten Stimmen verlieren - egal wie viele - werden diese Stimmen von bekennenden Neoliberalen gwonnen, weil es gar keine andere Parteien gibt.
Man könnte meinen - und H. Flassbeck tut das offenbar, obwohl oder weil er sich nicht als Sozialdemokrat outet -, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten Erfolg hätten, wenn sie keine Neoliberale wären.
Parteien aber, die keine Neoliberale sind, wären wohl Kommunisten, aber solche Parteien gibt es nicht, nicht einmal im heutigen Griechenland, wo sich die SYRIZA sofort auflöste, als sie gewählt wurde. Es gibt aber viele Berater wie H. Flassbeck, die sehr genau wüssten, was eine Partei tun müsste. Nur scheinen die Parteien keine Berater zu brauchen, sie haben ja Führer, die dann und wann abtreten - wie heute in Österreich und morgen in Deutschland.
[0 Kommentar]
Inhalt - weiter
 oder Giftgas. Das ist alles Ausland für ihn. Dagegen geht es ihm seinen Aussagen nach darum, im Inland wichtige Freunde zu gewinnen und zu binden. Und wer wäre ein gewichtigerer Freund als die Rüstungsindustrie, deren Werbeträger Armee so schöne Tomahawk Raktetenbilder in die Qualitätsmedien liefert?
Hr. Trump bleibt sich und seinen Wahlversprechen treu - und unsere Qualitätsmedien tun das eben auch.
oder Giftgas. Das ist alles Ausland für ihn. Dagegen geht es ihm seinen Aussagen nach darum, im Inland wichtige Freunde zu gewinnen und zu binden. Und wer wäre ein gewichtigerer Freund als die Rüstungsindustrie, deren Werbeträger Armee so schöne Tomahawk Raktetenbilder in die Qualitätsmedien liefert?
Hr. Trump bleibt sich und seinen Wahlversprechen treu - und unsere Qualitätsmedien tun das eben auch.
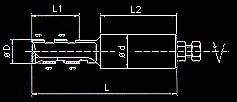 interpretiere. Der typische Fall dafür ist der Konstruktionsplan, der mir zeigt, was ich wie herstellen muss. Der anweisende Plan ist ein Teil eines Konzepts, in welchem die herstellende Tätigkeit so zerlegt wird, dass zunächst - allenfalls arbeitsteilig - eine Zeichnung hergestellt wird.
Als (Nacher)-Plan bezeichne ich eine Abbildung, die ich als Orientierungshilfe verwende. Der typische Fall dafür ist der Stadtplan, der mir zeigt, wie die Stadt gebaut wurde. Der Stadtplan wird normalerweise gezeichnet, nachdem die Stadt gebaut ist, während der Konstruktionsplan einer Maschine normalerweise gezeichnet wird, bevor die Maschine hergestellt wird. Als Abbildung ist der Plan logisch-genetisch aber immer später als das Referenzobjektes des Plans. Auch im Konstruktionsplan zeichne ich eine Maschine, die ich vor meinem geistigen Auge sehen kann.
interpretiere. Der typische Fall dafür ist der Konstruktionsplan, der mir zeigt, was ich wie herstellen muss. Der anweisende Plan ist ein Teil eines Konzepts, in welchem die herstellende Tätigkeit so zerlegt wird, dass zunächst - allenfalls arbeitsteilig - eine Zeichnung hergestellt wird.
Als (Nacher)-Plan bezeichne ich eine Abbildung, die ich als Orientierungshilfe verwende. Der typische Fall dafür ist der Stadtplan, der mir zeigt, wie die Stadt gebaut wurde. Der Stadtplan wird normalerweise gezeichnet, nachdem die Stadt gebaut ist, während der Konstruktionsplan einer Maschine normalerweise gezeichnet wird, bevor die Maschine hergestellt wird. Als Abbildung ist der Plan logisch-genetisch aber immer später als das Referenzobjektes des Plans. Auch im Konstruktionsplan zeichne ich eine Maschine, die ich vor meinem geistigen Auge sehen kann. Der operative Zweck des Plans ist in beiden Fällen derselbe. Er lässt sich aber anhand des Stadtplanes unmittelbarer veranschaulichen. Wenn ich dem Stadtplan lese, folge ich mit meinen Augen den Strassen, die mich interessieren. Ich mache dabei mit den Augen die Bewegungen, die ich dann mit meinem Füssen mache, wenn ich durch die die entsprechenden Strassen gehe. Der Stadtplan erfüllt seine Funktion, weil ich die Beziehung zwischen dem Weg meiner Augen und dem Weg meiner Füsse in mir erzeugen kann.
Der operative Zweck des Plans ist in beiden Fällen derselbe. Er lässt sich aber anhand des Stadtplanes unmittelbarer veranschaulichen. Wenn ich dem Stadtplan lese, folge ich mit meinen Augen den Strassen, die mich interessieren. Ich mache dabei mit den Augen die Bewegungen, die ich dann mit meinem Füssen mache, wenn ich durch die die entsprechenden Strassen gehe. Der Stadtplan erfüllt seine Funktion, weil ich die Beziehung zwischen dem Weg meiner Augen und dem Weg meiner Füsse in mir erzeugen kann.
 ich die
ich die  Roboter besitzen und deshalb ihr Kapital vergrössern (können) und jene, die ke
Roboter besitzen und deshalb ihr Kapital vergrössern (können) und jene, die ke Mir geht es hier darum, den je eigenen Begriff von Metapher zu erläutern, weil ich das
Gefühl habe, dass es dazu ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Meiner Erfahrung nach ist es praktisch und sinnvoll, wenn ich mich jeweils auf eine explizite Vorstellung beziehen kann. Die Klärung, was ich als Metapher bezeichne, dient dann auch dazu, welche Probleme ich mit Metaphern verbinde. Wer Metapher anders versteht, mag dann auch andere Probleme sehen.
Ich beginne mit einem alltäglichen Beispiel. Ich kann
Mir geht es hier darum, den je eigenen Begriff von Metapher zu erläutern, weil ich das
Gefühl habe, dass es dazu ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Meiner Erfahrung nach ist es praktisch und sinnvoll, wenn ich mich jeweils auf eine explizite Vorstellung beziehen kann. Die Klärung, was ich als Metapher bezeichne, dient dann auch dazu, welche Probleme ich mit Metaphern verbinde. Wer Metapher anders versteht, mag dann auch andere Probleme sehen.
Ich beginne mit einem alltäglichen Beispiel. Ich kann  zu jemandem sagen: "Du bist ein Esel", und wenn er kein Esel ist, versteht er mich. Ich benutze im umgangssprachlichen Sinn eine Metapher, wenn ich von einem Menschen sage, er sei ein Esel, weil der Ausdruck "Esel" Eigenschaften des jeweiligen Menschen unterstellen, die von einem anderen Referenzobjektes des Ausdruckes "übertragen" werden. Metapher steht lax gesprochen für "uneigentliche Wortverwendung". Ein Mensch ist ja - im eigentlichen Sinn des Wortes - kein Esel. Uneigentliche Wortverwendung bedeutet, dass ich ein Wort nicht so verwende, wie ich es eigentlich verwenden sollte. Wobei natürlich unausgesprochen mitschwingt, dass jemand - auch für mich weiss - wie ich das Wort eigentlich verwenden sollte.
Ich gebe ein zweites Beispiel: Ich kann zu jemandem sagen, der auf einer Bank sitzt: "Bring Dein Geld auf die Bank". Und wenn er kein Esel ist, versteht er, dass ich nicht meine, er solle sein Geld auf die Sitzbank legen, auf welcher er gerade sitzt. Bank ist in diesem Fall keine Metapher, sondern ein Homonym. Als Homonym bezeichne ich einen Ausdruck, für den in derselben (Einzel)-Sprache verschiedene Vereinbarungen oder Wortbedeutungen gelten. Der Ausdruck "Bank" steht in diesem Sinn als arbiträr oder zufällig gewählte Buchstabenkette für ein Sitzmöbel und für eine Finanzinstitution. Ich muss in jedem Fall durch den Kontext erkennen, was gerade gemeint ist.
Dass es
zu jemandem sagen: "Du bist ein Esel", und wenn er kein Esel ist, versteht er mich. Ich benutze im umgangssprachlichen Sinn eine Metapher, wenn ich von einem Menschen sage, er sei ein Esel, weil der Ausdruck "Esel" Eigenschaften des jeweiligen Menschen unterstellen, die von einem anderen Referenzobjektes des Ausdruckes "übertragen" werden. Metapher steht lax gesprochen für "uneigentliche Wortverwendung". Ein Mensch ist ja - im eigentlichen Sinn des Wortes - kein Esel. Uneigentliche Wortverwendung bedeutet, dass ich ein Wort nicht so verwende, wie ich es eigentlich verwenden sollte. Wobei natürlich unausgesprochen mitschwingt, dass jemand - auch für mich weiss - wie ich das Wort eigentlich verwenden sollte.
Ich gebe ein zweites Beispiel: Ich kann zu jemandem sagen, der auf einer Bank sitzt: "Bring Dein Geld auf die Bank". Und wenn er kein Esel ist, versteht er, dass ich nicht meine, er solle sein Geld auf die Sitzbank legen, auf welcher er gerade sitzt. Bank ist in diesem Fall keine Metapher, sondern ein Homonym. Als Homonym bezeichne ich einen Ausdruck, für den in derselben (Einzel)-Sprache verschiedene Vereinbarungen oder Wortbedeutungen gelten. Der Ausdruck "Bank" steht in diesem Sinn als arbiträr oder zufällig gewählte Buchstabenkette für ein Sitzmöbel und für eine Finanzinstitution. Ich muss in jedem Fall durch den Kontext erkennen, was gerade gemeint ist.
Dass es  Ich habe eine 20-Franken-Banknote in der Hand und denke darüber nach mich, wem sie eigentlich gehört und woher sie kommt.
Von allen Differenzierung zwischen
Ich habe eine 20-Franken-Banknote in der Hand und denke darüber nach mich, wem sie eigentlich gehört und woher sie kommt.
Von allen Differenzierung zwischen 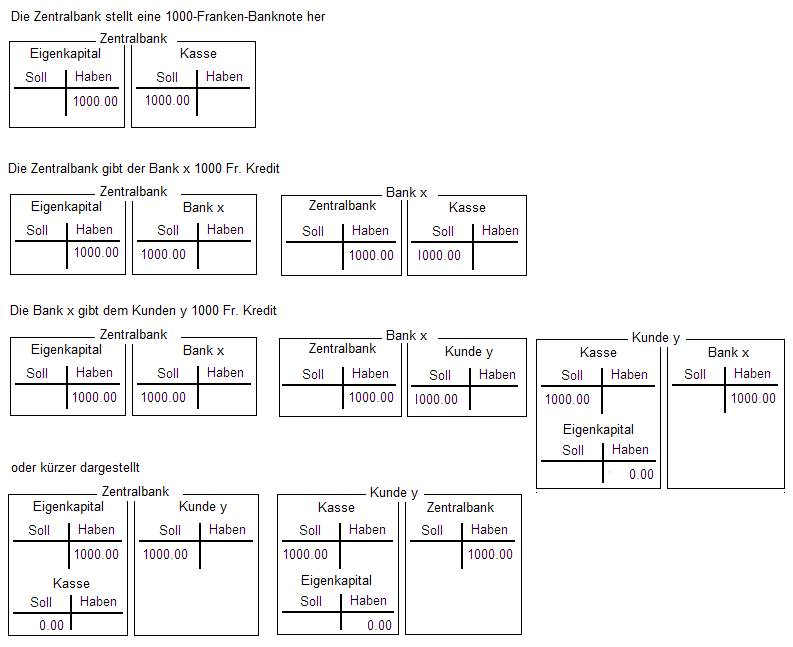 Nicht nur, was Geld ist, wird durch die Währung festgestellt, sondern auch, wem es gehört. Die Währung aber widerspiegelt einfach die Machtverhältnisse, in welchen das jeweilige Geld verwendet wird. Wenn die politische Ökonomie also behauptet, dass Geld Schulden seien, dann hat sie in Bezug auf bestimmtes Geld recht, aber natürlich nicht in Bezug auf Geld überhaupt. Geld an sich war eine sehr sinnvolle Sache, nur Geld von privaten Banken und privaten Zentralbanken verweist auf unmenschliche gesellschaftliche Verhältnisse.
Hier habe ich nur den einfachsten Fall von Geld, nämlich die Banknote behandelt. Die Banknote ist aber unabhängig davon, ob sogenanntes Bargeld verboten wird oder nicht, am Aussterben. In unserer Gesellschaft brauchen wir kein Geld mehr, weil wir auch alles mit Giralgeld finanzieren können. Und weil unser Geld ohnehin auch als Schuld gehandelt wird, spielt es innerhalb der aktuellen Verhältnisse keine Rolle, ob wir Giralgeld verwenden. Aber auch in Bezug auf Giralgeld kann ich natürlich darüber nachdenken, wem es gehört und woher es kommt. Ich kann es nur nicht in die Hände nehmen. (Fortsetzung folgt)
Nicht nur, was Geld ist, wird durch die Währung festgestellt, sondern auch, wem es gehört. Die Währung aber widerspiegelt einfach die Machtverhältnisse, in welchen das jeweilige Geld verwendet wird. Wenn die politische Ökonomie also behauptet, dass Geld Schulden seien, dann hat sie in Bezug auf bestimmtes Geld recht, aber natürlich nicht in Bezug auf Geld überhaupt. Geld an sich war eine sehr sinnvolle Sache, nur Geld von privaten Banken und privaten Zentralbanken verweist auf unmenschliche gesellschaftliche Verhältnisse.
Hier habe ich nur den einfachsten Fall von Geld, nämlich die Banknote behandelt. Die Banknote ist aber unabhängig davon, ob sogenanntes Bargeld verboten wird oder nicht, am Aussterben. In unserer Gesellschaft brauchen wir kein Geld mehr, weil wir auch alles mit Giralgeld finanzieren können. Und weil unser Geld ohnehin auch als Schuld gehandelt wird, spielt es innerhalb der aktuellen Verhältnisse keine Rolle, ob wir Giralgeld verwenden. Aber auch in Bezug auf Giralgeld kann ich natürlich darüber nachdenken, wem es gehört und woher es kommt. Ich kann es nur nicht in die Hände nehmen. (Fortsetzung folgt)
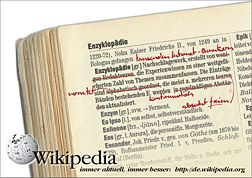 werden kann. Anfänglich versuchten die etablierten Verlage das Wissen aus der Wikipedia diskreditieren. Nachdem der Inhalt der Wikipedia rasch nicht mehr vom Inhalt vom Brockhaus unterschieden werden konnte, wurde immer klarer, was das Wissen der konventionellen Lexika war: ein Sammelsurium, dessen einzige Ordnung in der alphabetischen Anordnung der Stichworte lag. Als Lexikon ist die Wikipedia so gut oder schlecht wie jedes andere Lexikon.
Die Wikipedia kann aber auch als
werden kann. Anfänglich versuchten die etablierten Verlage das Wissen aus der Wikipedia diskreditieren. Nachdem der Inhalt der Wikipedia rasch nicht mehr vom Inhalt vom Brockhaus unterschieden werden konnte, wurde immer klarer, was das Wissen der konventionellen Lexika war: ein Sammelsurium, dessen einzige Ordnung in der alphabetischen Anordnung der Stichworte lag. Als Lexikon ist die Wikipedia so gut oder schlecht wie jedes andere Lexikon.
Die Wikipedia kann aber auch als  Ihr Herr Direktor, der mich freundlicherweise eingeladen hat, sagte mir zunächst, Sie hätten gerne 10 Kriterien zum TeamTeaching, die Sie bei Ihren Projekten berücksichtigen könn(t)en. Auf meine Nachfrage hin, sagte er, dass sich Ihre Diskussion häufig dahin verlaufe, dass man die Schauspielerei eigentlich nicht lehren könne, was irgendwie wahr, aber für eine Schauspiel-Akademie naheliegenderweise auch irgendwie unbefriedigend sei. So ungefähr wissen wir also, was unser Thema ist, und wir wissen relativ gut, zu welchen irgendwie unbefriedigenden Schlüssen wir nicht kommen wollen.
Ich frage mich zunächst, wie die Kompetenzen zu unserem Thema in unserem Kreise liegen. Ich frage mich, was jeder von uns hier von den andern lernen könnte? Meiner Erfahrung nach ist diese Frage konstitutiv für jedes gemeinsame Lernen. Wenn ich mit angehenden Schauspielern zusammen die Schauspielerei lernen wollte, würde ich mich nichts anderes fragen, als was ich jetzt mit Ihnen zusammen erörtern möchte.
Wenn nämlich ein junger Mensch sich in einer Schauspielakademie meldet, dann weiss er unerhört viel über die Schauspielerei, sonst käme er ja gar nicht auf die Idee, in diese Ausbildung zu kommen. Die Frage ist, was er wie weiss. Und Sie wissen über Ihre Arbeit hier natürlich auch unerhört viel. Und dafür interessiere ich mich jetzt, weil Sie mich eingeladen haben, mich mit Ihrer Aufgabe auseinanderzusetzen, respektive mich mit Ihnen über Ihre Aufgabe zusammenzusetzen.
2. Das Team
Ich schlage Ihnen also "Teamarbeit" vor. Den Ausdruck "Team" verwende ich allerdings nur, weil Herr Danzeisen das vorgeschlagen hat. Der Ausdruck Team suggeriert ein gemeinsames Ziel. Das will ich im Laufe meiner Vorstellung etwas relativieren.
Und den Ausdruck "Teaching" will ich gar nicht mehr verwenden, weil ich mit "Teaching" Erziehung und Lehren, also Ziehen und Belehren verbinde. Wo ich Be-Lehrern begegnet bin, habe ich innerlich immer den bekannte Schlager "We dont need no education, we dont need no thougth controll ...." gesungen.
Wenn ich hier und jetzt kein Teacher bin, was bin ich denn dann?
3. Vorstellung statt Teaching
Ich gebe Ihnen eine Vorstellung. Ich gebe Ihnen eine Vorstellung meiner Vorstellung. Und dabei, also in bezug auf die Vorstellung fühle ich mich hier an der Schauspielakademie natürlich in der Höhle der Löwen. Ich schlage Ihnen vor, meinen Beitrag unter den Gesichtspunkten einer Vorstellung zu betrachten. Wenn wir uns mit der Ausbildung von Schauspielern beschäftigen, scheint mir dies eine adäquate Form.
Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns über Vorstellungen unterhalten, über unsere Vorstellungen über das, was wir in unseren Vorstellungen tun. Wenn Sie meiner Einladung folgen, sitzen wir jetzt nicht mehr in einem Schulzimmer, sondern im Theater. Wir sind mitten drin in den Vorstellungen.
Ich will Ihnen etwas vormachen anstelle von etwas beibringen. Ich habe immer dort am meisten gelernt, wo ich von der Vorstellung, von der Performance beeindruckt war. Wenn jemand etwas kann, ist das für mich ansteckend, dann will ich das auch lernen.
4. Performance
Ich fasse meine jetztige Tätigkeit hier in diesem Theater als Kunst auf, das heisst praktische Erwägungen gelten mir im hegelschen Sinne aufgehoben. Als Lehrer würde ich Ihnen sagen, was Sie machen sollen und was Sie falsch machen. Ich würde Sie über Sie belehren. Als Künstler mache ich keine Mitteilungen, als Künstler suche ich den richtigen Ausdruck. Mein Werk gibt (auch mir) Auskunft über mich.
Ich gestalte mich in meinem Werk. Es wird mir Gegenstand und Widerstand, es zeigt mir, welche meiner Vorstellungen funktionieren und welche nicht. Mein Werk ist mein Spiegel. Ein Gemälde, eine Skulptur, ein Text, eine Aufführung sind physische Gegenstände, die ich mit meinen Vorstellungen vergleichn kann. Erst wenn ich produziere, kann ich meine Vorstellungen mit meinen Wahrnehmungen kritisieren.
Ich gestalte mein Werk autonom, nicht in Vor- oder Rücksicht auf Applaus oder Einschaltquoten. Wenn ich mich um Zustimmung in Form von Einschaltquoten kümmere, dann bin Verkäufer, nicht Künstler. Wenn ich mich hier um praktischen Nutzen meiner Vorstellung kümmern würde, wäre ich bestensfalls Kunsthandwerker. Dann würde ich etwas für Sie produzieren, nicht (für) mich. Kunst ist autonom. Ich mache Kunst für mich, nicht für andere. Meine Vorstellung muss mir gefallen. Natürlich nehme ich in Kauf, dass sie andern auch gefällt. Und wo ich ähnlich wie andere Menschen bin, rechne ich sogar damit, dass was für mich gut ist, andern auch gefallen kann.
Was mir gefällt, finde ich in mir. Wie aber könnte ich wissen, was Sie brauchen, was Ihnen gefällt? Wenn ich nicht mir vertraute, blieben nur Einschaltquoten.
5. Practise
Wie Sie sehen, haben wir keine Zuschauer. Wir können also frei und unbelastet üben. Frei von Vorstellungen, was die Zuschauer - und irgendwelche Lehrer und Kritiker - gerne sehen würden. In gewisser Weise haben wir aber natürlich ganz kritische Zuschauer - nämlich uns selbst. Wir erkennen leicht, ob unsere Vorstellung gut ist - gut für uns.
Ich würde beispielsweise gerne etwas vorsingen, ich merke aber, dass ich das nicht gut genug kann. Nich gut genug für meine Ansprüche. Ob es Ihnen vielleicht trotzdem gefallen würde, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir aber auch kein Kriterium, in meiner Kunst muss ich mir genügen.
Meine Frage ist also, was kann ich gut genug, um es hier aufzuführen. Wenn wir zusammenarbeiten, ohne uns zu belehren, ist das eine mögliche Frage für alle Beteiligten. Dann stellen sich sofort auch die Bedingungen des Uebens ein. Ich mache auch etwas, was ich noch nicht gut genug kann, weil ich am Lernen bin.
6. Ursprüngliche Regie
Im Schauspiel gibt es Rollen. Es gibt zwei sehr verschiedene Rollen. Es gibt die Rollen innerhalb der Aufführung, die Masken, den König, den Romeo und den Frosch. Und es gibt die Rollen ausserhalb der Aufführung, die Rollen des Schauspielers und jene des Regisseurs, der weiss, was die Schauspieler tun sollen. Was ich aus der Theatergeschichte weiss - ich weiss es ganz unabhängig davon, in welchem objektiven Sinne es wahr sein könnte - ist, dass das Schauspiel lange Zeit keine Regie kannte. Die Schauspieler überlegten jeweils, wessen Kompetenzen für das aktuelle Spiel geeignet waren, die Ueberzähligen mussten raussitzen. Die machten sich dann mit allerhand Zwischenrufen wichtig, weil sie nicht mitspielen durften. So etablierte sich die Regie. Ich verstehe Ihre Einladung in diesem Sinne der ursprünglichen Regie, als Einladung zu Zwischenrufen, weil ich von Ihrem Unterrichts-Schauspiel nicht so viel wie Sie verstehe.
Dieses Verständnis des Unterrichtens liegt immer auch ganz nahe, wo etwa im Sport ein Trainer einen Weltmeister trainiert. Wenn dort der Lehrer besser wäre als der Schüler, dann wäre der Lehrer Weltmeister, nicht der Schüler. Je mehr eine Sportart in chauvinistisch-militärischem Nationalismus eingebunden ist, verkehren sich die Rollen und die Regisseure und die Trainer gewinnen Macht. Und in der Schule im engeren Sinne sind die Rollen ganz verkehrt, dort weiss der Schüler gar nichts und der Lehrer alles.
Im Ursprung des Wortes Pädagoge steckt ein römischer Diener, der vom Vater des Schülers - in der heutigen Zeit vom Staat - bezahlt wird. Aber nicht um den Schüler zu lehren, sondern um den Schüler sicher zu den Orten zu führen, wo er etwas lernen kann.
7. Lernen im Dialog
Lernen im Dialog bedeutet, dass alle Beteiligten lernen. Die Ausdrücke Monolog und Dialog sagen im hier gemeinten Sinn nichts über die Anzahl der beteiligten Personen, sondern etwas über die Anzahl der Sichtweisen. Monolog heisst die Einheit der Sichtweisen, wie sie von Lehrern angestrebt, respektive durchgesetzt wird. Die Schüler lernen, was der Lehrer weiss, am Schluss wissen alle dasselbe, nämlich das, was der Lehrer schon wusste.
Im Dialog wird gemeinsam erforscht, was jeder weiss. Dazu stellt jeder seine Vorstellungen vor. Jeder gibt seine Performance. Dabei lernt jeder das, was ihm lernenswert erscheint. Ziel des Dialoges ist Vielfalt, nicht Einfalt.
8. Lernen als Co-Evolution
Als Co-Evolution bezeichne ich die Evolutionen von verschiedenen Systemen, die einander gegenseitig voraussetzen. Grünpflanzen etwa produzieren im Metabolismus ihrer Autopoiese (Selbstorganisation) als Abfallprodukt Sauerstoff, den die Menschen für ihre Autopoiese brauchen. Menschen produzieren umgekehrt CO2, was die Grünpflanzen brauchen. Beide tun dies jedoch nicht für die je anderen Lebewesen, sondern beide sind für die je andern unabdingbare, aber einfach - also nicht aufgrund von Intention oder Koordination - vorhandene Milieueigenschaften. Normalerweise atmen Menschen nicht, damit die Planzen Stickstoff haben, und die Pflanzen haben schon Sauerstoff produziert, lange bevor es Menschen gab. Beide Systeme kümmern sich um ihre Bedürfnisse und nehmen die strukturelle Koppelung, die Co-Evolution lediglich in Kauf.
Wenn jeder das lernt, was für ihn gut ist, dann ist das in bestimmten Umgebungen auch für alle andern gut. Wenn ich hier eine Vorstellung gebe, die mir gefällt, dann kann die Vorstellung auch Ihnen gefallen.
9. Reflektion: Konstruktivismus und Systemtheorie
Ich will noch einige Anmerkungen zum theoretischen Hintergrund meiner Vorstellung machen. Wir können, wenn Sie wollen, in der Diskussion mehr darauf eingehen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach etwas mehr darüber lesen.
Der Volksmund macht sich über den Nürnberger Trichter lustig, also über die Idee, dass man den Schülern das Wissen eintrichtern könne. Vielen Pädagogen ist klar, dass die Schüler selbst lernen müssen. Die Frage, die ich mir als Pädagoge stelle, lautet deshalb, was kann ich Sinnvolles beitragen, wenn die Schüler doch alles selbst tun müssen?
Es gibt in dieser Diskussion über Lernen seit einiger Zeit systemtheoretische Ansätze unter Namen wie Radikaler Konstruktivismus, Systemtheorie 2. Ordnung oder Neue Lernkultur. Diese Ansätze gehen alle davon aus, dass jeder Mensch seine Welt selbst konstruiert. Es gibt keine Realität, die man erkennen kann oder muss. Es gibt nur die Welt, die man selbst hervorbringt. Es gibt dazu eine breite erkenntnistheoretische Diskussion. Ich verstehe diese Ansätze aber viel mehr pragmatisch. Meine Frage ist, woher kann ich wissen, was andere Menschen wissen müssten. Als Pädagoge kann ich Sie fragen, was Sie gerne wissen wollen.
Diese Ansätze haben einen ethischen Aspekt. Wenn ich meine Welt selbst hervorbringe, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich nur erzähle, wie die Welt wirklich ist, dann kann ich nichts dafür. Und natürlich ist hier mit Welt insbesondere unsere Unterrichtssituation gemeint. Wenn ich den Schülern etwas beibringen würde, dann müsste ich das verantworten. Was die Schüler selbst lernen, liegt in deren Veranwortung.
Diese Ansätze sind alle sehr subjektorientiert. Ich lade Sie ein, einmal zu versuchen, etwas für sich, anstatt etwas für die Schüler zu tun.
10. Rekursion: Alles nochmals
Wenn Sie am Anfang meines Vortrages gewusst hätten, was Sie jetzt (über diesen Vortrag) wissen, dann hätten Sie einen völlig anderen Vortrag gehört. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich erzähle Ihnen deshalb den ganzen Vortrag nochmals. Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass ich wieder zu diesem Schluss gelange.
Ich stelle mir vor, dass Ihnen beim 2. Hören einige Punkte praktischer erscheinen. Schliesslich wollten Sie so etwas wie 10 Anweisungen.
Der 1. Punkt ist, dass wir klären, was wir nicht wollen. In unserem Falle war das, dass wir nicht finden wollen, dass man gar nicht lehren kann.
Der 2. Punkt ist, dass wir klären, was wir tun können, wenn wir nicht belehren wollen. Wir erforschen die Kompetenzen im Team. Wir machen eine Liste, wo jeder reinschreibt, was er gut kann.
Der 3. Punkt ist das Selbstverständnis, das wir einnehmen, wenn wir tun, was wir tun. Ich kann zu Ihnen als Lehrer sprechen und Ihnen mitteilen, was Sie tun sollen. Ich kann aber auch fast dasselbe tun und sagen und das als ansteckende Aufführung auffassen. Wir kritisieren uns unter ästhetischen Gesichtspunkten: Ich sage nicht, dass etwas nicht richtig ist, sondern warum mir die Vorstellung gefällt.
Der 4. Punkt ist das Referenzsystem: mache ich etwas für andere, bin ich fremdbestimmt. Mache ich etwas für mich, bin ich autonom. Kunst ist autonom, wenn ich als Pädagoge auftrete, dann im Sinne einer Performance.
Der 5. Punkt ist das Ueben. Es geht darum, dass ich im geschützten Raum der Akademie das Vorzeigen üben kann. Beim Ueben übe ich auch die Selbstbeurteilung.
Der 6. Punkt ist Regie. Als Pädagoge sehe ich mich als derjenige, der draussen sitzt und Zwischenrufe macht. Ich übernehme damit eine reflektierende Aussensicht. Im besten Falle mache ich vor, wie das aussieht, was auf der Bühne gemacht wird. Natürlich spielen alle Rollenträger auch diese Rolle.
Der 7. Punkt ist der Dialog. Es gibt keine richtige Lösung, die für alle gut wäre. Jeder trägt seine Sicht bei, alle wählen unter den beigetragenen Sichten das aus, was zu ihnen passt. Die Lehre besteht darin, möglichst viele Möglichkeiten, wie man etwas tun kann, aufzulisten.
Der 8. Punkt ist die Einsicht und das Vertrauen auf die Co-Evolution. Wenn jeder das tut, was für ihn gut ist, trägt er am meisten zum Gesamtnutzen bei. Jeder Unterricht wird langweilig, wenn man etwas für andere, insbesondere für den Lehrer tun muss.
Der 9. Punkt ist die Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Welt ist nicht vorgegeben. Jeder ist verantwortlich für das, was er wahrnimmt.
Der 10. Punkt ist die Rekursion. Do it again. Wir wiederholen die Aufführung, solange sie uns unterhält, solange wir in ihr etwas Neues finden können.
Literatur
Ich nenne hier einige Texte, in welchen Sie etwas mehr über die Grundlagen meiner Vorstellungen nachlesen können.
•Maturana, Humberto R. u. Francisco J. Varela (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern (Scherz).
•Todesco, Rolf (1999): Hyperkommunikation: SchriftUmSteller statt Schriftsteller. In: Beat Suter u. Michael Böhler (Hrsg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Basel/Frankfurt (Stroemfeld).
•von Foerster, Heinz: (1993): Wissen und Gewissen. Frankfurt (Suhrkamp, stw).
•von Glasersfeld, Ernst (1996): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt (Suhrkamp)
Ihr Herr Direktor, der mich freundlicherweise eingeladen hat, sagte mir zunächst, Sie hätten gerne 10 Kriterien zum TeamTeaching, die Sie bei Ihren Projekten berücksichtigen könn(t)en. Auf meine Nachfrage hin, sagte er, dass sich Ihre Diskussion häufig dahin verlaufe, dass man die Schauspielerei eigentlich nicht lehren könne, was irgendwie wahr, aber für eine Schauspiel-Akademie naheliegenderweise auch irgendwie unbefriedigend sei. So ungefähr wissen wir also, was unser Thema ist, und wir wissen relativ gut, zu welchen irgendwie unbefriedigenden Schlüssen wir nicht kommen wollen.
Ich frage mich zunächst, wie die Kompetenzen zu unserem Thema in unserem Kreise liegen. Ich frage mich, was jeder von uns hier von den andern lernen könnte? Meiner Erfahrung nach ist diese Frage konstitutiv für jedes gemeinsame Lernen. Wenn ich mit angehenden Schauspielern zusammen die Schauspielerei lernen wollte, würde ich mich nichts anderes fragen, als was ich jetzt mit Ihnen zusammen erörtern möchte.
Wenn nämlich ein junger Mensch sich in einer Schauspielakademie meldet, dann weiss er unerhört viel über die Schauspielerei, sonst käme er ja gar nicht auf die Idee, in diese Ausbildung zu kommen. Die Frage ist, was er wie weiss. Und Sie wissen über Ihre Arbeit hier natürlich auch unerhört viel. Und dafür interessiere ich mich jetzt, weil Sie mich eingeladen haben, mich mit Ihrer Aufgabe auseinanderzusetzen, respektive mich mit Ihnen über Ihre Aufgabe zusammenzusetzen.
2. Das Team
Ich schlage Ihnen also "Teamarbeit" vor. Den Ausdruck "Team" verwende ich allerdings nur, weil Herr Danzeisen das vorgeschlagen hat. Der Ausdruck Team suggeriert ein gemeinsames Ziel. Das will ich im Laufe meiner Vorstellung etwas relativieren.
Und den Ausdruck "Teaching" will ich gar nicht mehr verwenden, weil ich mit "Teaching" Erziehung und Lehren, also Ziehen und Belehren verbinde. Wo ich Be-Lehrern begegnet bin, habe ich innerlich immer den bekannte Schlager "We dont need no education, we dont need no thougth controll ...." gesungen.
Wenn ich hier und jetzt kein Teacher bin, was bin ich denn dann?
3. Vorstellung statt Teaching
Ich gebe Ihnen eine Vorstellung. Ich gebe Ihnen eine Vorstellung meiner Vorstellung. Und dabei, also in bezug auf die Vorstellung fühle ich mich hier an der Schauspielakademie natürlich in der Höhle der Löwen. Ich schlage Ihnen vor, meinen Beitrag unter den Gesichtspunkten einer Vorstellung zu betrachten. Wenn wir uns mit der Ausbildung von Schauspielern beschäftigen, scheint mir dies eine adäquate Form.
Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns über Vorstellungen unterhalten, über unsere Vorstellungen über das, was wir in unseren Vorstellungen tun. Wenn Sie meiner Einladung folgen, sitzen wir jetzt nicht mehr in einem Schulzimmer, sondern im Theater. Wir sind mitten drin in den Vorstellungen.
Ich will Ihnen etwas vormachen anstelle von etwas beibringen. Ich habe immer dort am meisten gelernt, wo ich von der Vorstellung, von der Performance beeindruckt war. Wenn jemand etwas kann, ist das für mich ansteckend, dann will ich das auch lernen.
4. Performance
Ich fasse meine jetztige Tätigkeit hier in diesem Theater als Kunst auf, das heisst praktische Erwägungen gelten mir im hegelschen Sinne aufgehoben. Als Lehrer würde ich Ihnen sagen, was Sie machen sollen und was Sie falsch machen. Ich würde Sie über Sie belehren. Als Künstler mache ich keine Mitteilungen, als Künstler suche ich den richtigen Ausdruck. Mein Werk gibt (auch mir) Auskunft über mich.
Ich gestalte mich in meinem Werk. Es wird mir Gegenstand und Widerstand, es zeigt mir, welche meiner Vorstellungen funktionieren und welche nicht. Mein Werk ist mein Spiegel. Ein Gemälde, eine Skulptur, ein Text, eine Aufführung sind physische Gegenstände, die ich mit meinen Vorstellungen vergleichn kann. Erst wenn ich produziere, kann ich meine Vorstellungen mit meinen Wahrnehmungen kritisieren.
Ich gestalte mein Werk autonom, nicht in Vor- oder Rücksicht auf Applaus oder Einschaltquoten. Wenn ich mich um Zustimmung in Form von Einschaltquoten kümmere, dann bin Verkäufer, nicht Künstler. Wenn ich mich hier um praktischen Nutzen meiner Vorstellung kümmern würde, wäre ich bestensfalls Kunsthandwerker. Dann würde ich etwas für Sie produzieren, nicht (für) mich. Kunst ist autonom. Ich mache Kunst für mich, nicht für andere. Meine Vorstellung muss mir gefallen. Natürlich nehme ich in Kauf, dass sie andern auch gefällt. Und wo ich ähnlich wie andere Menschen bin, rechne ich sogar damit, dass was für mich gut ist, andern auch gefallen kann.
Was mir gefällt, finde ich in mir. Wie aber könnte ich wissen, was Sie brauchen, was Ihnen gefällt? Wenn ich nicht mir vertraute, blieben nur Einschaltquoten.
5. Practise
Wie Sie sehen, haben wir keine Zuschauer. Wir können also frei und unbelastet üben. Frei von Vorstellungen, was die Zuschauer - und irgendwelche Lehrer und Kritiker - gerne sehen würden. In gewisser Weise haben wir aber natürlich ganz kritische Zuschauer - nämlich uns selbst. Wir erkennen leicht, ob unsere Vorstellung gut ist - gut für uns.
Ich würde beispielsweise gerne etwas vorsingen, ich merke aber, dass ich das nicht gut genug kann. Nich gut genug für meine Ansprüche. Ob es Ihnen vielleicht trotzdem gefallen würde, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir aber auch kein Kriterium, in meiner Kunst muss ich mir genügen.
Meine Frage ist also, was kann ich gut genug, um es hier aufzuführen. Wenn wir zusammenarbeiten, ohne uns zu belehren, ist das eine mögliche Frage für alle Beteiligten. Dann stellen sich sofort auch die Bedingungen des Uebens ein. Ich mache auch etwas, was ich noch nicht gut genug kann, weil ich am Lernen bin.
6. Ursprüngliche Regie
Im Schauspiel gibt es Rollen. Es gibt zwei sehr verschiedene Rollen. Es gibt die Rollen innerhalb der Aufführung, die Masken, den König, den Romeo und den Frosch. Und es gibt die Rollen ausserhalb der Aufführung, die Rollen des Schauspielers und jene des Regisseurs, der weiss, was die Schauspieler tun sollen. Was ich aus der Theatergeschichte weiss - ich weiss es ganz unabhängig davon, in welchem objektiven Sinne es wahr sein könnte - ist, dass das Schauspiel lange Zeit keine Regie kannte. Die Schauspieler überlegten jeweils, wessen Kompetenzen für das aktuelle Spiel geeignet waren, die Ueberzähligen mussten raussitzen. Die machten sich dann mit allerhand Zwischenrufen wichtig, weil sie nicht mitspielen durften. So etablierte sich die Regie. Ich verstehe Ihre Einladung in diesem Sinne der ursprünglichen Regie, als Einladung zu Zwischenrufen, weil ich von Ihrem Unterrichts-Schauspiel nicht so viel wie Sie verstehe.
Dieses Verständnis des Unterrichtens liegt immer auch ganz nahe, wo etwa im Sport ein Trainer einen Weltmeister trainiert. Wenn dort der Lehrer besser wäre als der Schüler, dann wäre der Lehrer Weltmeister, nicht der Schüler. Je mehr eine Sportart in chauvinistisch-militärischem Nationalismus eingebunden ist, verkehren sich die Rollen und die Regisseure und die Trainer gewinnen Macht. Und in der Schule im engeren Sinne sind die Rollen ganz verkehrt, dort weiss der Schüler gar nichts und der Lehrer alles.
Im Ursprung des Wortes Pädagoge steckt ein römischer Diener, der vom Vater des Schülers - in der heutigen Zeit vom Staat - bezahlt wird. Aber nicht um den Schüler zu lehren, sondern um den Schüler sicher zu den Orten zu führen, wo er etwas lernen kann.
7. Lernen im Dialog
Lernen im Dialog bedeutet, dass alle Beteiligten lernen. Die Ausdrücke Monolog und Dialog sagen im hier gemeinten Sinn nichts über die Anzahl der beteiligten Personen, sondern etwas über die Anzahl der Sichtweisen. Monolog heisst die Einheit der Sichtweisen, wie sie von Lehrern angestrebt, respektive durchgesetzt wird. Die Schüler lernen, was der Lehrer weiss, am Schluss wissen alle dasselbe, nämlich das, was der Lehrer schon wusste.
Im Dialog wird gemeinsam erforscht, was jeder weiss. Dazu stellt jeder seine Vorstellungen vor. Jeder gibt seine Performance. Dabei lernt jeder das, was ihm lernenswert erscheint. Ziel des Dialoges ist Vielfalt, nicht Einfalt.
8. Lernen als Co-Evolution
Als Co-Evolution bezeichne ich die Evolutionen von verschiedenen Systemen, die einander gegenseitig voraussetzen. Grünpflanzen etwa produzieren im Metabolismus ihrer Autopoiese (Selbstorganisation) als Abfallprodukt Sauerstoff, den die Menschen für ihre Autopoiese brauchen. Menschen produzieren umgekehrt CO2, was die Grünpflanzen brauchen. Beide tun dies jedoch nicht für die je anderen Lebewesen, sondern beide sind für die je andern unabdingbare, aber einfach - also nicht aufgrund von Intention oder Koordination - vorhandene Milieueigenschaften. Normalerweise atmen Menschen nicht, damit die Planzen Stickstoff haben, und die Pflanzen haben schon Sauerstoff produziert, lange bevor es Menschen gab. Beide Systeme kümmern sich um ihre Bedürfnisse und nehmen die strukturelle Koppelung, die Co-Evolution lediglich in Kauf.
Wenn jeder das lernt, was für ihn gut ist, dann ist das in bestimmten Umgebungen auch für alle andern gut. Wenn ich hier eine Vorstellung gebe, die mir gefällt, dann kann die Vorstellung auch Ihnen gefallen.
9. Reflektion: Konstruktivismus und Systemtheorie
Ich will noch einige Anmerkungen zum theoretischen Hintergrund meiner Vorstellung machen. Wir können, wenn Sie wollen, in der Diskussion mehr darauf eingehen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach etwas mehr darüber lesen.
Der Volksmund macht sich über den Nürnberger Trichter lustig, also über die Idee, dass man den Schülern das Wissen eintrichtern könne. Vielen Pädagogen ist klar, dass die Schüler selbst lernen müssen. Die Frage, die ich mir als Pädagoge stelle, lautet deshalb, was kann ich Sinnvolles beitragen, wenn die Schüler doch alles selbst tun müssen?
Es gibt in dieser Diskussion über Lernen seit einiger Zeit systemtheoretische Ansätze unter Namen wie Radikaler Konstruktivismus, Systemtheorie 2. Ordnung oder Neue Lernkultur. Diese Ansätze gehen alle davon aus, dass jeder Mensch seine Welt selbst konstruiert. Es gibt keine Realität, die man erkennen kann oder muss. Es gibt nur die Welt, die man selbst hervorbringt. Es gibt dazu eine breite erkenntnistheoretische Diskussion. Ich verstehe diese Ansätze aber viel mehr pragmatisch. Meine Frage ist, woher kann ich wissen, was andere Menschen wissen müssten. Als Pädagoge kann ich Sie fragen, was Sie gerne wissen wollen.
Diese Ansätze haben einen ethischen Aspekt. Wenn ich meine Welt selbst hervorbringe, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich nur erzähle, wie die Welt wirklich ist, dann kann ich nichts dafür. Und natürlich ist hier mit Welt insbesondere unsere Unterrichtssituation gemeint. Wenn ich den Schülern etwas beibringen würde, dann müsste ich das verantworten. Was die Schüler selbst lernen, liegt in deren Veranwortung.
Diese Ansätze sind alle sehr subjektorientiert. Ich lade Sie ein, einmal zu versuchen, etwas für sich, anstatt etwas für die Schüler zu tun.
10. Rekursion: Alles nochmals
Wenn Sie am Anfang meines Vortrages gewusst hätten, was Sie jetzt (über diesen Vortrag) wissen, dann hätten Sie einen völlig anderen Vortrag gehört. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich erzähle Ihnen deshalb den ganzen Vortrag nochmals. Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass ich wieder zu diesem Schluss gelange.
Ich stelle mir vor, dass Ihnen beim 2. Hören einige Punkte praktischer erscheinen. Schliesslich wollten Sie so etwas wie 10 Anweisungen.
Der 1. Punkt ist, dass wir klären, was wir nicht wollen. In unserem Falle war das, dass wir nicht finden wollen, dass man gar nicht lehren kann.
Der 2. Punkt ist, dass wir klären, was wir tun können, wenn wir nicht belehren wollen. Wir erforschen die Kompetenzen im Team. Wir machen eine Liste, wo jeder reinschreibt, was er gut kann.
Der 3. Punkt ist das Selbstverständnis, das wir einnehmen, wenn wir tun, was wir tun. Ich kann zu Ihnen als Lehrer sprechen und Ihnen mitteilen, was Sie tun sollen. Ich kann aber auch fast dasselbe tun und sagen und das als ansteckende Aufführung auffassen. Wir kritisieren uns unter ästhetischen Gesichtspunkten: Ich sage nicht, dass etwas nicht richtig ist, sondern warum mir die Vorstellung gefällt.
Der 4. Punkt ist das Referenzsystem: mache ich etwas für andere, bin ich fremdbestimmt. Mache ich etwas für mich, bin ich autonom. Kunst ist autonom, wenn ich als Pädagoge auftrete, dann im Sinne einer Performance.
Der 5. Punkt ist das Ueben. Es geht darum, dass ich im geschützten Raum der Akademie das Vorzeigen üben kann. Beim Ueben übe ich auch die Selbstbeurteilung.
Der 6. Punkt ist Regie. Als Pädagoge sehe ich mich als derjenige, der draussen sitzt und Zwischenrufe macht. Ich übernehme damit eine reflektierende Aussensicht. Im besten Falle mache ich vor, wie das aussieht, was auf der Bühne gemacht wird. Natürlich spielen alle Rollenträger auch diese Rolle.
Der 7. Punkt ist der Dialog. Es gibt keine richtige Lösung, die für alle gut wäre. Jeder trägt seine Sicht bei, alle wählen unter den beigetragenen Sichten das aus, was zu ihnen passt. Die Lehre besteht darin, möglichst viele Möglichkeiten, wie man etwas tun kann, aufzulisten.
Der 8. Punkt ist die Einsicht und das Vertrauen auf die Co-Evolution. Wenn jeder das tut, was für ihn gut ist, trägt er am meisten zum Gesamtnutzen bei. Jeder Unterricht wird langweilig, wenn man etwas für andere, insbesondere für den Lehrer tun muss.
Der 9. Punkt ist die Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Welt ist nicht vorgegeben. Jeder ist verantwortlich für das, was er wahrnimmt.
Der 10. Punkt ist die Rekursion. Do it again. Wir wiederholen die Aufführung, solange sie uns unterhält, solange wir in ihr etwas Neues finden können.
Literatur
Ich nenne hier einige Texte, in welchen Sie etwas mehr über die Grundlagen meiner Vorstellungen nachlesen können.
•Maturana, Humberto R. u. Francisco J. Varela (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern (Scherz).
•Todesco, Rolf (1999): Hyperkommunikation: SchriftUmSteller statt Schriftsteller. In: Beat Suter u. Michael Böhler (Hrsg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Basel/Frankfurt (Stroemfeld).
•von Foerster, Heinz: (1993): Wissen und Gewissen. Frankfurt (Suhrkamp, stw).
•von Glasersfeld, Ernst (1996): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt (Suhrkamp) wenn ich das Darlehen im Kontext des Warentausches wahrnehme. Wenn ich Waren kaufe, vollziehe ich einen Tausch gegen Geld. Solange ich das Geld noch nicht bezahlt habe, bezeichne ich es als Kredit, das heisst der Verkäufer ist mein Kreditor
, der - dem Wortsinn Gläubiger gemäss - glaubt, dass ich bezahlen werde. In diesem Sinn ist der Kredit eine Nichtbar-Bezahlung, was ich invers als Darlehen meines Kreditors auffassen kann.
Eine spezielle Variante des Kredits involviert eine Bank. Sie bezahlt dem Verkäufer an meiner Stelle, wodurch sie mein Kreditor wird. Ich kann in diesem Sinne Waren auf Kredit kaufen oder Kredit im Sinne eines Darlehens aufnehmen, um Waren zu kaufen.
In meiner Buchhaltungssprache unterscheide ich die beiden Fälle, indem ich im ersten Fall von einem Kreditor spreche und die Warenlieferung in Form einer offenen Rechnung in die Buchhaltung eintrage, womit ich auf einen zeitversetzten Tausch verweise. Die Bank dagegen, von welcher ich einen Kredit erhalte, bezeichne ich in der Buchhaltung nicht als Kreditor und umgekehrt sieht mich die Bank auch nicht als Kreditor, wenn ich mein Geld auf ein Sparkonto lege, weil wir dabei nicht ans Tauschen denken.
wenn ich das Darlehen im Kontext des Warentausches wahrnehme. Wenn ich Waren kaufe, vollziehe ich einen Tausch gegen Geld. Solange ich das Geld noch nicht bezahlt habe, bezeichne ich es als Kredit, das heisst der Verkäufer ist mein Kreditor
, der - dem Wortsinn Gläubiger gemäss - glaubt, dass ich bezahlen werde. In diesem Sinn ist der Kredit eine Nichtbar-Bezahlung, was ich invers als Darlehen meines Kreditors auffassen kann.
Eine spezielle Variante des Kredits involviert eine Bank. Sie bezahlt dem Verkäufer an meiner Stelle, wodurch sie mein Kreditor wird. Ich kann in diesem Sinne Waren auf Kredit kaufen oder Kredit im Sinne eines Darlehens aufnehmen, um Waren zu kaufen.
In meiner Buchhaltungssprache unterscheide ich die beiden Fälle, indem ich im ersten Fall von einem Kreditor spreche und die Warenlieferung in Form einer offenen Rechnung in die Buchhaltung eintrage, womit ich auf einen zeitversetzten Tausch verweise. Die Bank dagegen, von welcher ich einen Kredit erhalte, bezeichne ich in der Buchhaltung nicht als Kreditor und umgekehrt sieht mich die Bank auch nicht als Kreditor, wenn ich mein Geld auf ein Sparkonto lege, weil wir dabei nicht ans Tauschen denken. Ich befasse mich gerade wieder mal mit Paradoxien und lese dabei auch, was ich früher dazu geschrieben habe:
Ich befasse mich gerade wieder mal mit Paradoxien und lese dabei auch, was ich früher dazu geschrieben habe:
 die herstellende Tätigkeit als Aneignung reflektiere und dabei primär zwei Unterscheidungen verwende: Form und Material. Wenn ich ein Artefakt herstelle, forme ich Material.
• Als
die herstellende Tätigkeit als Aneignung reflektiere und dabei primär zwei Unterscheidungen verwende: Form und Material. Wenn ich ein Artefakt herstelle, forme ich Material.
• Als  wird. Gemeinhin wird der Ausdruck "Dialog" für ernst gemeinte oder ernsthaft geführte Vermittlungsgespräche verwendet, etwa als Dialog zwischen Religionen oder zwischen Kriegsparteien. Als Vermittlungsgespräche unterscheiden sich Dialoge von den Monologen, die dort, wo Vermittlung notwendig wird, üblicherweise geführt werden. "Dialog" bezeichnet auch eine rhetorische Form, etwa als sokratischer Dialog oder galileischer Diskurs, in welcher ein eigentlicher Monolog durch einen fiktiven Idioten, der Fragen stellt, "dialogisiert" wird. Dia-log wird in diesen Interpretationen als Zwiegespräch von einem Mono-log unterschieden, in welchem eben nur einer oder nur eine Meinung spricht.
Ich verwende den Ausdruck "Dialog" in Anlehnung an M. Buber und
wird. Gemeinhin wird der Ausdruck "Dialog" für ernst gemeinte oder ernsthaft geführte Vermittlungsgespräche verwendet, etwa als Dialog zwischen Religionen oder zwischen Kriegsparteien. Als Vermittlungsgespräche unterscheiden sich Dialoge von den Monologen, die dort, wo Vermittlung notwendig wird, üblicherweise geführt werden. "Dialog" bezeichnet auch eine rhetorische Form, etwa als sokratischer Dialog oder galileischer Diskurs, in welcher ein eigentlicher Monolog durch einen fiktiven Idioten, der Fragen stellt, "dialogisiert" wird. Dia-log wird in diesen Interpretationen als Zwiegespräch von einem Mono-log unterschieden, in welchem eben nur einer oder nur eine Meinung spricht.
Ich verwende den Ausdruck "Dialog" in Anlehnung an M. Buber und  Den Ausdruck Medium verwende ich für Menschen, die zwischen Feinstofflichem und Stofflichem vermitteln. In der Esoterik wird der Überbringer als Medium (oder synonym als Kanal (Channeling)) bezeichnet.
"Autor" bedeutet ursprünglich autorisierter Stellvertreter des Schöpfers, also eine Art autorisiertes Medium, das für das Gesagte nicht eigentlich verantwortlich ist. Später oder emanzipierter schreibt der Autor selbst(bewusst), was andere wissen müssen, aber immer noch, weil er aufgrund seiner Kanäle autorisiert ist. Der Autor N. Luhmann schreibt: "Fast nichts stammt vom Autor ..."
Die Metapher wird also immer ver- oder entrückter, was dazu führt, dass so verschiedene Sachen wie Sprache, Zeitung und Luft als Medium bezeichnet werden. In den bisherigen Metaphern lässt sich - wie entrückt auch immer - der Äther noch als Träger von Wellen erkennen. Die Metapher entfaltet sich aber auch in eine andere Richtung. Nachdem erkannt ist, dass Radiowellen keinen Äther brauchen, der sie trägt, wird die Form der Radiowelle von der Radiowelle unterschieden.
Die (Äther-)Welle als Medium (Form anstelle von Materie und Energie)
Die Radiowelle wird so zum Träger ihrer eigenen Form und mithin zum Medium. Das Medium ist dabei nicht irgendeine Art von Material, sondern das Unsichtbare, nicht Wahrnehmbare, das die Form zulässt. Anstelle von Material, das die Welle zulässt, tritt die Welle, die eine Form der Welle zulässt. Das Medium übernimmt dabei den Platz von Material, das nicht gedacht werden will, weil nur die Form interessiert oder erscheint.
H. Duerr erzählt die Geschichte der Physik wie folgt: Man wollte wissen, was Material jenseits seiner Form ist. Also zerlegte man das Material bis hin zum Atom. Das Atom war gedacht als materielles Element. Leider hat das Atom aber Teile, einen Kern und Elektronen, die nicht Atom heissen können, weil der Ausdruck für das Kleinste eben schon vergeben war. Dann aber machte die Quantenphysik ein spezielles Experiment, das zeigte, dass man nicht sinnvoll von einem "Kleinsten" sprechen kann, weil es irgendwie "verschmiert" ist also keinen scharfen Ort hat (Heisenbergs Unschärfe). Man muss nun von Wellen sprechen, aber Wellen sind eine Form. Man ist also wieder dort, wo man anfänglich weg wollte: Man wollte Materie jenseits der Form und hat nur Formen gefunden.
Das Nichtbeobachtete als Medium (Die nicht-markierte Seite)
N. Luhmann formalisiert das Medium mittels
Den Ausdruck Medium verwende ich für Menschen, die zwischen Feinstofflichem und Stofflichem vermitteln. In der Esoterik wird der Überbringer als Medium (oder synonym als Kanal (Channeling)) bezeichnet.
"Autor" bedeutet ursprünglich autorisierter Stellvertreter des Schöpfers, also eine Art autorisiertes Medium, das für das Gesagte nicht eigentlich verantwortlich ist. Später oder emanzipierter schreibt der Autor selbst(bewusst), was andere wissen müssen, aber immer noch, weil er aufgrund seiner Kanäle autorisiert ist. Der Autor N. Luhmann schreibt: "Fast nichts stammt vom Autor ..."
Die Metapher wird also immer ver- oder entrückter, was dazu führt, dass so verschiedene Sachen wie Sprache, Zeitung und Luft als Medium bezeichnet werden. In den bisherigen Metaphern lässt sich - wie entrückt auch immer - der Äther noch als Träger von Wellen erkennen. Die Metapher entfaltet sich aber auch in eine andere Richtung. Nachdem erkannt ist, dass Radiowellen keinen Äther brauchen, der sie trägt, wird die Form der Radiowelle von der Radiowelle unterschieden.
Die (Äther-)Welle als Medium (Form anstelle von Materie und Energie)
Die Radiowelle wird so zum Träger ihrer eigenen Form und mithin zum Medium. Das Medium ist dabei nicht irgendeine Art von Material, sondern das Unsichtbare, nicht Wahrnehmbare, das die Form zulässt. Anstelle von Material, das die Welle zulässt, tritt die Welle, die eine Form der Welle zulässt. Das Medium übernimmt dabei den Platz von Material, das nicht gedacht werden will, weil nur die Form interessiert oder erscheint.
H. Duerr erzählt die Geschichte der Physik wie folgt: Man wollte wissen, was Material jenseits seiner Form ist. Also zerlegte man das Material bis hin zum Atom. Das Atom war gedacht als materielles Element. Leider hat das Atom aber Teile, einen Kern und Elektronen, die nicht Atom heissen können, weil der Ausdruck für das Kleinste eben schon vergeben war. Dann aber machte die Quantenphysik ein spezielles Experiment, das zeigte, dass man nicht sinnvoll von einem "Kleinsten" sprechen kann, weil es irgendwie "verschmiert" ist also keinen scharfen Ort hat (Heisenbergs Unschärfe). Man muss nun von Wellen sprechen, aber Wellen sind eine Form. Man ist also wieder dort, wo man anfänglich weg wollte: Man wollte Materie jenseits der Form und hat nur Formen gefunden.
Das Nichtbeobachtete als Medium (Die nicht-markierte Seite)
N. Luhmann formalisiert das Medium mittels 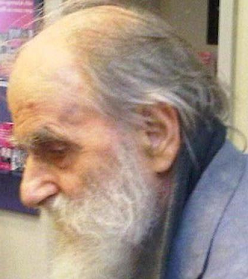 durch H. von Foersters Zitat zum Guru avancierte, wurde er wieder entdeckt und zu einem Lehrauftrag an die Uni Heidelberg eingeladen, für den er nach eigenen Angaben nicht wie vereinbart bezahlt wurde. 1998 war er als Gastredner am Complex-Change-Kongress der
durch H. von Foersters Zitat zum Guru avancierte, wurde er wieder entdeckt und zu einem Lehrauftrag an die Uni Heidelberg eingeladen, für den er nach eigenen Angaben nicht wie vereinbart bezahlt wurde. 1998 war er als Gastredner am Complex-Change-Kongress der  Zerlegung von Produktionstätigkeiten innerhalb eines Betriebes. Das Standardbeispiel stammt von A. Smith, der beschrieben hat, wie Nähnadeln in 18 verschiedenen Teiltätigkeiten von 18 verschiedenen Personen hergestellt wurden.
Wenn von dieser Arbeitsteilung gesprochen wird, werden die Tätigkeiten als Teile einer Gesamttätigkeit aufgefasst, die zur Herstellung des jeweiligen Produktes notwendig ist, und die im idealen Handwerk von einer einzigen Person ausgeführt wurde.
Die innerbetriebliche Arbeitsteilung begründet die Manufaktur und anschliessend die Fabrik, beides Aspekte der Industrie und mithin der Lohnarbeit.
A.Smith gilt immer noch als einer der bedeutendsten englischen Ökonomen. Er schrieb, dass die Vorteile der Arbeitsteilung vor allem in einer gesteigerten Geschicklichkeit der spezialisierten Arbeiter liege und in der Zeit, die gespart werde, dass der Einzelne sein Werkzeug nicht wechseln müssse. C. Babbage, einer der Väter des Computers, schrieb dagegen, dass die Aufspaltung eines Arbeitsprozesses in unterschiedlich anspruchsvolle Teilprozesse die Lohnkosten für die Produktion senke. Wenn jeder Arbeitende alles können muss, muss auch jeder den gleich grossen und eben grossen Lohn bekommen. C. Babbage formulierte dieses Prinzip erstmals in seinem 1832 in London erschienenen Werk On the Economy of Machinery and Manufactures.
Bei dieser Arbeitsteilung werden also auch die Arbeitenden in verschiedene Lohnklassen eingeteilt.
Zerlegung von Produktionstätigkeiten innerhalb eines Betriebes. Das Standardbeispiel stammt von A. Smith, der beschrieben hat, wie Nähnadeln in 18 verschiedenen Teiltätigkeiten von 18 verschiedenen Personen hergestellt wurden.
Wenn von dieser Arbeitsteilung gesprochen wird, werden die Tätigkeiten als Teile einer Gesamttätigkeit aufgefasst, die zur Herstellung des jeweiligen Produktes notwendig ist, und die im idealen Handwerk von einer einzigen Person ausgeführt wurde.
Die innerbetriebliche Arbeitsteilung begründet die Manufaktur und anschliessend die Fabrik, beides Aspekte der Industrie und mithin der Lohnarbeit.
A.Smith gilt immer noch als einer der bedeutendsten englischen Ökonomen. Er schrieb, dass die Vorteile der Arbeitsteilung vor allem in einer gesteigerten Geschicklichkeit der spezialisierten Arbeiter liege und in der Zeit, die gespart werde, dass der Einzelne sein Werkzeug nicht wechseln müssse. C. Babbage, einer der Väter des Computers, schrieb dagegen, dass die Aufspaltung eines Arbeitsprozesses in unterschiedlich anspruchsvolle Teilprozesse die Lohnkosten für die Produktion senke. Wenn jeder Arbeitende alles können muss, muss auch jeder den gleich grossen und eben grossen Lohn bekommen. C. Babbage formulierte dieses Prinzip erstmals in seinem 1832 in London erschienenen Werk On the Economy of Machinery and Manufactures.
Bei dieser Arbeitsteilung werden also auch die Arbeitenden in verschiedene Lohnklassen eingeteilt. ". . .to design an aeroplane is nothing; to build an aeroplane is something; but to fly an aeroplane is EVERYTHING!"
". . .to design an aeroplane is nothing; to build an aeroplane is something; but to fly an aeroplane is EVERYTHING!"
 Ich teile etwas auf, wenn ich die Sache zerteile und verteile, also wenn ich ein Ganzes zerlege und die Teile separiere, insbesondere an verschiedene Personen verteile. In diesem Sinne teile ich beispielsweise Kuchen mit anderen Menschen, indem ich den Kuchen zerteile und die Teile anderen Menschen schenke.
Bei dieser Art zu teilen sind die Ressource und die Teile gegenständlich. Wenn eine Person einen Teil besitzt, kann dieser Teil nicht auch von einer anderen Person besessen werden.
Ich teile den Aufwand mit anderen Personen, wenn diese sich entsprechend beteiligen. Oft wird dann auch der Ertrag geteilt. In diesem Sinne teile ich beispielsweise die Gartenarbeit mit meiner Frau, wobei wir dann auch das Gemüse zusammen essen, also wie Kuchen teilen. Bei dieser Art zu teilen bleibt offen, ob verschiedene Tätigkeiten oder die Menge des Aufwandes geteilt wird.
Ich teile etwas, wenn ich die Sache gemeinsam mit anderen Personen nutze. Die gemeinsame Nutzung hat einen räumlichen und einen zeitliche Aspekt. In diesem Sinne teile ich etwa einen Büroraum mit anderen Personen, die dann gleichzeitig denselben Raum benutzen. Ich teile aber auch etwa ein Fahrzeug, wenn dieses auch anderen Personen zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um ein zeitliches Teilen. Bei dieser Art zu teilen wird das relative Ganze geteilt, also beispielsweise das ganze Büro. Wenn wir einen Kuchen teilen, konsumiert nicht jeder den ganzen Kuchen, sondern jeder seinen ganzen Kuchenteil.
In Bezug auf das gemeinsamen Nutzen verliert das Teilen einen Teil des Wortsinnes, wenn die gemeinsame Nutzung wie etwa bei der innerbetriebliche Arbeitsteilung gesellschaftlich organisiert wird. Teilen kann als Aktivität des oder der Teilenden gesehen werden. Wenn aber die "Teilung" vorab von anderen vorgenommen wurde, sehe ich viel mehr eine fremdbestimmte Zuteilung.
Schliesslich verwende ich den Ausdruck teilen auch in einem ganz anderen Sinn, wo ich beispielsweise mein "Wissen" teile, also mitteile, was ich weiss. Bei dieser Art zu teilen wird nicht geteilt, es werden sozusagen Kopien verbreitet. Dabei wird der Aspekt des Schenkens hervorgehoben, weil diese Art des Teilens praktisch gratis ist. Ich verliere gar nichts und es kostest mich praktisch nichts, wenn ich Daten kopiere und sie anderen zur Verfügung stelle. Dabei wird allerdings ein Tauschgeschäftsmodell, in welchen Journalisten ihre Daten verbreiten, unterlaufen.
Und wenn ich Gemeinschaft und Gesellschaft dadurch unterscheide, dass in erstere geteilt und und letzter getausch wird, meine ich das Teilen natürlich in einem oikonomischen Sinn, der weniger mit gratis als mit einer Aufhebung des Schenkens zu tun hat.>
Ich teile etwas auf, wenn ich die Sache zerteile und verteile, also wenn ich ein Ganzes zerlege und die Teile separiere, insbesondere an verschiedene Personen verteile. In diesem Sinne teile ich beispielsweise Kuchen mit anderen Menschen, indem ich den Kuchen zerteile und die Teile anderen Menschen schenke.
Bei dieser Art zu teilen sind die Ressource und die Teile gegenständlich. Wenn eine Person einen Teil besitzt, kann dieser Teil nicht auch von einer anderen Person besessen werden.
Ich teile den Aufwand mit anderen Personen, wenn diese sich entsprechend beteiligen. Oft wird dann auch der Ertrag geteilt. In diesem Sinne teile ich beispielsweise die Gartenarbeit mit meiner Frau, wobei wir dann auch das Gemüse zusammen essen, also wie Kuchen teilen. Bei dieser Art zu teilen bleibt offen, ob verschiedene Tätigkeiten oder die Menge des Aufwandes geteilt wird.
Ich teile etwas, wenn ich die Sache gemeinsam mit anderen Personen nutze. Die gemeinsame Nutzung hat einen räumlichen und einen zeitliche Aspekt. In diesem Sinne teile ich etwa einen Büroraum mit anderen Personen, die dann gleichzeitig denselben Raum benutzen. Ich teile aber auch etwa ein Fahrzeug, wenn dieses auch anderen Personen zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um ein zeitliches Teilen. Bei dieser Art zu teilen wird das relative Ganze geteilt, also beispielsweise das ganze Büro. Wenn wir einen Kuchen teilen, konsumiert nicht jeder den ganzen Kuchen, sondern jeder seinen ganzen Kuchenteil.
In Bezug auf das gemeinsamen Nutzen verliert das Teilen einen Teil des Wortsinnes, wenn die gemeinsame Nutzung wie etwa bei der innerbetriebliche Arbeitsteilung gesellschaftlich organisiert wird. Teilen kann als Aktivität des oder der Teilenden gesehen werden. Wenn aber die "Teilung" vorab von anderen vorgenommen wurde, sehe ich viel mehr eine fremdbestimmte Zuteilung.
Schliesslich verwende ich den Ausdruck teilen auch in einem ganz anderen Sinn, wo ich beispielsweise mein "Wissen" teile, also mitteile, was ich weiss. Bei dieser Art zu teilen wird nicht geteilt, es werden sozusagen Kopien verbreitet. Dabei wird der Aspekt des Schenkens hervorgehoben, weil diese Art des Teilens praktisch gratis ist. Ich verliere gar nichts und es kostest mich praktisch nichts, wenn ich Daten kopiere und sie anderen zur Verfügung stelle. Dabei wird allerdings ein Tauschgeschäftsmodell, in welchen Journalisten ihre Daten verbreiten, unterlaufen.
Und wenn ich Gemeinschaft und Gesellschaft dadurch unterscheide, dass in erstere geteilt und und letzter getausch wird, meine ich das Teilen natürlich in einem oikonomischen Sinn, der weniger mit gratis als mit einer Aufhebung des Schenkens zu tun hat.>
 D. Baecker schreibt, dass er Kultur durch den Formbegriff von G. Spencer-Brown verstehen wolle, der nicht auf Gegenbegriffen, sondern auf Differenzen beruhe. Er schreibt, dass im Materialismus Form und Materie Gegenbegriffe seien, während sein Formbegriff keinen Gegenbegriff habe (was ich nebenbei für einen extrem reduzierten Materialismus halte). Aber hier geht es um Form ohne Gegenbegriff (wobei mir unklar wird, was Gegenbebriff überhaupt heissen könnte).
Der Clou des von Spencer Brown entwickelten Kalküls besteht darin, daß er zur Aufnahme der Booleschen Algebra, zur Vermeidung des von Alfred North Whitehead und Bertrand Russell ausgesprochenen Sebstreferenzverbots und zur Einführung des Faktors Zeit in ein logisches Kalkül mit einer einzigen Operation, eben der Operation der Unterscheidung, und fünf Zeichen oder Werten auskommt: Innenseite der Unterscheidung („marked state“), Außenseite der Unterscheidung („unmarked state“), die Unterscheidung selbst („call“ beziehungsweise „cross“), das Gleichheitszeichen (interpretiert als „is confused with“) und ein Zeichen für die Wiedereinführung der Unterscheidung in den Raum der Unterscheidung („re-entry“).
D. Baecker verwendet dann (in der Luhmannschen Tradition) einen simplen Satz: Die Kultur macht einen Unterschied. Dann sagt er, dass die markierte Seite dieses Unterschiedes "Kultur" heisse. (Das ist eben die Autopoiese, in welcher sich bei H. Maturana ein Einzeller macht, indem der Einzeller etwas macht, was dann ein Einzeller ist - und (das ist der Hauptpunkt!) als Einzeller bezeichnet wird. (Die Argumentation verzichtet auf die Unterscheidung Zeichen/Referenzobjekt: sie tut (bei H. Maturana) so, als ob Einzeller oder Kulturen sich auch so benennen würden, und bei der D. Baecker so, als ob nur die Kommunikation existieren würde. Diese Abstraktion ist die Grundlage der Differenz ohne Gegenbegriff). Dann frägt D. Baecker aber nach "Zuständen", die die Markierung "Kultur" verdienen, allerdings um explizit betont nicht zu sagen, was mit Zuständen gemeint sein könnte (so dass diese Zustände obwohl markiert keinen Gegenbegriff darstellen (sollen)).
Die differenztheoretisch Fragen lauten dann: „welchen Unterschied macht die Kultur?“ und operational „wie macht sie diesen Unterschied?“
D. Baecker schreibt, dass er Kultur durch den Formbegriff von G. Spencer-Brown verstehen wolle, der nicht auf Gegenbegriffen, sondern auf Differenzen beruhe. Er schreibt, dass im Materialismus Form und Materie Gegenbegriffe seien, während sein Formbegriff keinen Gegenbegriff habe (was ich nebenbei für einen extrem reduzierten Materialismus halte). Aber hier geht es um Form ohne Gegenbegriff (wobei mir unklar wird, was Gegenbebriff überhaupt heissen könnte).
Der Clou des von Spencer Brown entwickelten Kalküls besteht darin, daß er zur Aufnahme der Booleschen Algebra, zur Vermeidung des von Alfred North Whitehead und Bertrand Russell ausgesprochenen Sebstreferenzverbots und zur Einführung des Faktors Zeit in ein logisches Kalkül mit einer einzigen Operation, eben der Operation der Unterscheidung, und fünf Zeichen oder Werten auskommt: Innenseite der Unterscheidung („marked state“), Außenseite der Unterscheidung („unmarked state“), die Unterscheidung selbst („call“ beziehungsweise „cross“), das Gleichheitszeichen (interpretiert als „is confused with“) und ein Zeichen für die Wiedereinführung der Unterscheidung in den Raum der Unterscheidung („re-entry“).
D. Baecker verwendet dann (in der Luhmannschen Tradition) einen simplen Satz: Die Kultur macht einen Unterschied. Dann sagt er, dass die markierte Seite dieses Unterschiedes "Kultur" heisse. (Das ist eben die Autopoiese, in welcher sich bei H. Maturana ein Einzeller macht, indem der Einzeller etwas macht, was dann ein Einzeller ist - und (das ist der Hauptpunkt!) als Einzeller bezeichnet wird. (Die Argumentation verzichtet auf die Unterscheidung Zeichen/Referenzobjekt: sie tut (bei H. Maturana) so, als ob Einzeller oder Kulturen sich auch so benennen würden, und bei der D. Baecker so, als ob nur die Kommunikation existieren würde. Diese Abstraktion ist die Grundlage der Differenz ohne Gegenbegriff). Dann frägt D. Baecker aber nach "Zuständen", die die Markierung "Kultur" verdienen, allerdings um explizit betont nicht zu sagen, was mit Zuständen gemeint sein könnte (so dass diese Zustände obwohl markiert keinen Gegenbegriff darstellen (sollen)).
Die differenztheoretisch Fragen lauten dann: „welchen Unterschied macht die Kultur?“ und operational „wie macht sie diesen Unterschied?“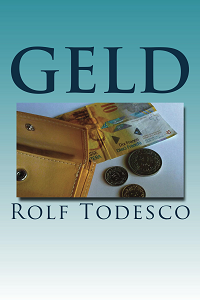 Die technische Entwicklung hat nun den letzten Schritt getan und diese neuen Verleger jeder Funktion enthoben.
Die technische Entwicklung hat nun den letzten Schritt getan und diese neuen Verleger jeder Funktion enthoben.  nicht ausgestorben sind. Der letzte Mohikaner bezeichnet in diesem Sinne nicht einen einzelnen Menschen, sondern viel mehr eine personalisierten Vertretung einer aussterbenden Haltung, die im Fallle des letzten Mohikaner in einer Art edlen Wildheit bestand. Im Krieg zwischen England und Frankreich um das freie Land, das die Mohikaner bewohnten, hat der letzte Mohikaner sein Leben in den Dienst der Eroberer dieses freien Landes gestellt. Er hat musste erkennen, dass sein Land nicht frei bleiben konnte ...
Der letzte Marxianer ist insofern eine Fiktion, als es eigentlich nur einen Marxianer gegeben hat, der sich gegen all die Marxisten, die ihm folgten, nie durchsetzen konnte. Anfänglich gab es unter den Marxisten noch ein paar Fraktionen, die sich auf den Kern der Theorie von K. Marx berufen haben, aber bald haben die Marxisten das
nicht ausgestorben sind. Der letzte Mohikaner bezeichnet in diesem Sinne nicht einen einzelnen Menschen, sondern viel mehr eine personalisierten Vertretung einer aussterbenden Haltung, die im Fallle des letzten Mohikaner in einer Art edlen Wildheit bestand. Im Krieg zwischen England und Frankreich um das freie Land, das die Mohikaner bewohnten, hat der letzte Mohikaner sein Leben in den Dienst der Eroberer dieses freien Landes gestellt. Er hat musste erkennen, dass sein Land nicht frei bleiben konnte ...
Der letzte Marxianer ist insofern eine Fiktion, als es eigentlich nur einen Marxianer gegeben hat, der sich gegen all die Marxisten, die ihm folgten, nie durchsetzen konnte. Anfänglich gab es unter den Marxisten noch ein paar Fraktionen, die sich auf den Kern der Theorie von K. Marx berufen haben, aber bald haben die Marxisten das  sondern auf einer kollektiven oder sozialen Vertrauenskonstruktion beruhe, weil es sich beim Geld eigentlich um Zahlungsverpflichtungen handle. Wenn mir jemand 20 Franken schuldet, habe ich dieser Theorie zufolge 20 Franken, wie wenn ich eine 20-Franken-Banknote habe, die ja auch keinen materiellen Wert repräsentiere. In solchen Theorien wird die Unterscheidung zwischen Geld und Giralgeld systematisch negiert. Geld erscheint so auch als sein Gegenteil, nämlich als Geld, das nicht nur keine materielle Basis hat, sondern gar nicht existiert, wenn mein Schuldner kein Geld hat.
Geld erscheint dabei als ein Vertrauen in Schuldscheine, die dann als Geld bezeichnet werden, wenn sie von einer Zentralbank in Form von Banknoten herausgegeben worden sind oder eben als Buchgeld in den Kontokorrenten von Geschäftsbanken stehen. Das sind die wesentlichen Fälle, die in der Währungsverfassung vorgesehen sind. Viele Vertreter solcher Geldheorien suggerieren, dass das Vertrauen in Geld einer sehr verbreiteten Wahnvorstellung entspreche, was eben deshalb funktioniere, weil diese Wahnvorstellung so verbreitet sei. Das halte ich für eine Wahnvorstellung.
Ich vertraue bei Geld wie bei jeder anderen Sache darauf, dass ich mein Recht, also meine legitimen Ansprüche geltend machen kann. Dabei unterscheide ich, ob ich eine Banknote besitze oder ob mir jemand etwas oder eine Banknote schuldig ist. Diese Fälle beruhen auf sehr verschiedenen Verträgen. Nur Idioten würden einer Banknote vertrauen oder gegebenfalls nicht mehr vertrauen. Welchen Vertrag könnte ich mit einer Banknote abschliessen? Eine Banknote repräsentiert kein Vertrauensverhältnis, sondern eine gesellschaftlich institutionalisierte
sondern auf einer kollektiven oder sozialen Vertrauenskonstruktion beruhe, weil es sich beim Geld eigentlich um Zahlungsverpflichtungen handle. Wenn mir jemand 20 Franken schuldet, habe ich dieser Theorie zufolge 20 Franken, wie wenn ich eine 20-Franken-Banknote habe, die ja auch keinen materiellen Wert repräsentiere. In solchen Theorien wird die Unterscheidung zwischen Geld und Giralgeld systematisch negiert. Geld erscheint so auch als sein Gegenteil, nämlich als Geld, das nicht nur keine materielle Basis hat, sondern gar nicht existiert, wenn mein Schuldner kein Geld hat.
Geld erscheint dabei als ein Vertrauen in Schuldscheine, die dann als Geld bezeichnet werden, wenn sie von einer Zentralbank in Form von Banknoten herausgegeben worden sind oder eben als Buchgeld in den Kontokorrenten von Geschäftsbanken stehen. Das sind die wesentlichen Fälle, die in der Währungsverfassung vorgesehen sind. Viele Vertreter solcher Geldheorien suggerieren, dass das Vertrauen in Geld einer sehr verbreiteten Wahnvorstellung entspreche, was eben deshalb funktioniere, weil diese Wahnvorstellung so verbreitet sei. Das halte ich für eine Wahnvorstellung.
Ich vertraue bei Geld wie bei jeder anderen Sache darauf, dass ich mein Recht, also meine legitimen Ansprüche geltend machen kann. Dabei unterscheide ich, ob ich eine Banknote besitze oder ob mir jemand etwas oder eine Banknote schuldig ist. Diese Fälle beruhen auf sehr verschiedenen Verträgen. Nur Idioten würden einer Banknote vertrauen oder gegebenfalls nicht mehr vertrauen. Welchen Vertrag könnte ich mit einer Banknote abschliessen? Eine Banknote repräsentiert kein Vertrauensverhältnis, sondern eine gesellschaftlich institutionalisierte  besitzen, fungieren sie einen Staat, durch dessen Verfassung sie als Besitzer erscheinen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie diesen Staat selbst gründen oder ob sie ihren Besitz innerhalb eines ihnen übergeordneten Staates erlangen. In beiden Fällen erscheint ein naturwüchsiger Eigentümer.
Wenn Bündnisse europäischer Städte Besitzverhältnisse im Amazonasgebiet anerkennen oder gar durchsetzen, treten sie als militärische Aneignungsmächte auf, die Eigentum begründen. Eigentum ist aber in all diesen Fällen die fiktive Legitimation der jeweiligen Besitzverhältnisse, weil solches Eigentum niemandem gehört, wie etwa die Strassen einer Kommune, die in keiner Buchhaltung als Vermögen erscheinen.
Nicht privates Eigentum ist Utopie und sehr oft Ideologie.
besitzen, fungieren sie einen Staat, durch dessen Verfassung sie als Besitzer erscheinen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie diesen Staat selbst gründen oder ob sie ihren Besitz innerhalb eines ihnen übergeordneten Staates erlangen. In beiden Fällen erscheint ein naturwüchsiger Eigentümer.
Wenn Bündnisse europäischer Städte Besitzverhältnisse im Amazonasgebiet anerkennen oder gar durchsetzen, treten sie als militärische Aneignungsmächte auf, die Eigentum begründen. Eigentum ist aber in all diesen Fällen die fiktive Legitimation der jeweiligen Besitzverhältnisse, weil solches Eigentum niemandem gehört, wie etwa die Strassen einer Kommune, die in keiner Buchhaltung als Vermögen erscheinen.
Nicht privates Eigentum ist Utopie und sehr oft Ideologie. aus bedrucktem Papier gebunden. Was im Buch geschrieben steht, ist für dessen Buchsein unerheblich, beliebig und gleichgültig. Dass ich ein Buch in den Händen habe, sehe ich lange vor jedem Wort in diesem Buch.
Tautologischerweise sage ich also, dass ich einen
aus bedrucktem Papier gebunden. Was im Buch geschrieben steht, ist für dessen Buchsein unerheblich, beliebig und gleichgültig. Dass ich ein Buch in den Händen habe, sehe ich lange vor jedem Wort in diesem Buch.
Tautologischerweise sage ich also, dass ich einen 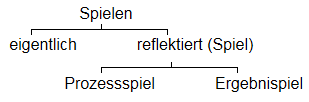 zum Zweck des Spieles, was das Spiel aufhebt (Pseudospiel). Varianten des Ergebnisspiels sind das Vorspielen (statt spielen) etwa von Musik (das Anerkennung bringen soll), das Rollenspiel (das Erkenntnis bringen soll), das Glücksspiel (das Geld bringen soll).
Bestimmte Ergebnisspiele werden in der Spieltheorie (das ist ein Eigenname, der für etwas anderes steht, als für "Theorie des Spiels") beschrieben. Diese "Spiele" beruhen auf einem eigenständigen, formalen Spielbegriff, der vielmehr mit Kriegsspiel als mit eigentlichem Spielen und mit Prozessspielen zu tun hat.
zum Zweck des Spieles, was das Spiel aufhebt (Pseudospiel). Varianten des Ergebnisspiels sind das Vorspielen (statt spielen) etwa von Musik (das Anerkennung bringen soll), das Rollenspiel (das Erkenntnis bringen soll), das Glücksspiel (das Geld bringen soll).
Bestimmte Ergebnisspiele werden in der Spieltheorie (das ist ein Eigenname, der für etwas anderes steht, als für "Theorie des Spiels") beschrieben. Diese "Spiele" beruhen auf einem eigenständigen, formalen Spielbegriff, der vielmehr mit Kriegsspiel als mit eigentlichem Spielen und mit Prozessspielen zu tun hat. Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen einem Spiel und der Wirklichkeit ("Das Gegenteil von Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit (S. Freud); Das Leben ist ein Spiel (Volksmund)). Ich unterscheide zwischen Spiel und Wirklichkeit und problematisiere die Wirklichkeit als Spiel. Im Spiel mache ich das gleiche wie in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit spiele ich ein Spiel, beispielsweise Rollen.
Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen Prozess-Spiel und Ergebnis-Spiel. Ich kann im Ergebnisspiel Punkte zählen, damit das Spiel "funktioniert". Ich fahre beispielsweise Motorad und schaue dabei auf die Rundenzeit (Ergebnis), obwohl mich diese Zeit im Sinne des Wettbewerbes nicht interessiert. Ich verwende diese Zeit als externes Kriterium zur Kritik meines Gefühls dafür, ob die Fahrt gelungen ist.
Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen einem Spiel und der Wirklichkeit ("Das Gegenteil von Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit (S. Freud); Das Leben ist ein Spiel (Volksmund)). Ich unterscheide zwischen Spiel und Wirklichkeit und problematisiere die Wirklichkeit als Spiel. Im Spiel mache ich das gleiche wie in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit spiele ich ein Spiel, beispielsweise Rollen.
Als Spiel bezeichne ich die Differenz zwischen Prozess-Spiel und Ergebnis-Spiel. Ich kann im Ergebnisspiel Punkte zählen, damit das Spiel "funktioniert". Ich fahre beispielsweise Motorad und schaue dabei auf die Rundenzeit (Ergebnis), obwohl mich diese Zeit im Sinne des Wettbewerbes nicht interessiert. Ich verwende diese Zeit als externes Kriterium zur Kritik meines Gefühls dafür, ob die Fahrt gelungen ist.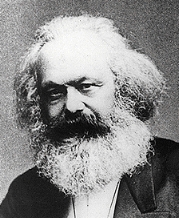 Neoliberalismus bekennen, ob sie nun Alternativen kennen oder nicht. Und wo die Sozialdemokraten Stimmen verlieren - egal wie viele - werden diese Stimmen von bekennenden Neoliberalen gwonnen, weil es gar keine andere Parteien gibt.
Man könnte meinen - und H. Flassbeck tut das offenbar, obwohl oder weil er sich nicht als Sozialdemokrat outet -, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten Erfolg hätten, wenn sie keine Neoliberale wären.
Parteien aber, die keine Neoliberale sind, wären wohl Kommunisten, aber solche Parteien gibt es nicht, nicht einmal im heutigen Griechenland, wo sich die SYRIZA sofort auflöste, als sie gewählt wurde. Es gibt aber viele Berater wie H. Flassbeck, die sehr genau wüssten, was eine Partei tun müsste. Nur scheinen die Parteien keine Berater zu brauchen, sie haben ja Führer, die dann und wann abtreten - wie heute in Österreich und morgen in Deutschland.
Neoliberalismus bekennen, ob sie nun Alternativen kennen oder nicht. Und wo die Sozialdemokraten Stimmen verlieren - egal wie viele - werden diese Stimmen von bekennenden Neoliberalen gwonnen, weil es gar keine andere Parteien gibt.
Man könnte meinen - und H. Flassbeck tut das offenbar, obwohl oder weil er sich nicht als Sozialdemokrat outet -, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten Erfolg hätten, wenn sie keine Neoliberale wären.
Parteien aber, die keine Neoliberale sind, wären wohl Kommunisten, aber solche Parteien gibt es nicht, nicht einmal im heutigen Griechenland, wo sich die SYRIZA sofort auflöste, als sie gewählt wurde. Es gibt aber viele Berater wie H. Flassbeck, die sehr genau wüssten, was eine Partei tun müsste. Nur scheinen die Parteien keine Berater zu brauchen, sie haben ja Führer, die dann und wann abtreten - wie heute in Österreich und morgen in Deutschland.