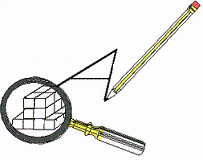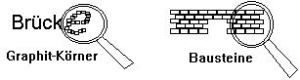Kopien meiner Blogs (Weblog)
als Datensicherung
[ zurück ]
[ Stichworte ]
[ Die Hyper-Bibliothek ]
[ Systemtheorie ]
[ Meine Bücher ]
Inhalt - weiter
eine Maschine zum Nähen .. - September 13, 2015
In meiner Technikgeschichte befasste ich mich gerade mit dem Übergang vom Werkzeug zur Maschine. C. Babbage, der Vater des Computers, definierte: ”Die Vereinigung aller dieser einfachen Instrumente, durch einen einzigen Motor in  Bewegung gesetzt, bildet eine Maschine”.
Als Nähmaschine bezeichne ich - tautologischerweise - eine Maschine zum Nähen. Meine Nähmaschine hat einen Motor. Aber ist Grossmutters Tret-Nähmaschine (k)eine Maschine?
Zwar ist klar, dass die Tret-Nähmaschine, nur weil sie "Maschine" genannt wird, sowenig eine Maschine sein muss, wie die Erdbeere eine Beere ist. Aber verdrängen lässt sich die Frage, indem man auf den sprachlich-ausdrücklichen Aspekt des Einwandes verweist, nicht. Die Tret-Nähmaschine verweist auf ein tieferliegendes Problem. Definitionen implizieren durch ihre Begriffsbäume Verwandtschafts-oder Entwicklungstheorien. Zu unserer Einteilung der Tierwelt beispielsweise gehören implizite Evolutionstheorien. Die unterstellten Verwandtschaften können falsch oder bedingungsmässig unvollständig sein, wobei "falsch" hier weder logisch noch letztlich, sondern umgangssprachlich gemeint ist. Definitionen und die in ihnen steckenden "Theorien" sind umgangssprachlich falsch, wenn sie am praktischen Anliegen scheitern. Ein Wal ist in diesem Sinne kein Fisch, weil er nicht in einem unmittelbar über dem Wasser gedeckten Aquarium gehalten werden kann. In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr, dass es Theorien gibt, deren Gegenstände sich "bewusst" gegen die Theorie verhalten können. Naturwissenschaftliche Gegenstände haben kein Eigenleben, die Erde muss sich drehen, ein Magnet muss Strom induzieren, wenn er unter bestimmten Bedingungen steht. Es geht nicht darum, dass sich die letzten Gegenstände der Naturwissenschaften der Bestimmbarkeit auch entziehen, oder darum, dass konkrete Wissenschaft immer durch noch gründlichere Erkenntnis ersetzt wird. Hier geht es um die wissenschaftlichen Gegenstände selbst. Naturwissenschaften definieren sich über Gegenstände, die keinen Willen haben.
Sozialwissenschaftliche Theorien dagegen-davonabgesehen, dass sie in einem unmittelbaren Sinne falsch sein können - leiden immer auch darunter, dass sie einen Gegenstand haben, den die Menschen bewusst verändern können. Wenn wir also von Menschen hergestellte Gegenstände klassifizieren, können wir nicht verhindern, dass Menschen die postulierte Ordnung - begründet - brechen.
Die Tret-Nähmaschine ist eine ,Maschine‘, der die ,vernünftige‘ Energieversorgung fehlt. Sie ist eine typisch anachronistische Ingenieursleistung: Ein Werkzeug, das die Entwicklungsstufe der Maschine hat, aber - energiemässig - keine ist. Die Erfinder(ingenieure), die im Falle der ersten Nähmaschinen mehr technische Pioniere als Ingenieure waren, widersetzten sich unserer Definition nach dem Gebot der Praxis. Die Praxis (hier wohl der Markt) verlangte nach einem Werkzeug, das die relativ einfache, aber (für Handwerkerinnen) komplizierte Nähbewegung ersetzte, aber nicht zu teuer war. Was "teuer" damals geheissen hat, zeigen heute weniger die vollautomatischen Billigst-Nähmaschinen, als die fehlende Strominfrastruktur in den Entwicklungsländern. Die Tret-Nähmaschine erfüllt bestimmte Gebote des praktischen Lebens. Wer etwa, um Wasser zu schöpfen, einen lebenden Ochsen an den Ziehbrunnen spannt, macht dies wohl eher, weil er kein vernünftigeres Werkzeug, als weil er etwas gegen unsere Definition hat. Gleichwohl hat er, oder vielmehr macht er etwas gegen die Definition. Der Ochse am Ziehbrunnen ist dem Ochsenbesitzer, was der Sklave seinem Feudalherrn und was unser Schmidt seinem Taylor. Alle überbrücken eine vor-zeitige Idee. Sie stehen für antizipierte Werkzeuge, die noch nicht entwickelt sind. So gesehen verfolgen die Ingenieure eine antizipierte Wirklichkeit, sie ,ent-wickeln‘, packen aus oder entfalten, was dem Werkzeug immer schon innewohnt. Ingenieure entwickeln das Werkzeug im besten Sinne des Wortes. Sie entwickeln, wenn man so will, die Menschen aus ihrer viehischen Not, andere Lebewesen, insbesondere andere Menschen als Werkzeuge zu missbrauchen"
Bewegung gesetzt, bildet eine Maschine”.
Als Nähmaschine bezeichne ich - tautologischerweise - eine Maschine zum Nähen. Meine Nähmaschine hat einen Motor. Aber ist Grossmutters Tret-Nähmaschine (k)eine Maschine?
Zwar ist klar, dass die Tret-Nähmaschine, nur weil sie "Maschine" genannt wird, sowenig eine Maschine sein muss, wie die Erdbeere eine Beere ist. Aber verdrängen lässt sich die Frage, indem man auf den sprachlich-ausdrücklichen Aspekt des Einwandes verweist, nicht. Die Tret-Nähmaschine verweist auf ein tieferliegendes Problem. Definitionen implizieren durch ihre Begriffsbäume Verwandtschafts-oder Entwicklungstheorien. Zu unserer Einteilung der Tierwelt beispielsweise gehören implizite Evolutionstheorien. Die unterstellten Verwandtschaften können falsch oder bedingungsmässig unvollständig sein, wobei "falsch" hier weder logisch noch letztlich, sondern umgangssprachlich gemeint ist. Definitionen und die in ihnen steckenden "Theorien" sind umgangssprachlich falsch, wenn sie am praktischen Anliegen scheitern. Ein Wal ist in diesem Sinne kein Fisch, weil er nicht in einem unmittelbar über dem Wasser gedeckten Aquarium gehalten werden kann. In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr, dass es Theorien gibt, deren Gegenstände sich "bewusst" gegen die Theorie verhalten können. Naturwissenschaftliche Gegenstände haben kein Eigenleben, die Erde muss sich drehen, ein Magnet muss Strom induzieren, wenn er unter bestimmten Bedingungen steht. Es geht nicht darum, dass sich die letzten Gegenstände der Naturwissenschaften der Bestimmbarkeit auch entziehen, oder darum, dass konkrete Wissenschaft immer durch noch gründlichere Erkenntnis ersetzt wird. Hier geht es um die wissenschaftlichen Gegenstände selbst. Naturwissenschaften definieren sich über Gegenstände, die keinen Willen haben.
Sozialwissenschaftliche Theorien dagegen-davonabgesehen, dass sie in einem unmittelbaren Sinne falsch sein können - leiden immer auch darunter, dass sie einen Gegenstand haben, den die Menschen bewusst verändern können. Wenn wir also von Menschen hergestellte Gegenstände klassifizieren, können wir nicht verhindern, dass Menschen die postulierte Ordnung - begründet - brechen.
Die Tret-Nähmaschine ist eine ,Maschine‘, der die ,vernünftige‘ Energieversorgung fehlt. Sie ist eine typisch anachronistische Ingenieursleistung: Ein Werkzeug, das die Entwicklungsstufe der Maschine hat, aber - energiemässig - keine ist. Die Erfinder(ingenieure), die im Falle der ersten Nähmaschinen mehr technische Pioniere als Ingenieure waren, widersetzten sich unserer Definition nach dem Gebot der Praxis. Die Praxis (hier wohl der Markt) verlangte nach einem Werkzeug, das die relativ einfache, aber (für Handwerkerinnen) komplizierte Nähbewegung ersetzte, aber nicht zu teuer war. Was "teuer" damals geheissen hat, zeigen heute weniger die vollautomatischen Billigst-Nähmaschinen, als die fehlende Strominfrastruktur in den Entwicklungsländern. Die Tret-Nähmaschine erfüllt bestimmte Gebote des praktischen Lebens. Wer etwa, um Wasser zu schöpfen, einen lebenden Ochsen an den Ziehbrunnen spannt, macht dies wohl eher, weil er kein vernünftigeres Werkzeug, als weil er etwas gegen unsere Definition hat. Gleichwohl hat er, oder vielmehr macht er etwas gegen die Definition. Der Ochse am Ziehbrunnen ist dem Ochsenbesitzer, was der Sklave seinem Feudalherrn und was unser Schmidt seinem Taylor. Alle überbrücken eine vor-zeitige Idee. Sie stehen für antizipierte Werkzeuge, die noch nicht entwickelt sind. So gesehen verfolgen die Ingenieure eine antizipierte Wirklichkeit, sie ,ent-wickeln‘, packen aus oder entfalten, was dem Werkzeug immer schon innewohnt. Ingenieure entwickeln das Werkzeug im besten Sinne des Wortes. Sie entwickeln, wenn man so will, die Menschen aus ihrer viehischen Not, andere Lebewesen, insbesondere andere Menschen als Werkzeuge zu missbrauchen"
[0 Kommentar]
Inhalt
Verallgemeinerung und Abstraktion - September 10, 2015
Verallgemeinerung und Abstraktion gehören umgangssprachlich diffus als Quasisysnonyme zueinander. Da es aber offensichtlich zwei verschiedene Wörter sind, liegt nahe, dass ich mir eine Differenz dialogisch bewusst mache und so erkenne, was im Alltag durch das Synomisieren unterschlagen wird. Vorweg muss ich sagen, was ich als "dialogisches Erkennen" bezeichne, weil ich auch diese Wörter nicht im umgangssprachlichen Sinn verwende. Dialog verwende ich nicht für "irgendwie friedenstiftende Gespräche", sondern im Sinne von "dia Logos", womit ich literal meine, dass ich durch das Sprechen hindurch (dia) zu meinem je eigenen Bewusstsein (Logos) komme. Mit Erkennen bezeichne ich nicht ein naives Für-wahr-mehmen, sondern ein aktives Teilnehmen, wie es etwa in der biblischen Formulierung erscheint, wo Adam Eva erkannte, worauf sie einen Sohn gebar (Genesis,4).
Als Abstraktion bezeichne ich das Verhältnis zwischen zwei Beobachtungen, die ich auf dasselbe Referenzobjekt beziehe, wobei die abstraktere Beobachtung weniger Aspekte des Objektes bezeichnet. Wenn mir beispielsweis e jemand erzählt, dass er einen Hund gesehen hat, dann könnte er mir stattdessen auch erzählen, das er einen Pudel oder ein Tier gesehen hat. Diese Unterscheidung beziehe ich nicht darauf, was er gesehen hat, sondern auf die Beschreibung von dem, was er gesehen hat. Seine Wahrnehmung ist dafür unerheblich, ich höre ja nur, was gesagt, also beobachtet wird.
Ich unterscheide "Hund" und "Tier" als verschiedene Beobachtungen. Wenn ich selbst etwas wahrnehme, was ich als Hund oder als Tier bezeichnen kann, muss ich mich für eine der Beobachtungen entscheiden. Wann also sage ich - im gegebenen Fall - Hund und wann sage ich Tier? Das ist nicht vom Wahrnehmungsgegenstand abhängig, sondern davon, worüber ich sprechen will.
Von Tieren spreche ich etwa, wenn ich die Sonderstellung des Menschen hervorheben will, während ich von Hunden spreche, wenn ich bestimmte Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren beobachte. Der Unterschied,
den ich zwischen Hund und Tier mache, zeigt sich begrifflich, also wenn ich diese Begriffe durch Definitions-Sätze ersetze. Über den Hund sage ich in der Definition alles, was ich über das Tier sage (Genus proximum) und zusätzlich, wie ich den Hund von aneren Tieren unterscheide (differentia specifica). Umgekehrt lasse ich das, was ich über den Hund zusätzlich sage, weg, wenn ich das Tier definiere. Dieses Weglassen bezeichne ich als Abstraktion, was pseudoetymologisch eine Art Kunstwort für dieses spezielle Weglassen ist.
Das, was ich sehe und beschreibe, wenn ich von einem Hund spreche, ist durch meine Abstraktion nicht betroffen. Ein Hund und meine sinnliche Wahrnehmung des Hundes verändert sich in keiner Weise, wenn ich ihn als Tier bezeichne. Die Abstraktion betrifft nur meine Beschreibung. Im jeweiligen Oberbegriff lasse ich Bedeutungs-Aspekte und Form-Bestimmungen weg, die ich auf der Ebene des Begriffes verwende.
Das, was ich als Verallgemeinerung bezeichne, betrifft dagegen das Referenzobjekt. Ich erkenne in jedem Hund den Hund - unabhängig davon, wie ich ihn bezeichne. Wenn ich eine Pudel sehe oder von einem Pudel spreche, meine ich eine besondere Erscheinung eines allgemeineren Falles. Das je konkrete Tier (hier der Hund) ist keine Abweichung von einem "Durchschnittstier", sondern eine Erscheinungsform aufgrund welcher ich - unter Verwendung von beigebrachten Kategorien - mir das je spezifische und das Allgemeine (hier Tier) bewusst machen kann. Dabei werde ich nicht wie das sprichwörtliche Kleinkind, das ein Kuh als Wauwau bezeichnet, bei jedem konkreten Tier eine je beliebige Verallgemeinerung leisten.
Der Hund wehrt sich nicht gegen meine Verallgemeinerung und ich weiss nicht, ob und inwiefern er sich als Hund erkennt. Aber ich mag es nicht, wenn ich in vermeintlichen Verallgemeinerungen anderer Menschen erscheine. Ich mag nicht, wenn ich als Objekt einer Klasse zugeordnet werde. Und ich brauche nicht sehr viel Empathie um zu erkennen, dass andere Menschen das sehr oft auch nicht mögen. Dazu gibt es manifeste Kommunikationen, etwa der sogenannte Gender-Diskurs, in welchem ganz bestimmte Verallgemeinerungen problematisiert werden. Ich selbst sehe mich zwar als Mann, aber nicht als das, was gemeinhin als "Mann" beobachtet wird. In extremeren Fällen wird sogar die Kommunikation abgewehrt. Das Wort "Neger" beispielsweise steht für eine Zurechnung, die kein Mensch mehr auf sich bezogen mag. Diese spezielle Fälle verdeutlichen, dass dabei die Abstraktion keine wesentliche Rolle spielt.
Die subtilste Form der Verallgemeinerung erkenne ich in "Man"-
Formulierungen, die oft auch in einer "Wir"-Form erscheinen. Diese Verallgemeinerungen beruhen auf sozusagen totalen Abstraktionen, weil das gemeinte Allgemeine gar nicht mehr bezeichnet und mithin der Reflexion entzogen wird. Unter subjektwissenschaftlichen Gesichtspunkten schreibe ich, was ich beobachte. Ich schliesse damit weder ein noch aus, dass andere dasselbe beobachten. Meine Abstraktionen mache ich mir durch Explikationen meiner Definitionen bewusst, während Verallgemeinerungen nur in Form von gemeinsamen Interessen erscheinen, die ich nie alleine bezeichnen kann.
e jemand erzählt, dass er einen Hund gesehen hat, dann könnte er mir stattdessen auch erzählen, das er einen Pudel oder ein Tier gesehen hat. Diese Unterscheidung beziehe ich nicht darauf, was er gesehen hat, sondern auf die Beschreibung von dem, was er gesehen hat. Seine Wahrnehmung ist dafür unerheblich, ich höre ja nur, was gesagt, also beobachtet wird.
Ich unterscheide "Hund" und "Tier" als verschiedene Beobachtungen. Wenn ich selbst etwas wahrnehme, was ich als Hund oder als Tier bezeichnen kann, muss ich mich für eine der Beobachtungen entscheiden. Wann also sage ich - im gegebenen Fall - Hund und wann sage ich Tier? Das ist nicht vom Wahrnehmungsgegenstand abhängig, sondern davon, worüber ich sprechen will.
Von Tieren spreche ich etwa, wenn ich die Sonderstellung des Menschen hervorheben will, während ich von Hunden spreche, wenn ich bestimmte Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren beobachte. Der Unterschied,
den ich zwischen Hund und Tier mache, zeigt sich begrifflich, also wenn ich diese Begriffe durch Definitions-Sätze ersetze. Über den Hund sage ich in der Definition alles, was ich über das Tier sage (Genus proximum) und zusätzlich, wie ich den Hund von aneren Tieren unterscheide (differentia specifica). Umgekehrt lasse ich das, was ich über den Hund zusätzlich sage, weg, wenn ich das Tier definiere. Dieses Weglassen bezeichne ich als Abstraktion, was pseudoetymologisch eine Art Kunstwort für dieses spezielle Weglassen ist.
Das, was ich sehe und beschreibe, wenn ich von einem Hund spreche, ist durch meine Abstraktion nicht betroffen. Ein Hund und meine sinnliche Wahrnehmung des Hundes verändert sich in keiner Weise, wenn ich ihn als Tier bezeichne. Die Abstraktion betrifft nur meine Beschreibung. Im jeweiligen Oberbegriff lasse ich Bedeutungs-Aspekte und Form-Bestimmungen weg, die ich auf der Ebene des Begriffes verwende.
Das, was ich als Verallgemeinerung bezeichne, betrifft dagegen das Referenzobjekt. Ich erkenne in jedem Hund den Hund - unabhängig davon, wie ich ihn bezeichne. Wenn ich eine Pudel sehe oder von einem Pudel spreche, meine ich eine besondere Erscheinung eines allgemeineren Falles. Das je konkrete Tier (hier der Hund) ist keine Abweichung von einem "Durchschnittstier", sondern eine Erscheinungsform aufgrund welcher ich - unter Verwendung von beigebrachten Kategorien - mir das je spezifische und das Allgemeine (hier Tier) bewusst machen kann. Dabei werde ich nicht wie das sprichwörtliche Kleinkind, das ein Kuh als Wauwau bezeichnet, bei jedem konkreten Tier eine je beliebige Verallgemeinerung leisten.
Der Hund wehrt sich nicht gegen meine Verallgemeinerung und ich weiss nicht, ob und inwiefern er sich als Hund erkennt. Aber ich mag es nicht, wenn ich in vermeintlichen Verallgemeinerungen anderer Menschen erscheine. Ich mag nicht, wenn ich als Objekt einer Klasse zugeordnet werde. Und ich brauche nicht sehr viel Empathie um zu erkennen, dass andere Menschen das sehr oft auch nicht mögen. Dazu gibt es manifeste Kommunikationen, etwa der sogenannte Gender-Diskurs, in welchem ganz bestimmte Verallgemeinerungen problematisiert werden. Ich selbst sehe mich zwar als Mann, aber nicht als das, was gemeinhin als "Mann" beobachtet wird. In extremeren Fällen wird sogar die Kommunikation abgewehrt. Das Wort "Neger" beispielsweise steht für eine Zurechnung, die kein Mensch mehr auf sich bezogen mag. Diese spezielle Fälle verdeutlichen, dass dabei die Abstraktion keine wesentliche Rolle spielt.
Die subtilste Form der Verallgemeinerung erkenne ich in "Man"-
Formulierungen, die oft auch in einer "Wir"-Form erscheinen. Diese Verallgemeinerungen beruhen auf sozusagen totalen Abstraktionen, weil das gemeinte Allgemeine gar nicht mehr bezeichnet und mithin der Reflexion entzogen wird. Unter subjektwissenschaftlichen Gesichtspunkten schreibe ich, was ich beobachte. Ich schliesse damit weder ein noch aus, dass andere dasselbe beobachten. Meine Abstraktionen mache ich mir durch Explikationen meiner Definitionen bewusst, während Verallgemeinerungen nur in Form von gemeinsamen Interessen erscheinen, die ich nie alleine bezeichnen kann.
[0 Kommentar]
Inhalt
Deutschland verlässt den Euro - September 6, 2015
Ein kleine interesante Inversion wird jetzt von einigen US- Politökonomen (Prestowitz und Prout) lanciert:
Nicht Griechenland, sondern Deutschland müsste den Euro verlassen. Das würde die neue Mark aufwerten und den Euro abwerten und damit ein neues Spiel um ein relatives Gleichgewicht begründen.
Die US-Oekos hegen natürlich die Hoffnung, dass sie auf diesem Weg die Profite, die Deutschland zur Zeit in der Eurozone macht, teilweise (oder ganz) übernehmen könnten.
Davon abgesehen, ist die Idee bedenkenswert - und wird wohl bald von einigen EU-Staaten "bedenkt".
Deutschland wird das kaum freiwillig tun, aber die anderen Mitglieder des Euros werden über kurz oder lang das Ungleichgewicht auf diese Weise thematisieren. Das ist eine gefährliche Kurve, denn sie wird Deutschland viel stärker isolieren als das bisher nur medial geschehen ist. Die Erfahrung lehrt,, was Deutschland füher in dieser Situation gemacht hat und wirft ein Licht auf die Popularisierungen von sogenannten Rechtspolitiken.
Diese (nicht ganz neue und deshalb als "Nazitum" bezeichnete) Politik erscheint in dieser Perspektive nicht als eine Politik von wie auch immer gesinnten "Rechten", sondern als Option der deutschen Regierung, die sich bislang nur durch unterschwelliges Abwarten und einem davon ablenkenden Griechenlandpoker auszeichnet. Die Kriegsgefahr nimmt zu, wenn Deutschland in Bedrängnis nach rechts rücken wird.
Politökonomen (Prestowitz und Prout) lanciert:
Nicht Griechenland, sondern Deutschland müsste den Euro verlassen. Das würde die neue Mark aufwerten und den Euro abwerten und damit ein neues Spiel um ein relatives Gleichgewicht begründen.
Die US-Oekos hegen natürlich die Hoffnung, dass sie auf diesem Weg die Profite, die Deutschland zur Zeit in der Eurozone macht, teilweise (oder ganz) übernehmen könnten.
Davon abgesehen, ist die Idee bedenkenswert - und wird wohl bald von einigen EU-Staaten "bedenkt".
Deutschland wird das kaum freiwillig tun, aber die anderen Mitglieder des Euros werden über kurz oder lang das Ungleichgewicht auf diese Weise thematisieren. Das ist eine gefährliche Kurve, denn sie wird Deutschland viel stärker isolieren als das bisher nur medial geschehen ist. Die Erfahrung lehrt,, was Deutschland füher in dieser Situation gemacht hat und wirft ein Licht auf die Popularisierungen von sogenannten Rechtspolitiken.
Diese (nicht ganz neue und deshalb als "Nazitum" bezeichnete) Politik erscheint in dieser Perspektive nicht als eine Politik von wie auch immer gesinnten "Rechten", sondern als Option der deutschen Regierung, die sich bislang nur durch unterschwelliges Abwarten und einem davon ablenkenden Griechenlandpoker auszeichnet. Die Kriegsgefahr nimmt zu, wenn Deutschland in Bedrängnis nach rechts rücken wird.
[0 Kommentar]
Inhalt
Technikgeschichte (zu diasynchron, Teil 3) - August 28, 2015
Technikgeschichte ist in einer spezifischen Weise simpel, wenn ich sie als Geschichte in einer Zeittafel erzähle. Ich kann dann jedem Gegenstand, den ich als technisch erachte, eine Zeit zuordnen und schon steht die Geschichte. Wenn ich im Nachhinein weitere Gegenstände finde, kann ich sie problemlos einfügen. Die Zeitleiste bestimmt wo ich sie einordne.
Wenn ich den Gegenständen den Zeitpunkt ihres ersten Auftretens zuordne, schreibe ich - was sehr konventionell ist - eine Erfindungengeschichte. Das einzige Problem besteht zunächst in der Wahl der Gegenstände. Wenn ich die Geschichte überdies relativ endlich halten will, muss ich eine Auswahl treffen, weil ich dann nicht jeden Gegenstand aufzählen kann. Ich brauche dazu ein Kriterium, das muss mir aber nicht bewusst sein. Und ich kann auch in diesem Fall jederzeit weitere Items am genau richtigen Ort einfügen.
Der Witz solcher Geschichten oder Zeittafeln besteht darin, keine Entwicklungen zu beschreiben. Jeder Gegenstand steht für sich, es spielt für die Geschichte keine Rolle, welche Voraussetzungen seine Erfindung hatte und inwiefern er mit anderen Gegenständen verwandt ist. Einige Geschichtenerzähler tun sich schwer damit, dass bestimmte Gegenstände im Laufe der Zeit wieder verschwinden und später nochmals erfunden werden. In den konventionellen Technikgeschichten erscheint etwa die Erfindung der Dampfmaschine oder die des Schiesspulvers zuerst als prinzipiell und erst später als eigentlich. Wenn ich sage, dass Heron von Alexandria die Dampfmaschine im Prinzip erfunden hat, sage i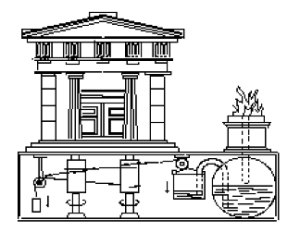 ch eigentlich, dass ich seine Erfindung nicht oder eben nur im Prinzip in Betracht ziehe, weil sie - im Prinzip - keine relevanten Beitrag zur aktuellen Technik darstellt. Welche Beiträge ich für relevant halte, ist von einem Kriterium abhängig, das mir aber auch keineswegs bewusst sein muss. In vielen gängigen Geschichten wird J. Watt als Erfinder der Dampfmaschine genannt, weil seine Dampfmaschine als relevant beobachtet wird. In diesen Geschichten wird nicht nur Heron "vergessen".
In Bezug auf die Zeittafel muss ich mich natürlich entscheiden, welche Erfindung ich als "Dampfmaschine" bezeichne und welche eben noch nicht, aber nachdem ich den Gegenstand bestimmt habe, steht fest, wo er in der Geschichte erscheint. Die Dampfmaschine von J. Watt erscheint 1769. Kritisch ist nur, was im erwähnten Fall als Dampfmaschine gelten soll. Das ist aber eine technische, nicht eine historische Frage. Interessanterweise wurde die erste eigentliche Technikgeschichte der Dampfmaschine gewidmet. Sie wurde vom Ingenieur C. Matschoss, also von einem Techniker, nicht von einem Historiker geschrieben.
Die "Geschichte" wird etwas komplizierter, wenn ich die Zeitleiste weglasse. Einerseits mache ich mir damit einfach das Naturwüchsige der Zeittafel bewusst, habe dann andrerseits aber das Problem, wie ich die Ereignisse (anders) auswählen und sortieren soll. Indem ich die Zeitleiste weglasse, wird nicht nur das Sortieren der Ereignisse zu einer neuen Aufgabe, sondern vor allem auch, welche Ereignisse ich wie sortiere. Ich setze Ereignisse, die ich als technisch erachte, in eine Beziehung, was zuvor durch die naturwüchsige Zeitreihe
aufgehoben war.
Ich beobachte die Technik als Resultat einer Entwicklung, in welcher sich mein Verhalten dadurch verändert, dass ich effizientere Verfahren entwickle und verwende. Die alten Griechen haben viele effiziente Verfahren entwickelt, sie aber nicht angewendet. Wenn ich sachliche Entwicklungen oder Differenzierungen von Verfahrensweisen darstelle, impliziere ich natürlich auch "Zeit", weil Entwicklungen tautologischerweise in der Zeit stattfinden. Dabei handelt es sich aber um eine Systemzeit, nicht um historische Zeitpunkte. Damit J. Watt die Dampfmaschine verbessern konnte, musste die Dampfmaschine bereits existieren, aber es spielt für die Verbesserung keine Rolle, wie lange sie schon existierte und wann sie erfunden wurde. Ich beobachte die technische Entwicklung also in diesem historischen Sinn unabhängig von der Zeit.
Ich komme aber natürlich nicht umhin, effiziente Verfahren auszuwählen. Der Ansatz, den ich hier verfolge, besteht darin, meine subjektive Betroffenheit als Kriterium zu verwenden. Die Zeit ist darin als perspektivischer
Beobachtungszeitpunkt aufgehoben. Ich beobachte in einem deiktischen Sinn hier und jetzt. Ich unterscheide jenseits der Zeitgeschichte fünf - bereits erläuterte - Bereiche, die ich auch nicht technisch sondern subjektiv und produktiv begründe. Ich brauche Nahrung, Wohnung und allerlei Geräte, nur schon um die Nahrung kühl und die Wohnung warm zu halten. Es geht dabei nicht um irgendeine psychologistische Bedürfnispyramide im Sinne von Maslow, ich brauche zum Leben viel mehr als Nahrung und Wohnung. Ich beobachte hier aber nur, was ich als so "gemacht zu" begreife, dass dafür Werkzeug gebraucht werden können. Die ganze Natur, mich selbst und all meine Beziehungen zu anderen Menschen erkenne ich nicht als so "gemacht".
Evolutionstheoretische Technikgeschichten schreibe ich - tautologischerweise - rückwärts. In vielen vermeintlichen Technikgeschichten spielt beispielsweise die Dampfmaschine eine sehr wichtige Rolle, die normalerweise nicht reflektiert wird. Ihre Relevanz bezieht die Dampfmaschine in solchen Geschichten - wie bewusst auch immer - daraus, dass sie für die Epoche der Industrialisierung steht. Die Industrialisierung ist ein historischer Prozess, der wichtig sein mag, aber sie ist kein technisches Ereignis, auch wenn die Technik darin eine Rolle spielt. Die Dampfmaschine dient also der Charakterisierung einer Epoche in einer ganz anderen Geschichte. Für mich - hier und jetzt - spielt die Dampfmaschine, auch jene von J. Watt im Prinzip keine Rolle, weil sie in meinem Leben, vom Dampfkochtopf und Vergnügungsfahrten auf dem Dampfschiff abgesehen, praktisch keine Rolle spielt. In meinem Leben spielen aber andere Motoren eine grosse Rolle und wenn ich die Entwicklung dieser Motoren anschaue, spielen darin die Dampfmaschinen die Rolle von noch rezenten Vertretern einer Evolution. Ich verstehe die Dampfmaschine in einem spezifischen Sinn wie die Anatomie der Affen, weil ich - rückwärtsblickend - weiss, was daraus geworden ist. Die Relevanz der Dampfmaschine begreife ich dabei technisch, nicht irgendwie sozial. In dieser Differenz erkenne ich nebenbei bemerkt auch den Grund, warum auch Soziologen keine Technik (er)kennen, sondern nur gesellschaftliche Folgen von nicht-funktionierender Technik.
Technisch kann ich überdies die Dampfmaschine wie etwa das Rad oder Schrauben nur als Teil von verfahrenstragenden Erfindungen beobachten. Die Dampfmaschine allein hat keinen Sinn, weil sie weder als Gerät noch als Werkzeug eine Funktion erfüllt.
ch eigentlich, dass ich seine Erfindung nicht oder eben nur im Prinzip in Betracht ziehe, weil sie - im Prinzip - keine relevanten Beitrag zur aktuellen Technik darstellt. Welche Beiträge ich für relevant halte, ist von einem Kriterium abhängig, das mir aber auch keineswegs bewusst sein muss. In vielen gängigen Geschichten wird J. Watt als Erfinder der Dampfmaschine genannt, weil seine Dampfmaschine als relevant beobachtet wird. In diesen Geschichten wird nicht nur Heron "vergessen".
In Bezug auf die Zeittafel muss ich mich natürlich entscheiden, welche Erfindung ich als "Dampfmaschine" bezeichne und welche eben noch nicht, aber nachdem ich den Gegenstand bestimmt habe, steht fest, wo er in der Geschichte erscheint. Die Dampfmaschine von J. Watt erscheint 1769. Kritisch ist nur, was im erwähnten Fall als Dampfmaschine gelten soll. Das ist aber eine technische, nicht eine historische Frage. Interessanterweise wurde die erste eigentliche Technikgeschichte der Dampfmaschine gewidmet. Sie wurde vom Ingenieur C. Matschoss, also von einem Techniker, nicht von einem Historiker geschrieben.
Die "Geschichte" wird etwas komplizierter, wenn ich die Zeitleiste weglasse. Einerseits mache ich mir damit einfach das Naturwüchsige der Zeittafel bewusst, habe dann andrerseits aber das Problem, wie ich die Ereignisse (anders) auswählen und sortieren soll. Indem ich die Zeitleiste weglasse, wird nicht nur das Sortieren der Ereignisse zu einer neuen Aufgabe, sondern vor allem auch, welche Ereignisse ich wie sortiere. Ich setze Ereignisse, die ich als technisch erachte, in eine Beziehung, was zuvor durch die naturwüchsige Zeitreihe
aufgehoben war.
Ich beobachte die Technik als Resultat einer Entwicklung, in welcher sich mein Verhalten dadurch verändert, dass ich effizientere Verfahren entwickle und verwende. Die alten Griechen haben viele effiziente Verfahren entwickelt, sie aber nicht angewendet. Wenn ich sachliche Entwicklungen oder Differenzierungen von Verfahrensweisen darstelle, impliziere ich natürlich auch "Zeit", weil Entwicklungen tautologischerweise in der Zeit stattfinden. Dabei handelt es sich aber um eine Systemzeit, nicht um historische Zeitpunkte. Damit J. Watt die Dampfmaschine verbessern konnte, musste die Dampfmaschine bereits existieren, aber es spielt für die Verbesserung keine Rolle, wie lange sie schon existierte und wann sie erfunden wurde. Ich beobachte die technische Entwicklung also in diesem historischen Sinn unabhängig von der Zeit.
Ich komme aber natürlich nicht umhin, effiziente Verfahren auszuwählen. Der Ansatz, den ich hier verfolge, besteht darin, meine subjektive Betroffenheit als Kriterium zu verwenden. Die Zeit ist darin als perspektivischer
Beobachtungszeitpunkt aufgehoben. Ich beobachte in einem deiktischen Sinn hier und jetzt. Ich unterscheide jenseits der Zeitgeschichte fünf - bereits erläuterte - Bereiche, die ich auch nicht technisch sondern subjektiv und produktiv begründe. Ich brauche Nahrung, Wohnung und allerlei Geräte, nur schon um die Nahrung kühl und die Wohnung warm zu halten. Es geht dabei nicht um irgendeine psychologistische Bedürfnispyramide im Sinne von Maslow, ich brauche zum Leben viel mehr als Nahrung und Wohnung. Ich beobachte hier aber nur, was ich als so "gemacht zu" begreife, dass dafür Werkzeug gebraucht werden können. Die ganze Natur, mich selbst und all meine Beziehungen zu anderen Menschen erkenne ich nicht als so "gemacht".
Evolutionstheoretische Technikgeschichten schreibe ich - tautologischerweise - rückwärts. In vielen vermeintlichen Technikgeschichten spielt beispielsweise die Dampfmaschine eine sehr wichtige Rolle, die normalerweise nicht reflektiert wird. Ihre Relevanz bezieht die Dampfmaschine in solchen Geschichten - wie bewusst auch immer - daraus, dass sie für die Epoche der Industrialisierung steht. Die Industrialisierung ist ein historischer Prozess, der wichtig sein mag, aber sie ist kein technisches Ereignis, auch wenn die Technik darin eine Rolle spielt. Die Dampfmaschine dient also der Charakterisierung einer Epoche in einer ganz anderen Geschichte. Für mich - hier und jetzt - spielt die Dampfmaschine, auch jene von J. Watt im Prinzip keine Rolle, weil sie in meinem Leben, vom Dampfkochtopf und Vergnügungsfahrten auf dem Dampfschiff abgesehen, praktisch keine Rolle spielt. In meinem Leben spielen aber andere Motoren eine grosse Rolle und wenn ich die Entwicklung dieser Motoren anschaue, spielen darin die Dampfmaschinen die Rolle von noch rezenten Vertretern einer Evolution. Ich verstehe die Dampfmaschine in einem spezifischen Sinn wie die Anatomie der Affen, weil ich - rückwärtsblickend - weiss, was daraus geworden ist. Die Relevanz der Dampfmaschine begreife ich dabei technisch, nicht irgendwie sozial. In dieser Differenz erkenne ich nebenbei bemerkt auch den Grund, warum auch Soziologen keine Technik (er)kennen, sondern nur gesellschaftliche Folgen von nicht-funktionierender Technik.
Technisch kann ich überdies die Dampfmaschine wie etwa das Rad oder Schrauben nur als Teil von verfahrenstragenden Erfindungen beobachten. Die Dampfmaschine allein hat keinen Sinn, weil sie weder als Gerät noch als Werkzeug eine Funktion erfüllt.
[0 Kommentar]
Inhalt
Hyper-Buch - August 22, 2015
Als Hyperbuch bezeichne ich – in einer bewusst gewählten Metapher – einen Hypertext, wenn ich einen begrenzten Text zu einem begrenzten Thema 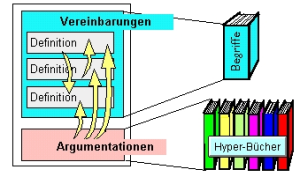 schreiben will. Ich bezeichne ihnden Text auch als – noch nicht entwickeltes – Hyperbuch, weil ich ihn auf einem Computer schreibe und Links in den Text einfüge. Das eigentliche Hyperbuch entwickelt sich – im Rahmen einer Hyperbibliothek – durch verlinkte Textauslagerungen, wodurch es prägnant wird, also wenig Redundanz enthält, weil die Vereinbarungen, etwa in Form von Definitionen im Hyperlexikon ausgelagert sind.
Als Hyperleser kann ich abschätzen, welche Auslagerungen ich verfolgen muss und welche nicht, zumal wenn ich den Charakter der Auslagerungen auch kenne. Begriffsdefinitionen lese ich genau und nur dann, wenn ich merke, dass meine Begriffe nicht passen oder der Text damit keinen Sinn ergibt.
Als Hyperbuch bezeichne ich eine – beispielsweise durch einen “vorwärts”-Link markierte Reihe von Hypertextteilen, die ich wie Buch lesen kann, weil sie in der vorgeschlagenen Reihenfolge eine buchartige Argumentation ergeben. Die primitivste Form des Hyperbuches erstelle ich, indem ich einen vorhandenen Buchtext zerschneide und die Teile in ihrer ursprünglichen Reihenfolge verlinke. Nach diesem Muster werden sehr viele Hypermedia-Werke gestaltet, die einfach hyper-modern sein wollen.
Hyper-Bücher sind also keine Bücher; sie sind nicht aus gebundenem oder broschierten Papier, sondern Hypertext(-teil)e, die wie Bücher gelesen werden können, weil sie Argumentationen enthalten. Hyper-Bücher bestehen aus anderen Hyper-Bücher oder sie sind elementar, also eigenständige Argumente in der Hyper-Bibliothek. Jede Argumentation kann in verschiedenen Hyper-Büchern verwendet werden, einige Hyper-Bücher sind Teilmengen von andern.
Ich unterscheide verschiedene Hyperbuchformen. Hier will ich aber das Wesen des Hyperbuches, das dem spezifischen Textträger entspringt, hervorheben. Der Computer hat als Textträger das Buch in einem evolutionstheoretischen Sinn abgelöst. Das heisst, es gibt neben dem Computer weiterhin Bücher, wie es neben den Menschen auch weiterhin Affen gibt. In plausiblen biologischen Evolutionsgeschichten – wie sie etwa K. Holzkamp erzählt – waren die ersten Menschen unter den Primaten eine Randerscheinung, die wie etwa die Neandertaler auch dann und wann wieder ganz verschwunden sind. Evolutionär erfolgreiche Entwicklung erkläre ich mir damit, dass ihre Vorteile ihre Nachteile im je gegebenen Kontext überwiegen.
Ich vergleiche dabei nicht verschiedene noch existierende Arten, sondern spezifische Aspekte, die bei der entwickelteren Art hinzugekommen sind. Menschen gestalten ihre Umwelt, wozu sie Werkzeuge herstellen. Affen können auch ohne Werkzeuge gut leben.
Menschen stellen Text und damit verbunden Textträger her. Sie verwenden dabei Werkzeuge, die sie in einem evolutionären Sinn entwickeln. Als entwickelste Form des Textträgers setz(t)en sich Computer gegenüber bedruckten Textträgern im evolutionären Prozess allmählich durch, was ich mir dadurch erkläre, dass sie die spezifische Begrenzung von Büchern nicht haben. Die Bücher sind aber bislang nicht ausgestorben. Vielmehr gab es zunächst auch auf den Computern vor allem hergebrachte Texte und mithin im hergebrachten Empfinden auch “Bücher”, wobei die eigentliche Buchproduktion noch lange Zeit so dominant war, so dass das “Buch” – als Textmengenart -weiterhin bestehen blieb. Ich lese auf meinem Computer deshalb auch sogenannte e-books.
Computer sprengen Text, sie machen Hypertext möglich. Durch das WWW wurde – wenn dort auch nicht in einem dominanten Sinn – Hypertext massenhaft. Hypertext sehe ich als Grundlage für ein neues Verständnis von Textmengen und Textgrenzen. Während die sagenhaften Bibliothekare von Alexandria noch von allen Büchern, die es in der damaligen Welt gab, eine Kopie haben wollten, haben die meisten wirklich existierenden Bibliotheken den Anspruch von möglichst vielen relevanten Büchern ein Exemplar im Gestell zu haben.
Durch die Kategorien, die ich anhand von Hypertext auf dem Computer generiere, sehe ich das Buch und die Bibliothek als technisch primitivere Formen einer Evolution, so wie ich im Affen in gewisser Hinsicht eine Vorstufe des Menschen sehe, was ich nur kann, weil ich ihn mit dem Menschen vergleichen kann.
Das Buch und noch viel mehr das Massenbuch, das Gutenberg zugedichtet wird, verbreitet Text, wie die Kinotechnik Bilder und das Radio Lautfolgen verbreitet. Das einzelne Buch hat eine massive Begrenzung, es kann nur begrenzte Textmengen enthalten. Damit verbunden hat das Buch ein massenhaftes Normalempfinden dafür begründet, dass und wie Text begrenzt sein sollte.
Wenn ich Hypertext schreibe, produziere ich Textbausteine, also eine Art Hyper-Vokabular, mittels dessen ich als Hyperleser meine Texte quasi lesend schreibe, indem ich sie zusammenstelle, wie ich beim konventionellen Schreiben Wörter zusammenstelle. Ich schreibe aber auch mit dem Computer und auf dem Computer zur allmählichen Verfertigung meiner Gedanken, die ich innerhalb eines gemeinten Themas ordne. So passen meine Texte zu meiner Vorstellung von mehr oder weniger langen Büchern, gerade weil ich in eigentlichen Büchern diesen spezifischen Sinn erkenne.
PS: Ich schreibe zur Zeit an einem Hyperbuch (in welchem dieser Text auch enthalten ist): Schrift-Sprache - das wird ein Buch
schreiben will. Ich bezeichne ihnden Text auch als – noch nicht entwickeltes – Hyperbuch, weil ich ihn auf einem Computer schreibe und Links in den Text einfüge. Das eigentliche Hyperbuch entwickelt sich – im Rahmen einer Hyperbibliothek – durch verlinkte Textauslagerungen, wodurch es prägnant wird, also wenig Redundanz enthält, weil die Vereinbarungen, etwa in Form von Definitionen im Hyperlexikon ausgelagert sind.
Als Hyperleser kann ich abschätzen, welche Auslagerungen ich verfolgen muss und welche nicht, zumal wenn ich den Charakter der Auslagerungen auch kenne. Begriffsdefinitionen lese ich genau und nur dann, wenn ich merke, dass meine Begriffe nicht passen oder der Text damit keinen Sinn ergibt.
Als Hyperbuch bezeichne ich eine – beispielsweise durch einen “vorwärts”-Link markierte Reihe von Hypertextteilen, die ich wie Buch lesen kann, weil sie in der vorgeschlagenen Reihenfolge eine buchartige Argumentation ergeben. Die primitivste Form des Hyperbuches erstelle ich, indem ich einen vorhandenen Buchtext zerschneide und die Teile in ihrer ursprünglichen Reihenfolge verlinke. Nach diesem Muster werden sehr viele Hypermedia-Werke gestaltet, die einfach hyper-modern sein wollen.
Hyper-Bücher sind also keine Bücher; sie sind nicht aus gebundenem oder broschierten Papier, sondern Hypertext(-teil)e, die wie Bücher gelesen werden können, weil sie Argumentationen enthalten. Hyper-Bücher bestehen aus anderen Hyper-Bücher oder sie sind elementar, also eigenständige Argumente in der Hyper-Bibliothek. Jede Argumentation kann in verschiedenen Hyper-Büchern verwendet werden, einige Hyper-Bücher sind Teilmengen von andern.
Ich unterscheide verschiedene Hyperbuchformen. Hier will ich aber das Wesen des Hyperbuches, das dem spezifischen Textträger entspringt, hervorheben. Der Computer hat als Textträger das Buch in einem evolutionstheoretischen Sinn abgelöst. Das heisst, es gibt neben dem Computer weiterhin Bücher, wie es neben den Menschen auch weiterhin Affen gibt. In plausiblen biologischen Evolutionsgeschichten – wie sie etwa K. Holzkamp erzählt – waren die ersten Menschen unter den Primaten eine Randerscheinung, die wie etwa die Neandertaler auch dann und wann wieder ganz verschwunden sind. Evolutionär erfolgreiche Entwicklung erkläre ich mir damit, dass ihre Vorteile ihre Nachteile im je gegebenen Kontext überwiegen.
Ich vergleiche dabei nicht verschiedene noch existierende Arten, sondern spezifische Aspekte, die bei der entwickelteren Art hinzugekommen sind. Menschen gestalten ihre Umwelt, wozu sie Werkzeuge herstellen. Affen können auch ohne Werkzeuge gut leben.
Menschen stellen Text und damit verbunden Textträger her. Sie verwenden dabei Werkzeuge, die sie in einem evolutionären Sinn entwickeln. Als entwickelste Form des Textträgers setz(t)en sich Computer gegenüber bedruckten Textträgern im evolutionären Prozess allmählich durch, was ich mir dadurch erkläre, dass sie die spezifische Begrenzung von Büchern nicht haben. Die Bücher sind aber bislang nicht ausgestorben. Vielmehr gab es zunächst auch auf den Computern vor allem hergebrachte Texte und mithin im hergebrachten Empfinden auch “Bücher”, wobei die eigentliche Buchproduktion noch lange Zeit so dominant war, so dass das “Buch” – als Textmengenart -weiterhin bestehen blieb. Ich lese auf meinem Computer deshalb auch sogenannte e-books.
Computer sprengen Text, sie machen Hypertext möglich. Durch das WWW wurde – wenn dort auch nicht in einem dominanten Sinn – Hypertext massenhaft. Hypertext sehe ich als Grundlage für ein neues Verständnis von Textmengen und Textgrenzen. Während die sagenhaften Bibliothekare von Alexandria noch von allen Büchern, die es in der damaligen Welt gab, eine Kopie haben wollten, haben die meisten wirklich existierenden Bibliotheken den Anspruch von möglichst vielen relevanten Büchern ein Exemplar im Gestell zu haben.
Durch die Kategorien, die ich anhand von Hypertext auf dem Computer generiere, sehe ich das Buch und die Bibliothek als technisch primitivere Formen einer Evolution, so wie ich im Affen in gewisser Hinsicht eine Vorstufe des Menschen sehe, was ich nur kann, weil ich ihn mit dem Menschen vergleichen kann.
Das Buch und noch viel mehr das Massenbuch, das Gutenberg zugedichtet wird, verbreitet Text, wie die Kinotechnik Bilder und das Radio Lautfolgen verbreitet. Das einzelne Buch hat eine massive Begrenzung, es kann nur begrenzte Textmengen enthalten. Damit verbunden hat das Buch ein massenhaftes Normalempfinden dafür begründet, dass und wie Text begrenzt sein sollte.
Wenn ich Hypertext schreibe, produziere ich Textbausteine, also eine Art Hyper-Vokabular, mittels dessen ich als Hyperleser meine Texte quasi lesend schreibe, indem ich sie zusammenstelle, wie ich beim konventionellen Schreiben Wörter zusammenstelle. Ich schreibe aber auch mit dem Computer und auf dem Computer zur allmählichen Verfertigung meiner Gedanken, die ich innerhalb eines gemeinten Themas ordne. So passen meine Texte zu meiner Vorstellung von mehr oder weniger langen Büchern, gerade weil ich in eigentlichen Büchern diesen spezifischen Sinn erkenne.
PS: Ich schreibe zur Zeit an einem Hyperbuch (in welchem dieser Text auch enthalten ist): Schrift-Sprache - das wird ein Buch
[0 Kommentar]
Inhalt
Technikgeschichte (zu diasynchron, Teil 2) - August 14, 2015
In meiner Technikgeschichte unterscheide ich verschiedene Aspekte, die ich im Sinne einer Robinsonade als Tätigkeiten zur Erhaltung meines Lebens unterscheide:
– Anbau (und Abbau: Feuer)
– Bau
– Geräte
– Werkzeuge
– Widerspiegelung
In dieser Geschichte erscheinen die Tätigkeitsbereiche zunächst nacheinander und zwar in einer Reihenfolge, in welcher ich zunehmend mehr "Technik" erkenne. In jedem Bereich erkenne ich Entwicklungen, die gegenseitig von einander abhängig sind, aber die Bereiche nicht aufheben.
Ich beginne deshalb mit dem Anbau. Indem ich Pflanzen anbaue statt wilde Früchte zu sammeln, erhöhe ich die Effizienz beim Erarbeiten meiner Nahrung. Am Anfang gibt es noch keinen Acker, geschweige denn Spaten oder Pflug. Ich erkenne auch noch keine Zucht, obwohl ich gewählte Samen sähe, geschweige denn Kunstdünger oder Genmanipulation. Das Verfahren lässt sich nur ganz marginal technisieren. Ich verwende etwa einen Grabstock, den ich schon davor beim Sammeln von wilden Früchten verwendet habe.
Die nächste Stufe bezeichne ich als Bauen. Ich denke dabei zuerst an ein Dach, das zur Hütte wird und an den Ackerbau, womit ich nicht das Anbauen bezeichne, sondern das Herstellen des Ackers, wozu beispielsweise das Eingrenzen durch Steine gehört, aber auch das Entsteinen und das Kanalisieren von Wasserläufen. Auf dieser Stufe stelle ich die einfachsten Artefakte her. Das Ur-Haus, etwa die Jurte oder das Tippi aus Stöcken und Fellen stelle ich mir immobil vor für die Zeit, in der ich es jeweils benutze. Ich kann nicht den Bau, sondern nur dessen Teile zügeln.
Dann stelle ich Geräte her. Natürlich ist der Grabstock, den ich beim Anbauen verwende, und der Stock, der mein Dach trägt, wie ein Faustkeil auch eine Art Gerät, aber darin erkenne ich noch praktisch keine Herstellung. Ein sehr einfaches Gerät erkenne ich in einem Gefäss, in welchem ich beispielsweise Wasser vom Bach in mein Haus oder in meinen Garten transportieren kann. Dazu fällt mir die Geschichte vom Einsiedler ein, der das Wasser mit blossen Händen in sein Haus trägt, weil er weiss, dass jedes noch so einfache Gerät nach weiteren Geräten ruft. Geräte unterscheide ich von Bauten durch ihre intendierte Mobilität. Tisch und Stuhl behalte ich zwar in meinem Haus, aber ich könnte sie hin oder hertragen, weshalb sie nicht zum Haus gehören.
Schliesslich stelle ich Werkzeug her, womit ich zum toolmaking animal werde, worin sich mein Menschsein entfaltet zeigt. Das Werkzeug verwende ich beim Herstellen von Bauten und Geräten. Ich kann Werkzeuge wie Geräte auch beim Anbauen verwenden, aber ihren Sinn haben sie in einer Mittelverschiebung. Werkzeuge stelle ich her, um damit etwas herzustellen. Ich kann mit Werkzeugen als Mittel einen Stuhl herstellen und der Stuhl befriedigt als Gerät das Bedürfnis bequem zu sitzen.
Als Widerspiegelung bezeichne ich die symbolische Reproduktion der Artefakte in Zeichnungen und Beschreibungen, die ihrerseits Artefakte sind, mit Werkzeugen hergestellt werden und einer technischen Entwicklung unterliegen. Die Widerspiegelung ist eine Verdoppelung der zuvor genannten Bereiche.
Material und Form
Die technische Entwicklung passiert im Wesentlichen bei den Werkzeugen (deshalb spreche ich von toolmaking), aber alle anderen von mir unterschiedenen Bereiche sind davon sehr stark betroffen. Alles, was ich als Artefakt bezeichne ist geformtes Material, wobei ich mit Material genau das bezeichne, was ich in der Herstellung forme, und mit Form, das was ich in der Widerspiegelung zeichne, wenn ich ein Artefakt zeichne. (Genau diese Vorstellung bezeichne ich als Materialismus).
In jedem der Bereiche ist das Material tautologischerweise wichtig und unterliegt einer technischen Entwicklung, die in der Materialkunde reflektiert wird, die in der Naturwissenschaft als chemische Physik und bei den Ingenieuren unter anderem etwa als Metallurgie erscheint. Nicht ganz zufällig ist eine etymologische Deutung des Wortes Chemie durch das griechische chemeia das Metallgiessen und das Umwandeln von Materialien.
Die Entwicklung der Formen unterliegt zunächst einer unmittelbaren Funktionalität. Dach und Schale haben eine quasi natürliche Form. Hanmer und Sichel sind bereits in dem Sinne konstruiert, als sie so zusammengesetzt sind, dass auch ihre Teile eigenen Formentwicklungen unterliegen. Das Rad und die Schraube sind zwei wichtige Teile, die ihren Sinn nur als Teile von etwas zusammengesetztem haben.
Energie und Information
Werkzeuge muss ich bewegen und steuern. Für die Bewegung brauche ich einen Motor, der Energie umwandelt. Den einfachsten Motor erkenne ich im Wasserrad - welches das Rad enthält. Noch vor dem Motor dienen Mensch und Tier als expliziter Motorersatz, etwa Sklaven oder Tiere, die den Göpel oder den 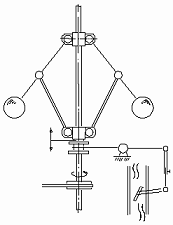 Pflug ziehen. Ein energetisch entwickeltes Werkzeug bezeichne ich als Maschine.
Die sogenannte Dampfmaschine ist keine Maschine, sondern ein Motor. Motoren lassen sich nicht nur für Werkzeuge sondern auch für Geräte verwenden. Und Motoren revolutionieren auch den Anbau und den Bau.
Die Dampfmaschine von Watt gilt gemeinhin als Energieträger, ihr Erfolg beruht aber unter anderem auch darauf, dass sie eine Regelung hat. Geregelte Maschinen bezeichne ich als Automaten. Die Regelung, die Watt verwendet, ist technisch primitiv, weshalb ich von Halbautomaten spreche. Die entwickeltste Regelung erscheint in Prozessoren, die für Computer verwendet werden. Entwickelte Regelungen haben einen eigenen Energiekreis. Die Energie, die der Regelung dient, bezeichne ich als Information.
Auf der entwickelsten Stufe des Werkzeuges wird die Widerspiegelung zum Programm. Im Programm beschreibe ich, was die Maschine oder genauer, was die Steuerung "macht", und die Steuerung macht dann, was sie macht, weil ich sie beschrieben habe.
Die Programmierung beobachte ich als die letzte Stufe der Technik. Beim Programmieren mache ich nur noch Beschreibungen, aber die bekommen ihren Sinn natürlich nur durch die Technik insgesamt. Vorläufig bauen Menschen Getreide an, damit andere Gebäude bauen, in welchen andere Geräte und Werkzeuge herstellen, die ich dann noch programmieren kann.
Pflug ziehen. Ein energetisch entwickeltes Werkzeug bezeichne ich als Maschine.
Die sogenannte Dampfmaschine ist keine Maschine, sondern ein Motor. Motoren lassen sich nicht nur für Werkzeuge sondern auch für Geräte verwenden. Und Motoren revolutionieren auch den Anbau und den Bau.
Die Dampfmaschine von Watt gilt gemeinhin als Energieträger, ihr Erfolg beruht aber unter anderem auch darauf, dass sie eine Regelung hat. Geregelte Maschinen bezeichne ich als Automaten. Die Regelung, die Watt verwendet, ist technisch primitiv, weshalb ich von Halbautomaten spreche. Die entwickeltste Regelung erscheint in Prozessoren, die für Computer verwendet werden. Entwickelte Regelungen haben einen eigenen Energiekreis. Die Energie, die der Regelung dient, bezeichne ich als Information.
Auf der entwickelsten Stufe des Werkzeuges wird die Widerspiegelung zum Programm. Im Programm beschreibe ich, was die Maschine oder genauer, was die Steuerung "macht", und die Steuerung macht dann, was sie macht, weil ich sie beschrieben habe.
Die Programmierung beobachte ich als die letzte Stufe der Technik. Beim Programmieren mache ich nur noch Beschreibungen, aber die bekommen ihren Sinn natürlich nur durch die Technik insgesamt. Vorläufig bauen Menschen Getreide an, damit andere Gebäude bauen, in welchen andere Geräte und Werkzeuge herstellen, die ich dann noch programmieren kann.
[3 Kommentar]
Inhalt
Technikgeschichte (zu diasynchron) - August 12, 2015
Im Projekt diasynchron untersuche ich die Geschichte als Geschichte, indem ich das narrative Element durch Zeittafeln quasi negativ focusiere. Die Zeittafel wird darin selbst zum Problem, weil sie ein quasi archetypisches Muster darstellt, in welchem alles, was passiert, in der Zeit passiert.
In einer konventionellen Technikgeschichte schreibe ich, was ich als technisch erachte, in eine Reihe des jeweilig ersten Auftretens. Ich schreibe etwa, dass die Dampfmaschine anfangs des 18. Jhds erfunden wurde. Wenn ich darüber eine 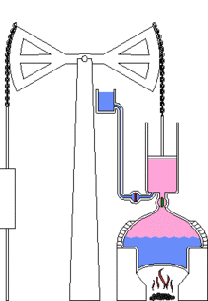 novellige Geschichte schreibe, schreibe ich über die Rivalitäten der Erfinder und über die Rechtsverhältnisse, in welchen diese ausgetragen wurden. In einer Zeittafel schreibe ich nur "1712: Dampfmaschine von Newcombe".
Die Anordnung der Dampfmaschinenerfindungen in der Zeit hat als Geschichte eine eigenständige Plausibilität, die die Tatsache, inwiefern eine Dampfmaschine in die Geschichte gehört zum Rhema macht. Thema ist die Erfindung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn ich die Dampfmaschine in der Technikgeschichte aufführe, zeige ich, dass ich ihre Erfindung als technisches Ereignis begreife, selbst dann noch, wenn ich viel mehr über die Rechtsfragen der Patente schreibe, als darüber, wie die Maschine funktioniert oder konstruiert ist.
Als diasynchron bezeichne ich eine Art Inversion der Geschichte, in welcher die Funktion der Zeit darin besteht, verschiedene Geschichten zu verbinden. Ich erzähle beispielsweise eine Entwicklungsgeschichte der Dampfmaschine jenseits der Zeit und verwende "Zeit" als Item der Verlinkung. Die Dampfmaschine zeigt sich dann in der Antike als etwas anderes als in der Renaissance, was ich eben als eine alternative Geschichte begreife. Es geht mir nicht darum, alternative Geschichten zu erfinden, sondern darum, eine Form der Darstellung zu entwickeln, die die Verlinkung sichtbar(er) macht.
Da die hier erzählten Geschichten nicht durch Zeit- sondern durch Sachfolgen begründet sind, zeigen sich auch viele Sachen in einer anderen Perspektive. Meine Technikgeschichte zeigt in Form der diasynchronen Tabelle, wie ich mir die Entwicklung der Technik vorstelle und mithin, was ich als Technik begreife. Durch die Einfaltungen der sachorientierten Tabellen werden die elementaren Kategorien sichtbar, während in der Zeittafel nur Epochen sichtbar werden, die sich gerade nicht technisch begründen.
Indem die Kategorien, die ich verwende, auch für sichtbarbar werden, reflektiere ich sie auch als Teil meiner Geschichten und mithin als Teil meiner eigenen subjektorientierten Geschichte. Den Ausdruck Technik verwende ich in einem objektiven Sinn für die Kunst des Effizient-Seins, also für das, was die alten Griechen in historischen Interpretationen als Techne bezeichneten. In diesem spezifischeren Sinn verwende ich den Ausdruck für in Artefakten konservierten Verfahren, die mich - im Sinne der holzkampschen Subjekttheorie - effizient machen.
Subjektiv verfolge ich technisch - meine je eigenen - Ziele, die nur sehr vermittelt etwas mit den Zielen der Techniken der "antiken" Sklavenhaltern zu tun haben. Auch mein je eigener Beitrag zu meinem Lebensunterhalt ist sozial so vermittelt, dass ich ihn nur denkend als solchen begreifen kann. Nachdenkend über den Teil meines Lebensunterhaltes, den ich technisiert vorfinde, unterscheide ich innerhalb der Technik folgende Gegenstandsbereiche:
- Anbau
- Bau
- Geräte
- Werkzeuge
- Widerspiegelung
Mir ist noch nicht klar, wie gut sich diese Einteilung bewähren mag und ich würde sehr gerne Alternativen zu diesem Anfang finden.
novellige Geschichte schreibe, schreibe ich über die Rivalitäten der Erfinder und über die Rechtsverhältnisse, in welchen diese ausgetragen wurden. In einer Zeittafel schreibe ich nur "1712: Dampfmaschine von Newcombe".
Die Anordnung der Dampfmaschinenerfindungen in der Zeit hat als Geschichte eine eigenständige Plausibilität, die die Tatsache, inwiefern eine Dampfmaschine in die Geschichte gehört zum Rhema macht. Thema ist die Erfindung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn ich die Dampfmaschine in der Technikgeschichte aufführe, zeige ich, dass ich ihre Erfindung als technisches Ereignis begreife, selbst dann noch, wenn ich viel mehr über die Rechtsfragen der Patente schreibe, als darüber, wie die Maschine funktioniert oder konstruiert ist.
Als diasynchron bezeichne ich eine Art Inversion der Geschichte, in welcher die Funktion der Zeit darin besteht, verschiedene Geschichten zu verbinden. Ich erzähle beispielsweise eine Entwicklungsgeschichte der Dampfmaschine jenseits der Zeit und verwende "Zeit" als Item der Verlinkung. Die Dampfmaschine zeigt sich dann in der Antike als etwas anderes als in der Renaissance, was ich eben als eine alternative Geschichte begreife. Es geht mir nicht darum, alternative Geschichten zu erfinden, sondern darum, eine Form der Darstellung zu entwickeln, die die Verlinkung sichtbar(er) macht.
Da die hier erzählten Geschichten nicht durch Zeit- sondern durch Sachfolgen begründet sind, zeigen sich auch viele Sachen in einer anderen Perspektive. Meine Technikgeschichte zeigt in Form der diasynchronen Tabelle, wie ich mir die Entwicklung der Technik vorstelle und mithin, was ich als Technik begreife. Durch die Einfaltungen der sachorientierten Tabellen werden die elementaren Kategorien sichtbar, während in der Zeittafel nur Epochen sichtbar werden, die sich gerade nicht technisch begründen.
Indem die Kategorien, die ich verwende, auch für sichtbarbar werden, reflektiere ich sie auch als Teil meiner Geschichten und mithin als Teil meiner eigenen subjektorientierten Geschichte. Den Ausdruck Technik verwende ich in einem objektiven Sinn für die Kunst des Effizient-Seins, also für das, was die alten Griechen in historischen Interpretationen als Techne bezeichneten. In diesem spezifischeren Sinn verwende ich den Ausdruck für in Artefakten konservierten Verfahren, die mich - im Sinne der holzkampschen Subjekttheorie - effizient machen.
Subjektiv verfolge ich technisch - meine je eigenen - Ziele, die nur sehr vermittelt etwas mit den Zielen der Techniken der "antiken" Sklavenhaltern zu tun haben. Auch mein je eigener Beitrag zu meinem Lebensunterhalt ist sozial so vermittelt, dass ich ihn nur denkend als solchen begreifen kann. Nachdenkend über den Teil meines Lebensunterhaltes, den ich technisiert vorfinde, unterscheide ich innerhalb der Technik folgende Gegenstandsbereiche:
- Anbau
- Bau
- Geräte
- Werkzeuge
- Widerspiegelung
Mir ist noch nicht klar, wie gut sich diese Einteilung bewähren mag und ich würde sehr gerne Alternativen zu diesem Anfang finden.
[2 Kommentar]
Inhalt
Zeitrechnung (zu diasynchron) - Juli 30, 2015
Als Zeitrechnung bezeichne ich - konventionell, ohne recht zu verstehen weshalb - das Ordnungsprinzip, das ich einem Kalender zugrunde lege. Es ist also eher die Lösung der Aufgabe als die Aufgabe.
Ich muss dazu zwei Entscheidungen treffen: die Struktur der Unterteilung, das heisst die Wahl der Entitäten, und der perspektivische Zeitpunkt, von welchem aus quasi "gerechnet", respektive gezählt wird:
zur Struktur:
In einem spezifischen Fall, der sich weltweit durchgesetzt hat, unterscheide ich - naturwüchsig, sinnlich - Jahre und Tage, die ich willkürlich durch Monate, respektive Stunden unterteile.
zum Bezugszeitpunkt:
Damit ich "berechnen" oder zählen kann, wie lange etwas her ist, muss ich die zeitlichen Entitäten im Kalender durchnummerieren.
Es gibt verschiedene praktische Überlegungen, die den Kalender bestimmen: Eine naturwüchsige Zeitrechnung wäre am Anfang zu beginnen, was aber nicht sinnvoll möglich ist, weil niemand weder den Anfang der Naturgeschichte noch den Anfang der Sozialgeschichte datieren kann.
Die quasi umgekehrte Variante wäre rückwärts zu zählen, also nur Vergangenheit zu datieren. Das wäre in der Hinsicht nicht sehr praktisch, als sich das Datum jeden Tages jeden Tag verändern würde.
Bleibt also, was wir ohnehin praktizieren: ein beliebig festgelegter Nullpunkt, der als Grenze für positives und negatives Zählen dient. Die "Null" - vor allem die damit verbundene Vorstellung, die Zeit so zu teilen, dass sie vor einem bestimmten Zeitpunkt quasi rückwärts gezählt werden kann, ist eine geniale Idee, die den Kalender überhaupt erst möglich und eigentlich ausmacht. Die Null im Primärschlüssel ist offensichtlich beliebig gesetzt, es ist noch nicht einmal die Null der europazentrierten Geschichte. Für die Wahl - respektive für die Bezeichnung der Wahl - eines Bezugszeitpunktes spielen hauptsächlich ideologische Gesichtspunkte - wie etwa die Geburt Christi - eine Rolle. Natürlich haben auch die Christen ihre Zeit sehr lange nicht auf die Geburt Jesu zurückgerechnet.
Die europazentrierten Bezeichnungen Antike, Mittelalter und Neuzeit zeigen, dass das Wesen des Kalenders sehr lange nicht begriffen wurde: von einer Neuzeit oder gar neusten Zeit zu reden, nimmt Bezug auf denn jeweils aktuellen (rückwärtszählenden) statt auf den Nullzeitpunkt.
Da ich - im Konzept des Kalenders - nicht sage, wie spät es ist, sondern Zeiteinheiten zähle und tabelliere, ist eine zusätzliche Entscheidung notwendig: ich muss entscheiden, ob ich beim Zählen die Null verwende.
In der traditionell-historischen Zeitrechnung gibt es das Jahr Null nicht, wohl aber in der modernen Jahreszählung der Astronomen. Traditionell werden die Jahre mit Ordinalzahlen vor und nach der Geburt Christi gezählt: Das Jahr 1 vor Christi Geburt endet am 31. Dezember (1 v. Chr.), am nächsten Tag, dem 1. Januar, beginnt das Jahr 1 nach Christi Geburt (1 n. Chr.).
Uhrzeit und Kalender
Kalender und Uhrzeit sind Darstellungen der Zeitrechnung
Im Kalender bezeichne ich Intervalle, als Uhrzeit bezeichne ich Grenzen zwischen diesen Intervallen. Ich unterscheide also zwei verschiedene Beobachtungen:
Mit dem Kalender lege ich Ereignisse in einen bestimmte Zeitraum, mit der Uhr auf einen bestimmten Zeitpunkt.
Diese Differenz erzeugt spezifischen Probleme. Eines ist das sogenannte Jahr Null im traditionell-historischen Kalender, in welchem (eben nicht) der Zeitpunkt von Christi Geburt als Zähl-Wende gewählt wurde, so dass nur das Jahr davor und das Jahr danach mit Datum versehen sind.
Das Jahr Null
In meiner Biographie bezeichne ich meine 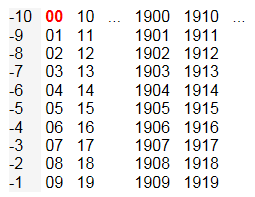 Geburt als Nullpunkt, der als Zeitpunkt mitten in ein Jahr fällt, also wie jede weitere Geburt eines Menschen in den Kalender eingetragen wird, während Christi Geburt - in diesen Kalender - nicht eingetragen werden kann.
In meinen Geschichten verwende ich einen Kalender, in welchem das Jahr Null nicht vorkommt, weil ich das erste Jahr als 1. Jahr bezeichne, und die Jahre davor in einem analogen Sinn zähle.
Die Differenz beruht darauf, ob ich Ereignisse - wie meine Geburt oder jene von Christus - in einen Kalender eintrage, oder einem von mir gezähltem Jahr zurechne. Biographisch zähle ich meine Lebensjahre, indem ich dem ersten Jahr - unabhängig von jedem Kalender - die Ziffer 1 zuordne.
Diese Zählweise verwende ich generell, wenn ich Zeitintervalle vor und nach einem bestimmten Ereigniszeitpunkt zähle. Ich sage etwa, dass der Schnee erst in der letzten Minute vor dem Anpfiff des Spieles weggeräumt werden konnte und dass bereits in der ersten Minute nach dem Anpfiff ein Tor gefallen ist.“ Das Ereignis Spielanfang ist ein Zeitpunkt zwischen zwei Intervallen, dem kein Intervall zugeordnet ist. Im gleichen Sinn ist die Geburt Christi ein Ereignis, das im Kalender keinem Intervall entspricht
Für die Zeitrechnung spielt es natürlich eine Rolle, ob ich ein Jahr weglasse oder nicht, aber umgekehrt haben wir ja auch 300 Jahre wegegelassen und können nur schlecht wissen, wie oft man sich sonst verzählt hat. Für die Geschichte(n) spielt es keine Rolle, weil dort Jahreszahlen nur als Primärschlüssel fungieren, die Reihenfolgen festlegen.
Geburt als Nullpunkt, der als Zeitpunkt mitten in ein Jahr fällt, also wie jede weitere Geburt eines Menschen in den Kalender eingetragen wird, während Christi Geburt - in diesen Kalender - nicht eingetragen werden kann.
In meinen Geschichten verwende ich einen Kalender, in welchem das Jahr Null nicht vorkommt, weil ich das erste Jahr als 1. Jahr bezeichne, und die Jahre davor in einem analogen Sinn zähle.
Die Differenz beruht darauf, ob ich Ereignisse - wie meine Geburt oder jene von Christus - in einen Kalender eintrage, oder einem von mir gezähltem Jahr zurechne. Biographisch zähle ich meine Lebensjahre, indem ich dem ersten Jahr - unabhängig von jedem Kalender - die Ziffer 1 zuordne.
Diese Zählweise verwende ich generell, wenn ich Zeitintervalle vor und nach einem bestimmten Ereigniszeitpunkt zähle. Ich sage etwa, dass der Schnee erst in der letzten Minute vor dem Anpfiff des Spieles weggeräumt werden konnte und dass bereits in der ersten Minute nach dem Anpfiff ein Tor gefallen ist.“ Das Ereignis Spielanfang ist ein Zeitpunkt zwischen zwei Intervallen, dem kein Intervall zugeordnet ist. Im gleichen Sinn ist die Geburt Christi ein Ereignis, das im Kalender keinem Intervall entspricht
Für die Zeitrechnung spielt es natürlich eine Rolle, ob ich ein Jahr weglasse oder nicht, aber umgekehrt haben wir ja auch 300 Jahre wegegelassen und können nur schlecht wissen, wie oft man sich sonst verzählt hat. Für die Geschichte(n) spielt es keine Rolle, weil dort Jahreszahlen nur als Primärschlüssel fungieren, die Reihenfolgen festlegen.
[0 Kommentar]
Inhalt
diasynchron( Das Projekt ) - Juli 28, 2015
Als Projekt bezeichne ich dieses Unterfangen, weil ich vage Entwürfe für eine grosse Arbeit habe, von welcher ich noch nicht annehme, dass ich sie je ausführen werde. Die Arbeit besteht im Erstellen von diasynchronen Zeittafeln, die dann als Objekte das Resultat des Projektes darstellen (werden oder würden).
Vorderhand habe ich einige Ideen oder vage Konzepte, die ich in Entwürfen(was in gewisser Hinsicht ein deutsches Wort für Projekt ist) quasi dialogisch entwickle.
Projektidee
In einem Lexikon(auch in meinem Hyper-Lexikon) sehe ich eine Art Literatur, in welcher das narrative Element der Erzählung fehlt. Ich kann mir zu den Einträgen im Lexikon Rahmenhandlungen vorstellen, wie sie etwa Sokrates in seinen Dialogen oder Galilei in seinen Diskursen verwenden, so dass sprechende Idioten in ihrer Konfusion immer erzählen, wie sie ihre Worte verwenden. Ich kann mir aber auch ein gewöhnliches wissenschaftliches Stück Literatur vorstellen, bei welchem - wie bei einem easy-rider-Chopper - alles weggeschnitten wurde, was über Definitionen hinausgeht.
Einen Teil dessen, was mit der fehlenden Narration verloren geht, wurden in der Encyclopedia Britannica (1. Auflage 1768–1771) als alternative Darstellungen zur bis dahin üblichen Prosa-Chronik durch sogenannte Zeittafeln ersetzt.
Ich lese Zeittafeln als eine spezielle Form von Erzählungen, sie beruhen auf einer zurückblickenden Auswahl, die überdies oft Kategorien verwendet, die nur in der Rückschau möglich sind. Die Epochenbezeichnung "Renaissance" beispielsweise stammt aus dem 19. Jhd. und meint eine Zeit im 16. Jhd., in welcher die Epoche als solche und auch die vermeintliche Wiedergeburt wohl (noch) nicht erlebt wurde. Wenn ich also die Renaissance in einer Zeittafel der Jahreszahl 1600 zuordne, erzähle ich - mehr oder weniger bewusst - dass um 1900 gesehen wurde, dass um 1500 im damaligen Italien vieles wieder so gesehen wurde wie es 400 vor Christus im damaligen Griechenland gesehen wurde. Das ist ein zeit-typischer Anfang einer Geschichte, in welcher Beobachtungen beobachtet werden (können).
Eine mögliche Beobachtung besteht in einer Inversion: Im 19. Jhd. wurde anhand des Wissens über das 16. Jhd. das 4. Jhd. vor Christus rekonstruiert. Die Kategorien stammen in dieser Perspektive nicht aus dem 16. Jhd. und schon gar nicht aus dem 4. Jhd. vor Christus, sondern sind Projektionen, die ich durch den Epochenbegriff auch heute aktivieren kann - aber nicht muss.
Im Projekt will ich solche Projektionen durchspielen. Aktuell interessiert mich neben der Renaissance gerade der etwa zeitgleiche Merkantilismus, weil ich mich mit Geldbefasse. Interessant finde ich, welche Epochen zu gleichen Zeit stattfinden, und was sie gegenseitig von sich erzählen.
Zeittafeln markieren Chronos, aber was in die jeweilige Tafel gehört, hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern hängt ab, vom Gegenstand der jeweils gemeinten Geschichte. Die Schulbuch-Geschichte thematisiert Völker, Nationen und Kriege, also Herrschaft über Blut und Boden. Man kann - und in den meisten Schulbüchern wird das getan - die Perspektive und den narrativen Faden ausblenden. Die "Welt"geschichte erscheint dann in Episoden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten der Erde. Am Anfang unserer Zeitrechnung etwa hat die Geschichte fast ausschliesslich in Griechenland und dann im Römischen Reich gespielt. Die "Welt"karte gibt mir aber keinerlei Indizien dafür, dass an den andern Orten auf der Erde nichts passiert wäre. Es ist bloss nicht Gegenstand einer bestimmten Geschichte. Später scheint dieser Geschichte zufolge auch in Griechenland und rund um Rom nichts mehr passiert zu sein, die Geschichte ist zu andern Schauplätzen gewandert. Die sogenannten Weltkriege dagegen erscheinen umgekehrt als weltweite Kriege, obwohl in dieser Zeit auch an vielen Orten auf der Erde nichts passiert ist. Die Wahl der Orte und die Benennung der Ereignisse sind offensichtlich beliebig, das heisst im Belieben des Erzählers der jeweiligen Geschichte.
Jeder Geschichtenerzähler erzählt seine eigene Geschichte. Viele Geschichtenerzähler erzählen aber sehr oft eine sehr ähnliche Geschichte, vielleicht, weil sie diese Geschichte schon kennen. Auf einer bestimmten psychologischen Entwicklungsstufe, die ich bei Kleinkindern ausgeprägt finden kann, ist wichtig, dass die Geschichte nicht verändert wird. Auch Märchen müssen dann wortgetreu erzählt werden. Bestimmte Geschichten institutionalisieren sich, typischerweise in Kirchen, während bestimmte Institutionen, etwa Schulen, festlegen, welche Geschichten wie erzählt werden müssen.
Im Krieg der Institutionen gibt es sogenannte Geschichtsfälschungen. Dabei wird dieselbe Geschichte anders erzählt, wodurch sie nicht mehr dieselbe ist. Ein Beispiel dafür sind Verschwörungstheorien. Wenn ich eine Geschichte fälschen kann, kann das natürlich jeder, aber das würde insgesamt nur dann gehen, wenn es eine richtige Geschichte gäbe.
Oft wird zwar die Geschichte als Faktum gleich erzählt, aber verschieden interpretiert. Dazu gibt es viele Beispiele von relativ einfältigen parteipolitischen Interpretationen. Es gibt aber auch interessantere Fälle wie etwa, inwiefern und für wen die Erfindung des Ackerbaus gut war. In einer Gesellschaft, die Ackerbau betreibt, erscheint Ackerbau nach einer gewissen Zeit (nämlich wenn er wegen der Bevölkerungsexplosion, die er ermöglicht hat, notwendig geworden ist) naturwüchsig und nicht mehr als bewusste Entscheidung.
Eine besondere Form der Geschichtsfälschung betrifft nicht die Gegenstände, sondern den Primärschlüssel der Tabelle. Ein Beispiel dafür ist das erfundene Mittelalter. Dabei wird natürlich nicht die Zeit sondern der Chronos variiert, was aber in Bezug auf Zeittabellen ziemliche Komplikationen schafft.
Und schliesslich gibt es Geschichtskritik durch Relativierungen der Kontexte, was auch sichtbar macht, wie welche Geschichte nicht erzählt werden sollte. Ein Beispiel dafür - das mich auch inspiriert hat - ist die synchronoptische Geschichte, deren Naturwüchsigkeit ich hier noch etwas genauer beobachten will. Die synchronoptisch Geschichte ist als spezielle vorerst leere Zeittafel konzipiert. In der Vorspalte stehen - wie in anderen Geschichten - als Primärschlüssel Zeitangaben. Die Vorzeile dagegen ist ein Raster, das über die Oberfläche der Erde gelegt wird. So ergibt sich eine Tabelle ohne Inhalte in den einzelnen Zellen. Wenn ich die Geschichte so darstelle, kann ich jede Zelle mit Ereignissen füllen oder leer lassen. Die leeren Zellen bedeuten, dass dort zu dieser Zeit nichts passiert ist, was in die Geschichte gehört. Das lenkt meine Aufmerksamkeit auf die gefüllten Zellen:
Was gehört in eine "Welt"geschichte?
Eine solche Geschichte haben A. und A. Peters 1952 als "Zeitatlas" vorgelegt. Sie wurde aufgrund dieser Form zunächst sehr gefeiert, dann aber aufgrund der (marxistisch gemeinten) Inhalte ebenso sehr kritisiert. Kritisch ist für mich nicht, inwiefern und ob eine Geschichte "marxistisch" ist, sondern die Frage, was ich in die Zellen eines Zeitatlasses schreiben und damit zu einer Geschichte machen würde. Kritisch ist für mich auch die Wahl der Erdoberfläche als Gesamtprojektionsfläche für die so unterstellte "Welt"geschichte als Sammelsurium von zeitgleichen Geschichten, wobei der diachrone Aspekt von Gegenständen praktisch verschwindet.
Ich kenne beliebig viele Geschichtsbücher und damit verbunden eine Konservierung von naturwüchsigen Konventionen. Die konventionelle Weltgeschichte komplementiert die "politische Ökonomie". Deshalb beschreibt die Weltgeschichte zuerst, wie sich die Nationen auf der Erdoberfläche verteilen und welche Kriege sie führen. Dann beschreibt sie aufgrund welcher Technik Kriege gewonnen werden und schliesslich wie die Herrschaftsverhältnisse kulturell symbolisiert werden, was P. Weiss als Ästhetik des Widerstandes reflektiert. Interessanterweise hat A. Petersneben den üblichsten Konventionen Bauwerke (Städtebau als Kultur) speziell hervorgehoben, auch heute noch bauen die reichsten Nationen die höchsten Gebäude.
Die Idee des Projektes besteht in diasynchronen Geschichten, die einen Erzähler und eine explizite Perspektive haben, die ich in der subjektiv (oder subjektwissenschaftlich) wahrgenommenen Unterhaltung und Sicherung des Lebens des Erzählers sehe. In meinen Geschichten reflektiere ich die Gewährleistung meines Lebens. Ich erzähle in meiner Sprache und mit meinen Kategorien, was für mich Sinn ergibt. Meine Sprache und meine "Denkformen" sehe ich als Aneignungen und gerade nicht als gesellschaftliches Gut. Ich weiss nicht, wie ich dazu gekommen bin, meine Um-Welt so zu konstruieren, wie ich sie beschreibe. Ich weiss aber auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, sie überhaupt zu beschreiben.
Vordergründig beschreibe ich Verhältnisse, die ich auch von anderen beschrieben sehe und ich mache das in einer Sprache, in welcher ich auch andere sprechen höre. Im Sinne des Radikalen Konstruktivismus sind meine Deutungen aber eben meine Deutungen, die ich dialogisch entfalte.
Konzept
Die Zeittafel hat eine Form und einen Inhalt.
•Konzept der Form
Die Form der Zeittafel ist eine Tabelle. Da ich die Tabelle auf einem Computer schreibe, kann ich sie flexibel gestalten, das heisst, ich kann verschiedene Ansichten in verschiedenen Differenzierungen derselben Tabelle miteinander verlinken. So kann ich jedes Feld entfalten, was einem Grundprinzip des Hyperlexikons entspricht.
Zeittafel werden durch Links ersetzt:
 Ich kann die Tabellen auch spezifisch ersetzen, indem ich verschiedenen Vorzeilen zur Verfügung stelle. Und schliesslich kann ich im Sinne von Registern auch den Primärschlüssel ändern. Ich stelle mir eine (Hyper-)Verschachtelung vor, die verschiedene Zugriffe und Auflösungen enthält.
Zeittafeln haben immer eine Spalte mit Kalenderdaten, die der Sortierung oder der Reihenfolge der Geschichte dient. Die narrative Möglichkeit, den Schluss der Geschichte zuerst zu erzählen und so die Geschichte zu motivieren, ist insofern aufgehoben, als ich Tabellen durch andere Tabellen, die eine Art Vorgeschichte enthalten, ersetzen kann. Aber die Geschichte bleibt "im Kopf" (mind) des Lesers.
•Konzept der Inhalte
Als Inhalt kommt in Frage, was sich plausibel in eine Zeittafel eintragen lässt. Ich bezeichne das als Stichworte für Geschichten. Geschichten sind von etwas oder über etwas, was sich im Laufe der Zeit verändert (oder eben nicht). Eine spezifische Art von Geschichten beschreibt, wie die Menschheit lebt. Diese Geschichten implizieren oder konstituieren Menschheiten. Eine andere Art von Geschichten beschreibt, wie einzelne Menschen leben. Da jede Geschichte von einem Menschen erzählt wird, zerfallen diese Geschichten in Autobiographien und in Biographien, wobei insbesondere spezifische Verallgemeinerungen von Biographien als Geschichten von Gesellungseinheiten mit sich differenzierenden Biographien erscheinen. Ein literarischer Fall davon ist die Robinsonade.
Bevor ich mich frage, worüber ich Geschichten erzähle, frage ich mich, wozu ich überhaupt Geschichten erzähle und damit verbunden, was ich dabei eigentlich erzähle.
Meistens erzähle ich Geschichten, die mir plausibel machen, warum ich gerade an einem bestimmten Ort bin oder eine bestimmte Auffassung einnehme. Ein kurze Geschichte ist beispielsweise: "Ich bin mit der Bahn gekommen". Sie impliziert Bahnnetz mit Fahrplan und erläutert warum ich wann wo bin. Dann erzähle ich oft Geschichten, die mein Wissen plausibilisieren: "Ich bin dort gewesen und habe gesehen oder ich habe Buch von xy gelesen". Dann erzähle ich oft, wie sich etwas entwickelt, um meine Erwartungen zu klären. Und schliesslich plausibilisiere ich meine Erklärungen, in dem ich erzähle, wie etwas funktioniert. Meine Geschichten machen mir Sinn.
Bleibt die Frage, wie ich wähle, was wichtig genug ist, in der Geschichte erzählt zu werden. Warum erzähle ich bestimmte Ereignisse oder vermutete Folgen dieser Ereignisse und andere nicht? Was kommt in "Meine-Welt-Geschichte"?
Bewusst erzähle ich vor allem Geschichten, deren Gegenstände ich durch die Gewährleistung meiner aktuellen Existenz begründe. Dass ich mit einem Computer schreibe, führt dann dazu, dass ich die Geschichte des Computers beobachte. Ob dabei Weltkriege in irgendeiner Form oder die chinesischen Dynastien wichtig werden, bezweifle ich vorderhand sehr. Aber diasynchron erscheinen eigentliche Computer zeitgleich mit dem sogenannten 2. Weltkrieg. Man sagt mir deshalb, dass der Computer, mit dem ich diesen Text schreibe, im Weltkrieg erfunden wurde. Aber darin erkenne ich eine tabellarische Zuordnung, die ich so kaum erzählen würde und gerade deshalb als Erzählung erkenne und durch die Zeittafel quasi begründen kann.
Meine Vorstellungen sind durch konventionelle Geschichten beeinflusst. Ich werde deshalb die mir bekannten Konventionen mitschreiben und sie mir so bewusst halten. Die Französische Revolution oder der Fall von Troja, aber auch dass an vielen Orten zur entsprechenden (oder anderer) Zeit nichts erwähnenswertes passiert ist, betrifft mein Leben kaum, oder genauer, ich kann mir nicht vorstellen wie. Auch die Weltkriege scheinen mir zunächst ohne Relevanz für meine Geschichte. Epochen und Ereignisse bekommen ihren Sinn aus den je erzählten Geschichten oder der darin enthaltenen Perspektiven. Aber es gibt Ereignisse, die in so vielen Geschichten erscheinen, dass sie quasi epochal den Primärschlüssel ersetzen. Ich höre beispielsweise oft, dass die Welt vor dem Weltkrieg eine andere war, aber nicht sehr oft, dass sie vor 1939 eine andere war. In diesem Sinne dienen beliebige oft verwendete Epochen als anschaulicherer Primärschlüssel auch wenn sie ohne Bedeutung für meine Welt sind.
Die Geschichten, die ich über meine Welt erzähle, begründen meine Welt. Ich habe zwar sinnliche Erfahrungen, aber was ich darüber sagen oder erzählen kann, sind Bedeutungen, die ich in Deutungs- oder Handlungszusammenhängen hervorbringe. Phänographisch gesprochen nehme ich beispielsweise angesichts eines Hammers einen Hammer wahr, das heisst, ich sehe nicht ein Ding, das ich als Hammer deuten müsste. Das naturwüchsige Gegebensein eines Hammer oder eines Baumes wird mir erst bewusst, wenn ich über dessen Geschichte nachdenke. Bäume und Hämmer hat es - in meinen Geschichten - nicht immer schon gegeben. Beides sind für mich Resultate von erzählbaren Evolutionen, die auf die jeweiligen Bedeutungen ausgerichtet sind und diese erst hervorbringen. Die Geschichte des Hammers erzähle ich als toolmaking animal (oder als Kaufhandlung im Supermarkt), die Geschichte des Baumes erzähle ich als beispielsweise als Darwinist.
Die Gegenstände der Geschichten
Meinen Computer und dass ich damit schreibe, beobachte ich als relevante Aspekte meiner Lebensführung, die ich mir mit meinen Geschichten bewusst mache. Ich sehe darin - wie vermittelt auch immer - meinen kollaborativen Bezug zur gesellschaftlich gewährleisteten Absicherung meines Lebens. In meiner Geschichte spielt deshalb der Computer und dessen Geschichte - im Unterschied zum trojanischen Krieg und der französischen Revolution - eine wichtige Rolle.
In den primitivsten Geschichten zum Computer ist mir bereits vorweg klar, was ein Computer ist. Die meisten Geschichten, die ich zum Computer lese, implizieren ohne jede Begründung, dass der Computer ein Gerät zum Rechnen ist und beginnen deshalb mit der Erfindung des Rechnens oder mit der Erfindung von Rechenmaschinen. Solche Geschichten machen aber den Computer erst zu einer Rechenmaschine. Ich benutze meinen Computer praktisch nie zum Rechnen. In meiner Geschichte ist er deshalb keine Rechenmaschine.
In meiner Geschichte zum Computer geht es darum, was ich in Abhängigkeit meiner situativen Befindlichkeit oder Lebensführung als Computer bezeichne. Ich rekonstruiere nicht ein Gerät jenseits davon, was ich mit diesem Gerät mache, sondern begreife das Gerät als Gerät, das ich praktisch und konkret in meinem Leben verwende. In solchen Geschichten erzähle ich, was ich ohne Computer tun würde und was ich nicht tun muss, weil ich einen Computer habe. Es geht mir also nicht um den Computer überhaupt oder um das Wesen des Computers, sondern darum wie das, was ich als Computer bezeichne mein Leben betrifft.
Indem ich die Geschichte des Computers rekonstruiere, rekonstruiere ich insbesondere auch, wie ich gelebt hätte, bevor es Computer gab. In dieser historischen Hinsicht lebe ich zufällig im Jetzt, also unter Bedingungen, in welchen ich einen Computer verwende, statt beispielsweise als Jäger oder Sammler durch die Steppe zu ziehen. Die Idee allerdings, dass ich auch als Jäger oder Sammler hätte leben können, folgt schwerlich aus der Geschichte des Computers, ich habe sie durch naturwüchsig epochale Geschichten angeeignet, die ich in diesem Projekt problematisieren will.
Kon-Text
Ich schreibe also Geschichten von Gegenständen, die mir sinnhaft gegenüber stehen, um sie in einer Entwicklung zu begreifen, die mich betroffen macht. Durch die Zeittafeln verbinde ich sie mit anderen und auch mit konventionellen Geschichten, deren allgemeinste ich als Weltgeschichte bezeichne. Hier reduziere ich diese Geschichten auf Zeittafeln - das ist das Projekt. Ich verlinke die Zeittafeln mit dem Hyperlexikon und mit eigentlichen Geschichten, das ist Kon-Text des Projektes, in welchem es darum geht, die vielen Geschichten auf eine überschaubare serielle Reihe zu bringen.
Ich kann die Tabellen auch spezifisch ersetzen, indem ich verschiedenen Vorzeilen zur Verfügung stelle. Und schliesslich kann ich im Sinne von Registern auch den Primärschlüssel ändern. Ich stelle mir eine (Hyper-)Verschachtelung vor, die verschiedene Zugriffe und Auflösungen enthält.
Zeittafeln haben immer eine Spalte mit Kalenderdaten, die der Sortierung oder der Reihenfolge der Geschichte dient. Die narrative Möglichkeit, den Schluss der Geschichte zuerst zu erzählen und so die Geschichte zu motivieren, ist insofern aufgehoben, als ich Tabellen durch andere Tabellen, die eine Art Vorgeschichte enthalten, ersetzen kann. Aber die Geschichte bleibt "im Kopf" (mind) des Lesers.
•Konzept der Inhalte
Als Inhalt kommt in Frage, was sich plausibel in eine Zeittafel eintragen lässt. Ich bezeichne das als Stichworte für Geschichten. Geschichten sind von etwas oder über etwas, was sich im Laufe der Zeit verändert (oder eben nicht). Eine spezifische Art von Geschichten beschreibt, wie die Menschheit lebt. Diese Geschichten implizieren oder konstituieren Menschheiten. Eine andere Art von Geschichten beschreibt, wie einzelne Menschen leben. Da jede Geschichte von einem Menschen erzählt wird, zerfallen diese Geschichten in Autobiographien und in Biographien, wobei insbesondere spezifische Verallgemeinerungen von Biographien als Geschichten von Gesellungseinheiten mit sich differenzierenden Biographien erscheinen. Ein literarischer Fall davon ist die Robinsonade.
Bevor ich mich frage, worüber ich Geschichten erzähle, frage ich mich, wozu ich überhaupt Geschichten erzähle und damit verbunden, was ich dabei eigentlich erzähle.
Meistens erzähle ich Geschichten, die mir plausibel machen, warum ich gerade an einem bestimmten Ort bin oder eine bestimmte Auffassung einnehme. Ein kurze Geschichte ist beispielsweise: "Ich bin mit der Bahn gekommen". Sie impliziert Bahnnetz mit Fahrplan und erläutert warum ich wann wo bin. Dann erzähle ich oft Geschichten, die mein Wissen plausibilisieren: "Ich bin dort gewesen und habe gesehen oder ich habe Buch von xy gelesen". Dann erzähle ich oft, wie sich etwas entwickelt, um meine Erwartungen zu klären. Und schliesslich plausibilisiere ich meine Erklärungen, in dem ich erzähle, wie etwas funktioniert. Meine Geschichten machen mir Sinn.
Bleibt die Frage, wie ich wähle, was wichtig genug ist, in der Geschichte erzählt zu werden. Warum erzähle ich bestimmte Ereignisse oder vermutete Folgen dieser Ereignisse und andere nicht? Was kommt in "Meine-Welt-Geschichte"?
Bewusst erzähle ich vor allem Geschichten, deren Gegenstände ich durch die Gewährleistung meiner aktuellen Existenz begründe. Dass ich mit einem Computer schreibe, führt dann dazu, dass ich die Geschichte des Computers beobachte. Ob dabei Weltkriege in irgendeiner Form oder die chinesischen Dynastien wichtig werden, bezweifle ich vorderhand sehr. Aber diasynchron erscheinen eigentliche Computer zeitgleich mit dem sogenannten 2. Weltkrieg. Man sagt mir deshalb, dass der Computer, mit dem ich diesen Text schreibe, im Weltkrieg erfunden wurde. Aber darin erkenne ich eine tabellarische Zuordnung, die ich so kaum erzählen würde und gerade deshalb als Erzählung erkenne und durch die Zeittafel quasi begründen kann.
Meine Vorstellungen sind durch konventionelle Geschichten beeinflusst. Ich werde deshalb die mir bekannten Konventionen mitschreiben und sie mir so bewusst halten. Die Französische Revolution oder der Fall von Troja, aber auch dass an vielen Orten zur entsprechenden (oder anderer) Zeit nichts erwähnenswertes passiert ist, betrifft mein Leben kaum, oder genauer, ich kann mir nicht vorstellen wie. Auch die Weltkriege scheinen mir zunächst ohne Relevanz für meine Geschichte. Epochen und Ereignisse bekommen ihren Sinn aus den je erzählten Geschichten oder der darin enthaltenen Perspektiven. Aber es gibt Ereignisse, die in so vielen Geschichten erscheinen, dass sie quasi epochal den Primärschlüssel ersetzen. Ich höre beispielsweise oft, dass die Welt vor dem Weltkrieg eine andere war, aber nicht sehr oft, dass sie vor 1939 eine andere war. In diesem Sinne dienen beliebige oft verwendete Epochen als anschaulicherer Primärschlüssel auch wenn sie ohne Bedeutung für meine Welt sind.
Die Geschichten, die ich über meine Welt erzähle, begründen meine Welt. Ich habe zwar sinnliche Erfahrungen, aber was ich darüber sagen oder erzählen kann, sind Bedeutungen, die ich in Deutungs- oder Handlungszusammenhängen hervorbringe. Phänographisch gesprochen nehme ich beispielsweise angesichts eines Hammers einen Hammer wahr, das heisst, ich sehe nicht ein Ding, das ich als Hammer deuten müsste. Das naturwüchsige Gegebensein eines Hammer oder eines Baumes wird mir erst bewusst, wenn ich über dessen Geschichte nachdenke. Bäume und Hämmer hat es - in meinen Geschichten - nicht immer schon gegeben. Beides sind für mich Resultate von erzählbaren Evolutionen, die auf die jeweiligen Bedeutungen ausgerichtet sind und diese erst hervorbringen. Die Geschichte des Hammers erzähle ich als toolmaking animal (oder als Kaufhandlung im Supermarkt), die Geschichte des Baumes erzähle ich als beispielsweise als Darwinist.
Die Gegenstände der Geschichten
Meinen Computer und dass ich damit schreibe, beobachte ich als relevante Aspekte meiner Lebensführung, die ich mir mit meinen Geschichten bewusst mache. Ich sehe darin - wie vermittelt auch immer - meinen kollaborativen Bezug zur gesellschaftlich gewährleisteten Absicherung meines Lebens. In meiner Geschichte spielt deshalb der Computer und dessen Geschichte - im Unterschied zum trojanischen Krieg und der französischen Revolution - eine wichtige Rolle.
In den primitivsten Geschichten zum Computer ist mir bereits vorweg klar, was ein Computer ist. Die meisten Geschichten, die ich zum Computer lese, implizieren ohne jede Begründung, dass der Computer ein Gerät zum Rechnen ist und beginnen deshalb mit der Erfindung des Rechnens oder mit der Erfindung von Rechenmaschinen. Solche Geschichten machen aber den Computer erst zu einer Rechenmaschine. Ich benutze meinen Computer praktisch nie zum Rechnen. In meiner Geschichte ist er deshalb keine Rechenmaschine.
In meiner Geschichte zum Computer geht es darum, was ich in Abhängigkeit meiner situativen Befindlichkeit oder Lebensführung als Computer bezeichne. Ich rekonstruiere nicht ein Gerät jenseits davon, was ich mit diesem Gerät mache, sondern begreife das Gerät als Gerät, das ich praktisch und konkret in meinem Leben verwende. In solchen Geschichten erzähle ich, was ich ohne Computer tun würde und was ich nicht tun muss, weil ich einen Computer habe. Es geht mir also nicht um den Computer überhaupt oder um das Wesen des Computers, sondern darum wie das, was ich als Computer bezeichne mein Leben betrifft.
Indem ich die Geschichte des Computers rekonstruiere, rekonstruiere ich insbesondere auch, wie ich gelebt hätte, bevor es Computer gab. In dieser historischen Hinsicht lebe ich zufällig im Jetzt, also unter Bedingungen, in welchen ich einen Computer verwende, statt beispielsweise als Jäger oder Sammler durch die Steppe zu ziehen. Die Idee allerdings, dass ich auch als Jäger oder Sammler hätte leben können, folgt schwerlich aus der Geschichte des Computers, ich habe sie durch naturwüchsig epochale Geschichten angeeignet, die ich in diesem Projekt problematisieren will.
Kon-Text
Ich schreibe also Geschichten von Gegenständen, die mir sinnhaft gegenüber stehen, um sie in einer Entwicklung zu begreifen, die mich betroffen macht. Durch die Zeittafeln verbinde ich sie mit anderen und auch mit konventionellen Geschichten, deren allgemeinste ich als Weltgeschichte bezeichne. Hier reduziere ich diese Geschichten auf Zeittafeln - das ist das Projekt. Ich verlinke die Zeittafeln mit dem Hyperlexikon und mit eigentlichen Geschichten, das ist Kon-Text des Projektes, in welchem es darum geht, die vielen Geschichten auf eine überschaubare serielle Reihe zu bringen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Finanzstaatismus - Juli 21, 2015
"Staatismus" ist ein von Neoliberalen verwendetes Schimpfwort für eine von ihnen konstatierte zunehmende "Staatsmachtgläubigkeit" von Sozialleistungsbezügern, die sie für noch schwerer bekämpfbar halten als der Kommunismus.
Als Staatismus bezeichne ich aber eine Inversion des Finanzstaatismus, in welcher die Instrumentalisierung des Staates exzessiv betrieben wird. Ein schlagendes Beispiel ist das Bedingungsloses Grundeinkommen BGE, das dem Staat eine Art Gesamtzuständigkeit der Existenzsicherung zurechnet - weil und nachdem das "neoliberale" Finanzkapital diese Leistung für sich zunehmend oft und mehr in Anspruch genommen hat.
Als Finanzstaatismus bezeichne ich eine neue Stufe der Produktionsverhältnisse, in welchen der sich im Kapitalismus entwickelnde Finanzierungsstaat das evolutionär dominantes gesellschaftliche Verhältnis geworden ist. Diese Entwicklung wird von den neoliberalen Schulen beschrieben und das Resultat der Entwicklung wird deshalb oft als Neoliberalismus kritisiert (oder gefeiert).
Im Kapitalismus, wie ihn K. Marx beschrieben hat, beruhte der Reichtum der Kapitalisten auf dem abgeschöpften Mehrwert von bereits geleisteter Arbeit, während im Finanzstaatismus spekulativer Giral-Reichtum, der durch fiat-money entsteht, durch Staatsanleihe abgesichert wird. Die Staatsanleihe ist heute das Finanzgeschäft schlecht hin, in welchem der Kapitalismus aufgehoben ist.
Die Financier, die die eigentlichen Kapitalisten evolutionär hinter sich gelassen haben, warten nicht mehr bis der Reichtum, den sie aneignen geschaffen ist, sie produzieren ihn giral vorab, indem sie die Zentralbanken als ihre Bank-Banken missbrauchen. Die Zentralbanken müssen im bösen Spiel - das sie als private Unternehmen gerne mitspielen - schliesslich Staatsanleihen kaufen, die zuvor von "Staatsfinanzbanken" gekauft wurden, wo sie doch - wenn sie staatliche oder öffentliche Einrichtungen wären, den Staat direkt mit Geld versorgen könnten.
Die politische Argumentation ist ganz einfach: Wenn die Zentralbank dem Staat Geld geben dürfte, würde der Staat einfach hemmungslos Geld drucken lassen. Damit das nicht passiert, muss sich der Staat bei hemmungslosen Banken verschulden. Ich erkenne in dieser Argumentation den (Neo)Liberalismus, der sich den Staat nicht anders als liberal-hemmungslos vorstellen kann. Im Finanzstaatismus sind die Staaten ja offensichtlich so hemmungslos, was deren Verschuldungen eindrücklich zeigen.
Denkbar wäre - was die USA in der Not ansatzweise praktiziert - dass der Souverän eine Obergrenze der Verschuldung festlegt. Dabei müsste geklärt werden, wer souverän ist, und vor allem, warum dieser Souverän einer staatlichen Zentralbank mit Geldhoheit nicht ebenso gut - oder viel besser - eine Obergrenze beim Gelddrucken festlegen.
Eigentlich undenkbar scheint mir, die Einrichtung einer staatlichen Zentralbank ohne dass der jetzt als „Staatismus“ tabuisierte Bürgerkrieg - der in der evolutionär vorangegangenen Epoche als Klassenkampf oder als Revolution bezeichnet wurde - ausbrechen würde.
haben, warten nicht mehr bis der Reichtum, den sie aneignen geschaffen ist, sie produzieren ihn giral vorab, indem sie die Zentralbanken als ihre Bank-Banken missbrauchen. Die Zentralbanken müssen im bösen Spiel - das sie als private Unternehmen gerne mitspielen - schliesslich Staatsanleihen kaufen, die zuvor von "Staatsfinanzbanken" gekauft wurden, wo sie doch - wenn sie staatliche oder öffentliche Einrichtungen wären, den Staat direkt mit Geld versorgen könnten.
Die politische Argumentation ist ganz einfach: Wenn die Zentralbank dem Staat Geld geben dürfte, würde der Staat einfach hemmungslos Geld drucken lassen. Damit das nicht passiert, muss sich der Staat bei hemmungslosen Banken verschulden. Ich erkenne in dieser Argumentation den (Neo)Liberalismus, der sich den Staat nicht anders als liberal-hemmungslos vorstellen kann. Im Finanzstaatismus sind die Staaten ja offensichtlich so hemmungslos, was deren Verschuldungen eindrücklich zeigen.
Denkbar wäre - was die USA in der Not ansatzweise praktiziert - dass der Souverän eine Obergrenze der Verschuldung festlegt. Dabei müsste geklärt werden, wer souverän ist, und vor allem, warum dieser Souverän einer staatlichen Zentralbank mit Geldhoheit nicht ebenso gut - oder viel besser - eine Obergrenze beim Gelddrucken festlegen.
Eigentlich undenkbar scheint mir, die Einrichtung einer staatlichen Zentralbank ohne dass der jetzt als „Staatismus“ tabuisierte Bürgerkrieg - der in der evolutionär vorangegangenen Epoche als Klassenkampf oder als Revolution bezeichnet wurde - ausbrechen würde.
[0 Kommentar]
Inhalt
Zeittafeln als Geschichtslexikon - Juli 9, 2015
In einem Lexikon (auch in meinem Hyper-Lexikon) sehe ich eine Art Literatur, in welcher das narrative Element der Erzählung fehlt. Ich kann mir zu den Einträgen im Lexikon Rahmenhandlungen vorstellen, wie sie etwa Sokrates in seinen Dialogen oder Galilei in seinen Diskursen verwenden, so dass spreche nde Idioten in ihrer Konfusion immer erzählen, wie sie ihre Worte verwenden. Ich kann mir aber auch ein gewöhnliches wissenschaftliches Stück Literatur vorstellen, bei welchem - wie bei einem easy-rider-Chopper - alles weggeschnitten wurde, was über Definitionen hinausgeht.
Einen Teil dessen, was mit der fehlenden Narration verloren geht, wurden in der Encyclopedia Britannica (1. Auflage 1768–1771) als alternative Darstellungen zur bis dahin üblichen Prosa-Chronik durch sogenannte Zeittafeln ersetzt.
Ich lese Zeittafeln als eine spezielle Form von Erzählungen, sie beruhen auf einer zurückblickenden Auswahl, die überdies oft Kategorien verwendet, die nur in der Rückschau möglich sind. Die Epochenbezeichnung "Renaissance" beispielsweise stammt aus dem 19. Jhd. und meint eine Zeit im 16. Jhd., in welcher die Epoche als solche und auch die vermeintliche Wiedergeburt wohl (noch) nicht erlebt wurde. Wenn ich also die Renaissance in einer Zeittafel der Jahreszahl 1600 zuordne, erzähle ich - mehr oder weniger bewusst - dass um 1900 gesehen wurde, dass um 1500 im damaligen Italien vieles wieder so gesehen wurde wie es 400 vor Christus im damaligen Griechenland gesehen wurde. Das ist ein zeit-typischer Anfang einer Geschichte, in welcher Beobachtungen beobachtet werden (können).
Eine mögliche Beobachtung besteht in einer Inversion: Im 19. Jhd. wurde anhand des Wissens über das 16. Jhd. das 4. Jhd. vor Christus rekonstruiert. Die Kategorien stammen in dieser Perspektive nicht aus dem 16. Jhd. und schon gar nicht aus dem 4. Jhd. vor Christus, sondern sind Projektionen, die ich durch den Epochenbegriff auch heute aktivieren kann - aber nicht muss.
In meinem diasynchron-Projekt will ich solche Projektionen durchspielen. Aktuell interessiert mich neben der Renaissance gerade der etwa zeitgleiche Merkantilismus, weil ich mich mit Geld befasse. Interessant finde ich, welche Epochen zu gleichen Zeit stattfinden, und was sie gegenseitig von sich erzählen.
Als Projekt bezeichne ich dieses Unterfangen, weil ich vage Entwürfe für eine grosse Arbeit habe, von welcher ich noch nicht annehme, dass ich sie je ausführen werde. Die Arbeit besteht im Erstellen von diasynchronen Zeittafel, die dann als Objekte das Resultat des Projektes darstellen (werden oder würden). Vorderhand habeich einige Ideen oder vage Konzepte, die ich in Entwürfen (was in gewisser Hinsicht ein deutsches Wort für Projekt ist) quasi dialogisch entwickle.
Zeittafeln markieren Chronos, aber was in die jeweilige Tafel gehört, hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern hängt ab, vom Gegenstand der jeweils gemeinten Geschichte. Die Schulbuch-Geschichte thematisiert Völker, Nationen und Kriege, also Herrschaft über Blut und Boden. Man kann - und in den meisten Schulbüchern wird das getan - die Perspektive und den narrativen Faden ausblenden. Die "Welt"geschichte erscheint dann in Episoden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten der Erde. Am Anfang unserer Zeitrechnung etwa hat die Geschichte fast ausschliesslich in Griechenland und dann im Römischen Reich gespielt. Die "Welt"karte gibt mir aber keinerlei Indizien dafür, dass an den andern Orten auf der Erde nichts passiert wäre. Es ist bloss nicht Gegenstand einer bestimmten Geschichte. Später scheint dieser Geschichte zufolge auch in Griechenland und rund um Rom nichts mehr passiert zu sein, die Geschichte ist zu andern Schauplätzen gewandert. Die sogenannten Weltkriege dagegen erscheinen umgekehrt als weltweite Kriege, obwohl in dieser Zeit auch an vielen Orten auf der Erde nichts passiert ist. Die Wahl der Orte und die Benennung der Ereignisse sind offensichtlich beliebig, das heisst im Belieben des Erzählers der jeweiligen Geschichte.
Jeder Geschichtenerzähler erzählt seine eigene Geschichte. Viele Geschichtenerzähler erzählen aber sehr oft eine sehr ähnliche Geschichte, vielleicht, weil sie diese Geschichte schon kennen. Auf einer bestimmten psychologischen Entwicklungsstufe, die ich bei Kleinkindern ausgeprägt finden kann, ist wichtig, dass die Geschichte nicht verändert wird. Auch Märchen müssen dann wortgetreu erzählt werden. Bestimmte Geschichten institutionalisieren sich, typischerweise in Kirchen, während bestimmte Institutionen, etwa Schulen, festlegen, welche Geschichten wie erzählt werden müssen.
Im Krieg der Institutionen gibt es sogenannte Geschichtsfälschungen. Dabei wird dieselbe Geschichte anders erzählt, wodurch sie nicht mehr dieselbe ist. Ein Beispiel dafür sind Verschwörungstheorien. Wenn ich eine Geschichte fälschen kann, kann das natürlich jeder, aber das würde insgesamt nur dann gehen, wenn es eine richtige Geschichte gäbe.
Oft wird zwar die Geschichte als Faktum gleich erzählt, aber verschieden interpretiert. Dazu gibt es viele Beispiele von relativ einfältigen parteipolitischen Interpretationen. Es gibt aber auch interessantere Fälle wie etwa, inwiefern und für wen die Erfindung des Ackerbaus gut war. In einer Gesellschaft, die Ackerbau betreibt, erscheint Ackerbau nach einer gewissen Zeit (nämlich wenn er wegen der Bevölkerungsexplosion, die er ermöglicht hat, notwendig geworden ist) naturwüchsig und nicht mehr als bewusste Entscheidung.
Eine besondere Form der Geschichtsfälschung betrifft nicht die Gegenstände, sondern den Primärschlüssel der Tabelle. Ein Beispiel dafür ist das erfundene Mittelalter. Dabei wird natürlich nicht die Zeit sondern der Chronos variiert, was aber in Bezug auf Zeittabellen ziemliche Komplikationen schafft.
Und schliesslich gibt es Geschichtskritik durch Relativierungen der Kontexte, was auch sichtbar macht, wie welche Geschichte nicht erzählt werden sollte. Ein Beispiel dafür - das mich auch inspiriert hat - ist die synchronoptisch Geschichte, deren Naturwüchsigkeit ich hier noch etwas genauer beobachten will.
Die synchronoptisch Geschichte ist als spezielle Zeittafel konzipiert. In der Vorspalte stehen - wie in anderen Geschichten - als Primärschlüssel Zeitangaben. Die Vorzeile dagegen ist ein Raster, das über die Oberfläche der Erde gelegt wird. So ergibt sich eine Tabelle ohne Inhalte in den einzelnen Zellen. Wenn ich die Geschichte so darstelle, kann ich jede Zelle mit Ereignissen füllen oder leer lassen. Die leeren Zellen bedeuten, dass dort zu dieser Zeit nichts passiert ist, was in die Geschichte gehört. Das lenkt meine Aufmerksamkeit auf die gefüllten Zellen:
Was gehört in eine "Welt"geschichte? Es gibt ja schon viele Geschichtsbücher und damit die Konservierung von naturwüchsigen Konventionen. Weltgeschichte komplementiert die politische Ökonomie. Deshalb beschreibt die Weltgeschichte zuerst, wie sich die Nationen auf der Erdoberfläche verteilen und welche Kriege sie führen. Dann beschreibt sie aufgrund welcher Technik Kriege gewonnen werden und schliesslich wie die Herrschaftsverhältnisse kulturell symbolisiert werden, was P. Weiss als Aesthetik des Widerstandes reflektiert. Interessanterweise hat A. Peters neben den üblichsten Konventionen Bauwerke (Städtebau als Kultur) speziell hervorgehoben, auch heute noch bauen die reichsten Nationen die höchsten Gebäude.
Eine solche Geschichte haben A. und A. Peters 1952 als "Zeitatlas" vorgelegt. Sie wurde aufgrund dieser Form zunächst sehr gefeiert, dann aber aufgrund der (marxistisch gemeinten) Inhalte ebenso sehr kritisiert. Kritisch ist für mich nicht, inwiefern und ob eine Geschichte "marxistisch" ist, sondern die Frage, was ich in die Zellen eines Zeitatlasses schreiben und damit zu einer Geschichte machen würde. Kritisch ist für mich auch die Wahl der Erdoberfläche als Gesamtprojektionsfläche für die so unterstellte "Welt"geschichte als Sammelsurium von zeitgleichen Geschichten, wobei der diachrone Aspekt von Gegenständen praktisch verschwindet.
Die Idee meines Projektes besteht in diasynchronen Geschichten, die einen Erzähler und eine explizite Perspektive haben, die ich in der individuell wahrgenommenen Unterhaltung und Sicherung des Lebens des Erzählers sehe. In meinen Geschichten reflektiere ich die Gewährleistung meines Lebens. Ich erzähle in meiner Sprache und mit meinen Kategorien, was für mich Sinn ergibt. Meine Sprache und meine "Denkformen" sehe ich als Aneignungen und gerade nicht als gesellschaftliches Gut. Ich weiss nicht, wie ich dazu gekommen bin, meine Um-Welt so zu konstruieren, wie ich ich sie beschreibe. Ich weiss aber auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, sie überhaupt zu beschreiben.
Vordergründig beschreibe ich Verhältnisse, die ich auch von anderen beschrieben sehe und ich mache das in einer Sprache, in welcher ich auch andere sprechen höre. Im Sinne des Radikalen Konstruktivismus sind meine Deutungen aber eben meine Deutungen, die ich dialogisch entfalte (worüber ich gelegentlich noch etwas mehr schreiben werde)
nde Idioten in ihrer Konfusion immer erzählen, wie sie ihre Worte verwenden. Ich kann mir aber auch ein gewöhnliches wissenschaftliches Stück Literatur vorstellen, bei welchem - wie bei einem easy-rider-Chopper - alles weggeschnitten wurde, was über Definitionen hinausgeht.
Einen Teil dessen, was mit der fehlenden Narration verloren geht, wurden in der Encyclopedia Britannica (1. Auflage 1768–1771) als alternative Darstellungen zur bis dahin üblichen Prosa-Chronik durch sogenannte Zeittafeln ersetzt.
Ich lese Zeittafeln als eine spezielle Form von Erzählungen, sie beruhen auf einer zurückblickenden Auswahl, die überdies oft Kategorien verwendet, die nur in der Rückschau möglich sind. Die Epochenbezeichnung "Renaissance" beispielsweise stammt aus dem 19. Jhd. und meint eine Zeit im 16. Jhd., in welcher die Epoche als solche und auch die vermeintliche Wiedergeburt wohl (noch) nicht erlebt wurde. Wenn ich also die Renaissance in einer Zeittafel der Jahreszahl 1600 zuordne, erzähle ich - mehr oder weniger bewusst - dass um 1900 gesehen wurde, dass um 1500 im damaligen Italien vieles wieder so gesehen wurde wie es 400 vor Christus im damaligen Griechenland gesehen wurde. Das ist ein zeit-typischer Anfang einer Geschichte, in welcher Beobachtungen beobachtet werden (können).
Eine mögliche Beobachtung besteht in einer Inversion: Im 19. Jhd. wurde anhand des Wissens über das 16. Jhd. das 4. Jhd. vor Christus rekonstruiert. Die Kategorien stammen in dieser Perspektive nicht aus dem 16. Jhd. und schon gar nicht aus dem 4. Jhd. vor Christus, sondern sind Projektionen, die ich durch den Epochenbegriff auch heute aktivieren kann - aber nicht muss.
In meinem diasynchron-Projekt will ich solche Projektionen durchspielen. Aktuell interessiert mich neben der Renaissance gerade der etwa zeitgleiche Merkantilismus, weil ich mich mit Geld befasse. Interessant finde ich, welche Epochen zu gleichen Zeit stattfinden, und was sie gegenseitig von sich erzählen.
Als Projekt bezeichne ich dieses Unterfangen, weil ich vage Entwürfe für eine grosse Arbeit habe, von welcher ich noch nicht annehme, dass ich sie je ausführen werde. Die Arbeit besteht im Erstellen von diasynchronen Zeittafel, die dann als Objekte das Resultat des Projektes darstellen (werden oder würden). Vorderhand habeich einige Ideen oder vage Konzepte, die ich in Entwürfen (was in gewisser Hinsicht ein deutsches Wort für Projekt ist) quasi dialogisch entwickle.
Zeittafeln markieren Chronos, aber was in die jeweilige Tafel gehört, hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern hängt ab, vom Gegenstand der jeweils gemeinten Geschichte. Die Schulbuch-Geschichte thematisiert Völker, Nationen und Kriege, also Herrschaft über Blut und Boden. Man kann - und in den meisten Schulbüchern wird das getan - die Perspektive und den narrativen Faden ausblenden. Die "Welt"geschichte erscheint dann in Episoden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten der Erde. Am Anfang unserer Zeitrechnung etwa hat die Geschichte fast ausschliesslich in Griechenland und dann im Römischen Reich gespielt. Die "Welt"karte gibt mir aber keinerlei Indizien dafür, dass an den andern Orten auf der Erde nichts passiert wäre. Es ist bloss nicht Gegenstand einer bestimmten Geschichte. Später scheint dieser Geschichte zufolge auch in Griechenland und rund um Rom nichts mehr passiert zu sein, die Geschichte ist zu andern Schauplätzen gewandert. Die sogenannten Weltkriege dagegen erscheinen umgekehrt als weltweite Kriege, obwohl in dieser Zeit auch an vielen Orten auf der Erde nichts passiert ist. Die Wahl der Orte und die Benennung der Ereignisse sind offensichtlich beliebig, das heisst im Belieben des Erzählers der jeweiligen Geschichte.
Jeder Geschichtenerzähler erzählt seine eigene Geschichte. Viele Geschichtenerzähler erzählen aber sehr oft eine sehr ähnliche Geschichte, vielleicht, weil sie diese Geschichte schon kennen. Auf einer bestimmten psychologischen Entwicklungsstufe, die ich bei Kleinkindern ausgeprägt finden kann, ist wichtig, dass die Geschichte nicht verändert wird. Auch Märchen müssen dann wortgetreu erzählt werden. Bestimmte Geschichten institutionalisieren sich, typischerweise in Kirchen, während bestimmte Institutionen, etwa Schulen, festlegen, welche Geschichten wie erzählt werden müssen.
Im Krieg der Institutionen gibt es sogenannte Geschichtsfälschungen. Dabei wird dieselbe Geschichte anders erzählt, wodurch sie nicht mehr dieselbe ist. Ein Beispiel dafür sind Verschwörungstheorien. Wenn ich eine Geschichte fälschen kann, kann das natürlich jeder, aber das würde insgesamt nur dann gehen, wenn es eine richtige Geschichte gäbe.
Oft wird zwar die Geschichte als Faktum gleich erzählt, aber verschieden interpretiert. Dazu gibt es viele Beispiele von relativ einfältigen parteipolitischen Interpretationen. Es gibt aber auch interessantere Fälle wie etwa, inwiefern und für wen die Erfindung des Ackerbaus gut war. In einer Gesellschaft, die Ackerbau betreibt, erscheint Ackerbau nach einer gewissen Zeit (nämlich wenn er wegen der Bevölkerungsexplosion, die er ermöglicht hat, notwendig geworden ist) naturwüchsig und nicht mehr als bewusste Entscheidung.
Eine besondere Form der Geschichtsfälschung betrifft nicht die Gegenstände, sondern den Primärschlüssel der Tabelle. Ein Beispiel dafür ist das erfundene Mittelalter. Dabei wird natürlich nicht die Zeit sondern der Chronos variiert, was aber in Bezug auf Zeittabellen ziemliche Komplikationen schafft.
Und schliesslich gibt es Geschichtskritik durch Relativierungen der Kontexte, was auch sichtbar macht, wie welche Geschichte nicht erzählt werden sollte. Ein Beispiel dafür - das mich auch inspiriert hat - ist die synchronoptisch Geschichte, deren Naturwüchsigkeit ich hier noch etwas genauer beobachten will.
Die synchronoptisch Geschichte ist als spezielle Zeittafel konzipiert. In der Vorspalte stehen - wie in anderen Geschichten - als Primärschlüssel Zeitangaben. Die Vorzeile dagegen ist ein Raster, das über die Oberfläche der Erde gelegt wird. So ergibt sich eine Tabelle ohne Inhalte in den einzelnen Zellen. Wenn ich die Geschichte so darstelle, kann ich jede Zelle mit Ereignissen füllen oder leer lassen. Die leeren Zellen bedeuten, dass dort zu dieser Zeit nichts passiert ist, was in die Geschichte gehört. Das lenkt meine Aufmerksamkeit auf die gefüllten Zellen:
Was gehört in eine "Welt"geschichte? Es gibt ja schon viele Geschichtsbücher und damit die Konservierung von naturwüchsigen Konventionen. Weltgeschichte komplementiert die politische Ökonomie. Deshalb beschreibt die Weltgeschichte zuerst, wie sich die Nationen auf der Erdoberfläche verteilen und welche Kriege sie führen. Dann beschreibt sie aufgrund welcher Technik Kriege gewonnen werden und schliesslich wie die Herrschaftsverhältnisse kulturell symbolisiert werden, was P. Weiss als Aesthetik des Widerstandes reflektiert. Interessanterweise hat A. Peters neben den üblichsten Konventionen Bauwerke (Städtebau als Kultur) speziell hervorgehoben, auch heute noch bauen die reichsten Nationen die höchsten Gebäude.
Eine solche Geschichte haben A. und A. Peters 1952 als "Zeitatlas" vorgelegt. Sie wurde aufgrund dieser Form zunächst sehr gefeiert, dann aber aufgrund der (marxistisch gemeinten) Inhalte ebenso sehr kritisiert. Kritisch ist für mich nicht, inwiefern und ob eine Geschichte "marxistisch" ist, sondern die Frage, was ich in die Zellen eines Zeitatlasses schreiben und damit zu einer Geschichte machen würde. Kritisch ist für mich auch die Wahl der Erdoberfläche als Gesamtprojektionsfläche für die so unterstellte "Welt"geschichte als Sammelsurium von zeitgleichen Geschichten, wobei der diachrone Aspekt von Gegenständen praktisch verschwindet.
Die Idee meines Projektes besteht in diasynchronen Geschichten, die einen Erzähler und eine explizite Perspektive haben, die ich in der individuell wahrgenommenen Unterhaltung und Sicherung des Lebens des Erzählers sehe. In meinen Geschichten reflektiere ich die Gewährleistung meines Lebens. Ich erzähle in meiner Sprache und mit meinen Kategorien, was für mich Sinn ergibt. Meine Sprache und meine "Denkformen" sehe ich als Aneignungen und gerade nicht als gesellschaftliches Gut. Ich weiss nicht, wie ich dazu gekommen bin, meine Um-Welt so zu konstruieren, wie ich ich sie beschreibe. Ich weiss aber auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, sie überhaupt zu beschreiben.
Vordergründig beschreibe ich Verhältnisse, die ich auch von anderen beschrieben sehe und ich mache das in einer Sprache, in welcher ich auch andere sprechen höre. Im Sinne des Radikalen Konstruktivismus sind meine Deutungen aber eben meine Deutungen, die ich dialogisch entfalte (worüber ich gelegentlich noch etwas mehr schreiben werde)
[0 Kommentar]
Inhalt
Robinsonaden - Juli 6, 2015
Als "Robinsonaden" bezeichne ich Geschichten, in welchen ein einzelner Menschen seinen Haushalt organisiert.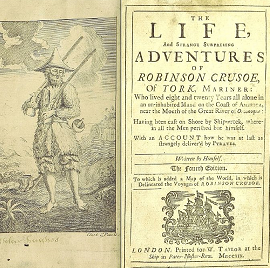 Die namengebende Welt des Robinson Crusoe war eine Insel, auf welcher er als Schiffbrüchiger alleine leben musste. Robinson erzählte, wie er um sein Überleben zu sichern zahlreiche Tätigkeiten wie Ackerbau, Zimmermannshandwerk, Schneidern usw., die mir als gesellschaftliche Kulturtechniken bekannt sind, selbst ausführen musste. Robinson ist allerdings nicht vom Himmer gefallen, er wusste aus seinem vormaligen Leben in der Gesellschaft, wie er seine Welt einrichten musste und er hat auch Werkzeuge, Kleider und Waffen, die er nicht erst erfinden musste. Er wusste insbesondere auch, wie er mit dann doch erscheinenden Menschen umzugehen hatte, was er überdies auf die Moral bezog, die er in seiner Bibel, die er auch nicht selbst geschrieben hat, gefunden hat.
Der Witz der Robinsonade besteht darin, als Individuum zu leben und aus den darin erkannten Bedürfnissen eine Gesellschaftsform herzuleiten.
Ich unterscheide zwei zwei Formen, mit "Robinsonaden" umzugehen:
- ich kann eine Robinsonade erfinden und erzählen oder
- ich kann die Robinsonade als bürgerliche Ideologie kritisieren.
Ersteres hat auch D. Defoe getan, letzteres hat auch K. Marx getan.
Die "Robinsonade" als Utopie
In den Utopien wird die Robinsonade als literarische Form verwendet. Bekannte Beispiele sind Walden von H. Thoreau, der sich - wie Robinson, aber freiwillig - in die Wälder zurüchgezogen hat. Und Käpten Nemo von J. Verne, der sich - halb freiwillig - auf ein Uboot zurückgezogen hat, oder die die Insel-Aneigner auch von J. Verne. Man kann unter beliebig vielen Werken auch Herr der Fliegen so sehen.
Die (von K. Marx entdeckte) "Robinsonade" in der Ökonomie
In den Utopien im engeren Sinne wie etwa in Walden II von B. Skinner wird oft auch die Ökonomie mitbehandelt. Dabei wird aber gerade der Kapitalismus sehr oft kritisiert, so dass der Ideologie-Vorwurf von K. Marx zumindest ambivalent erscheint. K. Marx hatte mit seiner Kritik vor allem das Werk von A. Smith im Auge, dessen Robinson von Natur aus so gestaltet ist, dass er im denkbar besten Fall ein Kapitalist werden muss.
Silvio Gesell dagegen bringt seine ökonomische Robinsonade explizit ins Spiel und zeigt damit vor allem, dass die Erzählform mit Robinson sachlich belanglos sein kann. S. Gesells Robinson spielt den Idioten in einem gesell-sokratischen Diskurs. Dieser Robinson ist nicht Herr seiner Lage, er wird belehrt (und ist wohl als K. Marx erkennbar).
Ich habe eine eigene Auffassung der utopischen Robinsonade als Remake von Skinners Walden II geschrieben: Walden III. Mir ging es auch darum, dass die Insel nicht räumlich abgegrenzt sein muss und von vielen Robinsons bewohnt sein kann.
Eine bewusste Art der Robinsonade wähle ich in meinem Projekt diasynchron, wo ich meine Kategorien nicht konservativ reproduzieren will. Die Frage ist, welche Geschichten soll ich mir erzählen, und warum gerade die. Warum beispielsweise sind Kriege, Nationen oder Religionen jenseits davon, dass sie oft im Gespräch sind, wichtig. Spielen sie in meinem Leben eine Rolle oder sind sie jenseits von mir, einfach das was in die Geschichte von wem auch immer gehört?Meine Robinsonade handelt von einem Robinson, der gerade zufällig hier und jetzt lebt, aber keine GeschichtE, sondern nur GeschichteN kennt.
Ich berichte später mehr ;-)
Die namengebende Welt des Robinson Crusoe war eine Insel, auf welcher er als Schiffbrüchiger alleine leben musste. Robinson erzählte, wie er um sein Überleben zu sichern zahlreiche Tätigkeiten wie Ackerbau, Zimmermannshandwerk, Schneidern usw., die mir als gesellschaftliche Kulturtechniken bekannt sind, selbst ausführen musste. Robinson ist allerdings nicht vom Himmer gefallen, er wusste aus seinem vormaligen Leben in der Gesellschaft, wie er seine Welt einrichten musste und er hat auch Werkzeuge, Kleider und Waffen, die er nicht erst erfinden musste. Er wusste insbesondere auch, wie er mit dann doch erscheinenden Menschen umzugehen hatte, was er überdies auf die Moral bezog, die er in seiner Bibel, die er auch nicht selbst geschrieben hat, gefunden hat.
Der Witz der Robinsonade besteht darin, als Individuum zu leben und aus den darin erkannten Bedürfnissen eine Gesellschaftsform herzuleiten.
Ich unterscheide zwei zwei Formen, mit "Robinsonaden" umzugehen:
- ich kann eine Robinsonade erfinden und erzählen oder
- ich kann die Robinsonade als bürgerliche Ideologie kritisieren.
Ersteres hat auch D. Defoe getan, letzteres hat auch K. Marx getan.
Die "Robinsonade" als Utopie
In den Utopien wird die Robinsonade als literarische Form verwendet. Bekannte Beispiele sind Walden von H. Thoreau, der sich - wie Robinson, aber freiwillig - in die Wälder zurüchgezogen hat. Und Käpten Nemo von J. Verne, der sich - halb freiwillig - auf ein Uboot zurückgezogen hat, oder die die Insel-Aneigner auch von J. Verne. Man kann unter beliebig vielen Werken auch Herr der Fliegen so sehen.
Die (von K. Marx entdeckte) "Robinsonade" in der Ökonomie
In den Utopien im engeren Sinne wie etwa in Walden II von B. Skinner wird oft auch die Ökonomie mitbehandelt. Dabei wird aber gerade der Kapitalismus sehr oft kritisiert, so dass der Ideologie-Vorwurf von K. Marx zumindest ambivalent erscheint. K. Marx hatte mit seiner Kritik vor allem das Werk von A. Smith im Auge, dessen Robinson von Natur aus so gestaltet ist, dass er im denkbar besten Fall ein Kapitalist werden muss.
Silvio Gesell dagegen bringt seine ökonomische Robinsonade explizit ins Spiel und zeigt damit vor allem, dass die Erzählform mit Robinson sachlich belanglos sein kann. S. Gesells Robinson spielt den Idioten in einem gesell-sokratischen Diskurs. Dieser Robinson ist nicht Herr seiner Lage, er wird belehrt (und ist wohl als K. Marx erkennbar).
Ich habe eine eigene Auffassung der utopischen Robinsonade als Remake von Skinners Walden II geschrieben: Walden III. Mir ging es auch darum, dass die Insel nicht räumlich abgegrenzt sein muss und von vielen Robinsons bewohnt sein kann.
Eine bewusste Art der Robinsonade wähle ich in meinem Projekt diasynchron, wo ich meine Kategorien nicht konservativ reproduzieren will. Die Frage ist, welche Geschichten soll ich mir erzählen, und warum gerade die. Warum beispielsweise sind Kriege, Nationen oder Religionen jenseits davon, dass sie oft im Gespräch sind, wichtig. Spielen sie in meinem Leben eine Rolle oder sind sie jenseits von mir, einfach das was in die Geschichte von wem auch immer gehört?Meine Robinsonade handelt von einem Robinson, der gerade zufällig hier und jetzt lebt, aber keine GeschichtE, sondern nur GeschichteN kennt.
Ich berichte später mehr ;-)
[0 Kommentar]
Inhalt
Projekt Software-Geschichte - Juni 18, 2015
 Diese Software-Geschichte hat drei Teile: Hardware, Betriebssystem und Programme, wobei das Betriebssystem auch ein Programm ist.
1) Hardware
Als Hardware gelten hier programmierbare Automaten wobei datengesteuerte Automaten nicht zu den programmierbaren Automaten gezählt werden. Es geht also um die explizite Unterscheidung Programme/Daten im Sinne von J. von Neumann. Automaten haben eine explizit konstruierte Steuerung, die ich als Prozessor bezeichne. Die Programmierung betrifft immer und ausschliesslich die Steuerung.
Die Universalität der Turingmaschine betrifft die Steuerung. Es gibt keine universelle Maschine, jede Maschine hat eine eigenständige Funktion.
Bei einem ABS-Bremssystem beispielsweise ist die Funktion das geregelte Bremsen. Dabei vermittelt der Prozessor zwischen Fahr- und Bremszuständen. Man kann auch bei diesem Prozessor verschiedene Programme laden, weil man die Funktion der Bremsregelung verschieden interpretieren kann. Bei einem Computer vermittelt der Prozessor unter anderem zwischen der Tastatur und dem Bildschirm, wobei der Prozessor aus vielen Prozessoren bestehen kann.
Hardware bezeichnet in diesem Sinne ein Halbfabrikat, das erst durch die Programmierung zu einem Automaten wird. Das Kriterium für Software besteht darin, dass verschiedene Programme funktional verschiedene Automaten bewirken.
2) Programm
Als Programm bezeichne ich die Softwareteile in der Steuerung einer Hardware, die praktisch ohne Aufwand ausgewechselt werden, wenn die Software eine andere Funktion erfüllen soll (noch etwas differenzierter hier)
Wenn ich bei meinem Handmixer oder meiner Black&Decker die Funktion verändern will, wechsle das eingesetzte Werkzeug. Wenn ich meinen PC von einer Buchhaltungsmaschine zu einer Textbearbeitungsmaschine verändern will, wechsle ich ein Programm. Die Werkzeuge sind Teile der Maschine, die Programme sind Teile der Steuerung.
Meine Black&Decker ist ohne eingesetztes Werkzeug ein Halbfabrikat, obwohl ich sie als Ware in diesem Zustand kaufe. Mein PC ist ohne Programme ein Halbfabrikat.
Programme sind - entgegen einer verbreiteten Vorstellung - ihrerseits Hardware. Sie sind materielle Teile, die nicht leicht verändert werden können. Sie bekommen ihren Sinn durch eine Maschinensteuerung, in welcher sie leicht ausgewechselt werden können, so dass die Maschine als Software verschiedene Funktionen erfüllen kann. "Soft" bezeichnet die einfache Veränderung der Funktion.
3) Betriebssystem
Als Betriebssystem bezeichne ich Programme, die unter funktionalem Gesichtspunkt nicht ausgewechselt werden. Die Entwicklung der programmierbaren Maschinensteuerung, die ich als Prozessor bezeichne, geht dahin, immer mehr Teilprozesse flexibel, also programmierbar zu machen. In den Maschinen, in welchen solche Steuerungen eingesetzt werden, unterscheide ich deshalb Programme, die die Funktion der Maschine betreffen, und oft als Anwendungen bezeichnet werden, von Programmen, die für alle Maschinenfunktionen und spezielle auch für das Wechseln dieser Funktionen verwendet und deshalb auch nicht ausgewechselt werden.
Die Funktion des Betriebssystem besteht darin, zwischen den funktionalen Programmen, die nach Bedarf gewechselt werden und der festgelegten Hardware zu vermitteln. Metaphorisch übernehme ich die Funktion des Betriebssystem, wenn ich bei meiner Black&Decker den Bohrer gegen eine Schleifscheibe austausche. In Bezug auf Steuerungen anschaulich ist diese Funktion etwa, wenn ich bei einem lochkartengesteuerten Webstuhl ein anderes Lochkartenband einsetze, um ein andere Stoffmuster zu weben.
Bei einem hinreichend entwickelten Computer fallen eine sehr grosse Menge von Steuerungsoperationen an. Das Wechseln einer Anwendung ist dabei ein anschaulicher Fall. Die Organisation des Betriebssystems repräsentiert die Prozesse und deren Schnittstellen, die durch die verschiedenen funktionalen Verwendungen der Maschine betroffen sind.
Eine Geschichte der Software - wie ich sie hiermit plane - beschreibt die Evolution des Betriebssystems im Sinne einer zunehmenden Einbindung von Prozessen und einer Flexibilisierung dieser Einbindungen. Die elementare Funktion ist Einbindung von Programmen in den Prozessor. Die(se) Geschichte muss also relativ zu diesen beiden Begriffen geschrieben werden. Sie beginnt deshalb mit dem ersten Programm im ersten Prozessor.
Wenn ich diese Geschichte als Evolution beschreibe, begreife ich den ersten Prozessor durch technologische Kategorien der aktuell höchstentwickelten. So wie ich die Anatomie der Säugetiere aufgrund meiner eigenen evolutionstheoretisch späteren Anatomie beobachte, sehe ich in einfachen Prozessoren die Andeutungen zu entwickelteren Stufen, weil ich letztere bereits kenne. Evolutionen beschreibe ich rückwärtsblickend.
Diese Software-Geschichte hat drei Teile: Hardware, Betriebssystem und Programme, wobei das Betriebssystem auch ein Programm ist.
1) Hardware
Als Hardware gelten hier programmierbare Automaten wobei datengesteuerte Automaten nicht zu den programmierbaren Automaten gezählt werden. Es geht also um die explizite Unterscheidung Programme/Daten im Sinne von J. von Neumann. Automaten haben eine explizit konstruierte Steuerung, die ich als Prozessor bezeichne. Die Programmierung betrifft immer und ausschliesslich die Steuerung.
Die Universalität der Turingmaschine betrifft die Steuerung. Es gibt keine universelle Maschine, jede Maschine hat eine eigenständige Funktion.
Bei einem ABS-Bremssystem beispielsweise ist die Funktion das geregelte Bremsen. Dabei vermittelt der Prozessor zwischen Fahr- und Bremszuständen. Man kann auch bei diesem Prozessor verschiedene Programme laden, weil man die Funktion der Bremsregelung verschieden interpretieren kann. Bei einem Computer vermittelt der Prozessor unter anderem zwischen der Tastatur und dem Bildschirm, wobei der Prozessor aus vielen Prozessoren bestehen kann.
Hardware bezeichnet in diesem Sinne ein Halbfabrikat, das erst durch die Programmierung zu einem Automaten wird. Das Kriterium für Software besteht darin, dass verschiedene Programme funktional verschiedene Automaten bewirken.
2) Programm
Als Programm bezeichne ich die Softwareteile in der Steuerung einer Hardware, die praktisch ohne Aufwand ausgewechselt werden, wenn die Software eine andere Funktion erfüllen soll (noch etwas differenzierter hier)
Wenn ich bei meinem Handmixer oder meiner Black&Decker die Funktion verändern will, wechsle das eingesetzte Werkzeug. Wenn ich meinen PC von einer Buchhaltungsmaschine zu einer Textbearbeitungsmaschine verändern will, wechsle ich ein Programm. Die Werkzeuge sind Teile der Maschine, die Programme sind Teile der Steuerung.
Meine Black&Decker ist ohne eingesetztes Werkzeug ein Halbfabrikat, obwohl ich sie als Ware in diesem Zustand kaufe. Mein PC ist ohne Programme ein Halbfabrikat.
Programme sind - entgegen einer verbreiteten Vorstellung - ihrerseits Hardware. Sie sind materielle Teile, die nicht leicht verändert werden können. Sie bekommen ihren Sinn durch eine Maschinensteuerung, in welcher sie leicht ausgewechselt werden können, so dass die Maschine als Software verschiedene Funktionen erfüllen kann. "Soft" bezeichnet die einfache Veränderung der Funktion.
3) Betriebssystem
Als Betriebssystem bezeichne ich Programme, die unter funktionalem Gesichtspunkt nicht ausgewechselt werden. Die Entwicklung der programmierbaren Maschinensteuerung, die ich als Prozessor bezeichne, geht dahin, immer mehr Teilprozesse flexibel, also programmierbar zu machen. In den Maschinen, in welchen solche Steuerungen eingesetzt werden, unterscheide ich deshalb Programme, die die Funktion der Maschine betreffen, und oft als Anwendungen bezeichnet werden, von Programmen, die für alle Maschinenfunktionen und spezielle auch für das Wechseln dieser Funktionen verwendet und deshalb auch nicht ausgewechselt werden.
Die Funktion des Betriebssystem besteht darin, zwischen den funktionalen Programmen, die nach Bedarf gewechselt werden und der festgelegten Hardware zu vermitteln. Metaphorisch übernehme ich die Funktion des Betriebssystem, wenn ich bei meiner Black&Decker den Bohrer gegen eine Schleifscheibe austausche. In Bezug auf Steuerungen anschaulich ist diese Funktion etwa, wenn ich bei einem lochkartengesteuerten Webstuhl ein anderes Lochkartenband einsetze, um ein andere Stoffmuster zu weben.
Bei einem hinreichend entwickelten Computer fallen eine sehr grosse Menge von Steuerungsoperationen an. Das Wechseln einer Anwendung ist dabei ein anschaulicher Fall. Die Organisation des Betriebssystems repräsentiert die Prozesse und deren Schnittstellen, die durch die verschiedenen funktionalen Verwendungen der Maschine betroffen sind.
Eine Geschichte der Software - wie ich sie hiermit plane - beschreibt die Evolution des Betriebssystems im Sinne einer zunehmenden Einbindung von Prozessen und einer Flexibilisierung dieser Einbindungen. Die elementare Funktion ist Einbindung von Programmen in den Prozessor. Die(se) Geschichte muss also relativ zu diesen beiden Begriffen geschrieben werden. Sie beginnt deshalb mit dem ersten Programm im ersten Prozessor.
Wenn ich diese Geschichte als Evolution beschreibe, begreife ich den ersten Prozessor durch technologische Kategorien der aktuell höchstentwickelten. So wie ich die Anatomie der Säugetiere aufgrund meiner eigenen evolutionstheoretisch späteren Anatomie beobachte, sehe ich in einfachen Prozessoren die Andeutungen zu entwickelteren Stufen, weil ich letztere bereits kenne. Evolutionen beschreibe ich rückwärtsblickend.
[0 Kommentar]
Inhalt
Sieben Sünden - Juni 14, 2015
sieben Sünden gibt es in der Kirche des Mittelalters, im Indien M. Gandhis und in der Internetgesellschaft von C. Kappes. Die päpstliche Kirche spricht von Todsünden und meint Hochmut , Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit als Charaktere, die sie selbst hervorragend repräsentiert. M. Gandhi  spricht von sündigen Relationen, die er im seinem Staat verwirklicht sieht: Reichtum ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit, Religion ohne Opferbereitschaft, Politik ohne Prinzipien. C. Kappes variiert Gandhi, indem er seiner guten Gesellschaft (social media) - die als Internetgesellschaft fungiert - anlastet, was Gandhi noch der sozial gemeinten Gesellschaft vorgehalten hatte.
Als Sünde bezeichne ich eine falsche - von der Lehre abweichende - Lebensweise. Sünden zu benennen bedeutet in dieser Hinsicht, das richtige Leben durch dessen Negation zu beschreiben. Mit dem Wort "sozial" unterscheide ich im Kontext der Sünde das richtige Leben in der Perspektive einer moralischen Instanz. Im Kontext von sogenannten Medien bezeichne ich die Lehre als "social", gemäss welcher die moralische Instanz in der Kommunikation im Medium aufgehoben ist.
Dieseits der Sünden war ursprünglich das Gebot. Und anstelle der sieben Sünden, die die Charaktermaske des Kapitalisten beschreiben, steht das Gebot: "Du wirst keinen Lohn geben".
Das Mittelalter kannte den Lohn noch nicht, M. Gandhi hat noch Lohn gegeben und die sogenannte social-media-Gesellschaft besteht zum grossen Teil aus Lohnnehmern, die lieber von Arbeitnehmern sprechen, weil sich die Lohngeber ja auch nicht so bezeichnen.
spricht von sündigen Relationen, die er im seinem Staat verwirklicht sieht: Reichtum ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit, Religion ohne Opferbereitschaft, Politik ohne Prinzipien. C. Kappes variiert Gandhi, indem er seiner guten Gesellschaft (social media) - die als Internetgesellschaft fungiert - anlastet, was Gandhi noch der sozial gemeinten Gesellschaft vorgehalten hatte.
Als Sünde bezeichne ich eine falsche - von der Lehre abweichende - Lebensweise. Sünden zu benennen bedeutet in dieser Hinsicht, das richtige Leben durch dessen Negation zu beschreiben. Mit dem Wort "sozial" unterscheide ich im Kontext der Sünde das richtige Leben in der Perspektive einer moralischen Instanz. Im Kontext von sogenannten Medien bezeichne ich die Lehre als "social", gemäss welcher die moralische Instanz in der Kommunikation im Medium aufgehoben ist.
Dieseits der Sünden war ursprünglich das Gebot. Und anstelle der sieben Sünden, die die Charaktermaske des Kapitalisten beschreiben, steht das Gebot: "Du wirst keinen Lohn geben".
Das Mittelalter kannte den Lohn noch nicht, M. Gandhi hat noch Lohn gegeben und die sogenannte social-media-Gesellschaft besteht zum grossen Teil aus Lohnnehmern, die lieber von Arbeitnehmern sprechen, weil sich die Lohngeber ja auch nicht so bezeichnen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Die analoge Uhr - Juni 11, 2015
Weil D. Baecker gerade wieder den tausendfach zitierten Commonnonsense postuliert, wonach das Stichwort der Digitalisierung der Gesellschaft in aller Munde ist und jeder wisse, was darunter zu verstehen ist, sich dann aber doch fragt, was das Analoge wäre: Ich habe eine "analoge" Uhr.
Die analoge Uhr ist das Paradebeispiel, wenn der Ausdruck "analog" umgangssprachlich erläutert werden soll. Häufig wird versucht, "analog" begreifbar zu machen, indem die Beziehung zwischen Uhrzeit und Zifferblatt (der sogenannten analogen Uhr) als analog bezeichnet wird. Wer scharfsinnig ein Zifferblatt für zu statisch findet, um mit etwas so dynamischem wie Uhrzeit in Analogie gesetzt zu werden, ver(schlimm)bessert das Beispiel, indem er die dynamische Uhrzeit als analog zum sich dynamisch verändernden Winkel zwischen den Uhrzeigern postuliert. Davon abgesehen, dass Beispiele Definitionen ohnehin nicht ersetzen, ist das Beispiel Uhr höchstens dazu tauglich, zu zeigen, dass analog nicht, oder nur äusserst bedingt kontinuierlich heissen kann, weil der Sekundenzeiger, wie man bei jeder analogen Bahnhof-Uhr sehen kann, regelmässig jeweils 1 Sekunde lang stehen bleibt. Wo also liegt die mit der Uhr gemeinte Analogie wirklich?
Die Uhr ist - sehr formal - eine analoge Abbildung des näheren Weltraumes, in 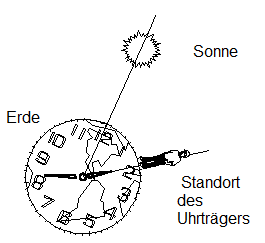 welchem die rotierende Erde um die Sonne rotiert. Der kleine Zeiger zeigt - mit proportionalem Mass - dynamisch, wo er auf der Erde relativ zur Erd-Sonnen-Achse, welche durch die Achse Uhrmitte-(12-Uhr-Zeichen) symbolisiert ist, steht. Der grosse Zeiger zeigt lediglich genauer an, wo der kleine steht. Die Uhr repräsentiert die gemeinte Wirklichkeit sowohl statisch wie dynamisch, aber die gemeinte Wirklichkeit, also die in der Uhr quasi abgebildete Sache, ist eben keineswegs die Zeit. Die Zeit lässt sich nämlich nicht abbilden. Dem Zifferblatt entspricht vielmehr der Raum der Gestirne, den Zeigerbewegungen die Bewegung der Gestirne.
Die Sache mit der Uhr ist ganz einfach: Die analoge Uhr ist keine Abbildung der Zeit, sondern eine Abbildung der Erdbewegung. Der Stundenzeiger zeigt uns, wo wir auf der Erdoberfläche relativ zur Achse Erde-Sonne stehen. Das hat mit Zeit gar nichts zu tun, sondern ist ein ganz räumliches Verhältnis. (darüber haben Sie ja kürzlich auch geschrieben).
Die analoge Uhr wird in der Tat oft digital gelesen, weil sie Zahlen oft auf dem Zifferblatt hat. Der naive Leser meint dann, der Zeiger zeige auf die Zahlen. Der Zeiger zeigt aber, wo auf der Erde wir stehen und die Zahl auf den Zifferblatt (die nicht mehr oder weniger, sondern digital ist) dient nur dazu, dass man einem andern sagen kann, wo der Zeiger gerade steht. Die Zahlen auf der Uhr dienen der sprachlichen Kommunikation über die Zeigerstellung. Um die Tages-Zeit (die ja auch etwas ganz anderes ist als Zeit (oder Sinnzeit) abzulesen, genügen die Zeiger und die Achsenmarkierung (wo ist Mittag bei der Uhr).
Nachdem die analoge Uhr digital gelesen wird, kann man sagen es ist 5 Uhr. Die 5 muss aber per digit vereinbart sein. Und wenn man die 5 vereinbart hat, kann man die Uhr so bauen, dass anstelle der Zeiger die 5 erscheint (eben die sogenannte digitale Uhr). (Nur nebenbei: ob sich der Zeiger der analogen Uhr kontinuierlich oder in diskreten Sprüngen bewegt, ist eine Frage der Auflösung - quantenmechanisch ist kontinuierlich unwahrscheinlich.
welchem die rotierende Erde um die Sonne rotiert. Der kleine Zeiger zeigt - mit proportionalem Mass - dynamisch, wo er auf der Erde relativ zur Erd-Sonnen-Achse, welche durch die Achse Uhrmitte-(12-Uhr-Zeichen) symbolisiert ist, steht. Der grosse Zeiger zeigt lediglich genauer an, wo der kleine steht. Die Uhr repräsentiert die gemeinte Wirklichkeit sowohl statisch wie dynamisch, aber die gemeinte Wirklichkeit, also die in der Uhr quasi abgebildete Sache, ist eben keineswegs die Zeit. Die Zeit lässt sich nämlich nicht abbilden. Dem Zifferblatt entspricht vielmehr der Raum der Gestirne, den Zeigerbewegungen die Bewegung der Gestirne.
Die Sache mit der Uhr ist ganz einfach: Die analoge Uhr ist keine Abbildung der Zeit, sondern eine Abbildung der Erdbewegung. Der Stundenzeiger zeigt uns, wo wir auf der Erdoberfläche relativ zur Achse Erde-Sonne stehen. Das hat mit Zeit gar nichts zu tun, sondern ist ein ganz räumliches Verhältnis. (darüber haben Sie ja kürzlich auch geschrieben).
Die analoge Uhr wird in der Tat oft digital gelesen, weil sie Zahlen oft auf dem Zifferblatt hat. Der naive Leser meint dann, der Zeiger zeige auf die Zahlen. Der Zeiger zeigt aber, wo auf der Erde wir stehen und die Zahl auf den Zifferblatt (die nicht mehr oder weniger, sondern digital ist) dient nur dazu, dass man einem andern sagen kann, wo der Zeiger gerade steht. Die Zahlen auf der Uhr dienen der sprachlichen Kommunikation über die Zeigerstellung. Um die Tages-Zeit (die ja auch etwas ganz anderes ist als Zeit (oder Sinnzeit) abzulesen, genügen die Zeiger und die Achsenmarkierung (wo ist Mittag bei der Uhr).
Nachdem die analoge Uhr digital gelesen wird, kann man sagen es ist 5 Uhr. Die 5 muss aber per digit vereinbart sein. Und wenn man die 5 vereinbart hat, kann man die Uhr so bauen, dass anstelle der Zeiger die 5 erscheint (eben die sogenannte digitale Uhr). (Nur nebenbei: ob sich der Zeiger der analogen Uhr kontinuierlich oder in diskreten Sprüngen bewegt, ist eine Frage der Auflösung - quantenmechanisch ist kontinuierlich unwahrscheinlich.
[0 Kommentar]
Inhalt
Gefundenwerden-Maschinen (SEO) - Juni 10, 2015
Im WWW sind Suchmaschinen auch "Gefundenwerden-Maschinen", weshalb sie in der Werbung eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Ich kann die Web-Seiten so "optimieren", dass sie von den Suchmaschinen als wichtig erkannt und weit oben in den Listen aufgeführt werden. Diese Optimierung ist unter dem Stichwort SEO ein eigenständiges Geschäftsfeld geworden, worin der Ausdruck Suchmaschinenoptimierung nicht die Optimierung der Suchmaschinen bezeichnet, sondern die Optimierung von Web-Sites bezüglich deren Ranking bei Suchmaschinen.
PS: Die Suchmaschinen werden natürlich auch laufend optimiert. Google macht  aber ein Betriebsgeheimnis daraus, was zu vielen Spekulationen über die verwendeten Verfahren führt. Aber das ist einen andere Geschichte ..
aber ein Betriebsgeheimnis daraus, was zu vielen Spekulationen über die verwendeten Verfahren führt. Aber das ist einen andere Geschichte ..
[0 Kommentar]
Inhalt
Buch, Text und Hypertext - Mai 28, 2015
M. McLuhan hat mit seinem 1962 erschienenen Buch The Gutenberg Galaxy auf einem eigenartigen Commonsense aufgebaut, in welchem das massenhafte Buch eine unerhörte, galaktische Rolle spielt, die M. McLuhan und sein Gefolge im Erscheinen des Computers aufgehoben sehen.
Als "Buch" - wie massenhaft auch immer - bezeichne ich eine bestimmte historische Form eines Textträgers aus gebundenem Papier, die quasi das sogenannte Mittelalter begründet, das auf Bücher bezogen zunächst als
Reformation und später als Renaissance ideologisiert wurde. Im 18. Jahrhundert gab es noch sehr wenig Menschen, die Bücher lesen konnten, und im 19. Jahrhundert gab es immer noch keine Massen, die Bücher gelesen haben. Text
und Schrift dagegen gibt es tautologischerweise seit es Menschen gibt, und Bücher, die zunächst Pergamentrollen waren, gibt es, soweit die nicht ganz verklärte Menschengeschichte zurückreicht.
Das Massenbuch, das Gutenberg zugedichtet wird, verbreitet Text, wie die Kinotechnik Bilder und das Radio Lautfolgen verbreitet. Das einzelne Buch hat eine massive Begrenzung, es kann nur begrenzten Textmengen enthalten.
Damit verbunden hat das Buch ein massenhaftes Normalempfinden dafür begründet, dass und wie Text begrenzt sein sollte.
Der Computer hat als Textträger das Buch in einem evolutionstheoretischen Sinn abgelöst. Das heisst, es gibt neben dem Computer weiterhin Bücher, wie es neben den Menschen auch weiterhin Affen gibt. In plausiblen biologischen Evolutionsgeschichten - wie sie etwa K. Holzkamp erzählt - waren die ersten Menschen unter den Primaten eine Randerscheinung, die wie etwa die Neandertaler auch dann und wann wieder ganz verschwunden sind. Als dominante Form des Textträgers setz(t)en sich Computer gegenüber bedruckten Textträgern im evolutionären Prozess allmählich durch, auch weil sie die spezifische Begrenzung von Büchern nicht haben. Zunächst gab es auch auf den Computern vor allem hergebrachte Texte und mithin im hergebrachten Empfinden auch "Bücher", wobei die eigentliche Buchproduktion noch lange Zeit dominant war, so dass das "Buch" jetzt nurmehr als Textmengenart weiterhin bestehen blieb. Man spricht deshalb auch von e-books.
Computer sprengen Text, sie machen Hypertext möglich. Durch das WWW wurde - wenn dort auch nicht in einem dominanten Sinn - Hypertext massenhaft. Hypertext erzeugt ein neues Verständnis von Textmengen und Textgrenzen, das WWW erscheint unendlich. Hypertext invertiert aber auch die Textproduktion. Wenn ich im Hypertext lese, stelle ich den Text, den ich - übrigens entgegen einer oft gehörten Meinung linear - lese, selbst her. Wenn ich Hypertext schreibe, produziere ich Textbausteine, also eine Art Hyper-Vokabular, mittels dessen ich als Hyperleser meine Texte quasi schreibe, indem ich sie zusammenstelle, wie ich beim konventionellen Schreiben Wörter zusammenstelle.
Ich schreibe auch mit dem Computer und auf dem Computer zur allmählichen Verfertigung meiner Gedanken, die ich innerhalb eines gemeinten Themas ordne. So passen meine Texte zu meiner Vorstellung von mehr oder weniger
langen Büchern, gerade weil ich in eigentlichen Büchern diesen spezifischen Sinn erkenne. Der im WWW eingebundene Computer erlaubt mir, mein Schreiben anderen zugänglich zu machen, bevor meine Gedanken verfestigt sind. So kann ich während des Schreibens auf Einwände oder Anregungen reagieren.
Der Computer macht es mir möglich aus meinen Texten nachträglich Hypertext-Bausteine zu machen. Im WWW wird eine Kollaboration möglich, bei welcher andere meine Texte nicht nur kommentieren, sondern sie um Hypertextteile erweitern oder sie sogar überschreiben. Ich bezeichne das als Renaissance der ursprünglichen Bibliothek, die so wenig ein Büchergestell war, wie die Disothek ein Schallplattenständer ist. Die Bibliothek, von der ich spreche, ist der Ort, wo Texte und deren Organisation diskursiv und kollaborativ entwickelt werden. Diese Bibliothek ist der Ort des schriftlichen Dialoges.
PS: alles etwas ausführlicher in Schrift-Sprache - das wird ein Buch
auf Einwände oder Anregungen reagieren.
Der Computer macht es mir möglich aus meinen Texten nachträglich Hypertext-Bausteine zu machen. Im WWW wird eine Kollaboration möglich, bei welcher andere meine Texte nicht nur kommentieren, sondern sie um Hypertextteile erweitern oder sie sogar überschreiben. Ich bezeichne das als Renaissance der ursprünglichen Bibliothek, die so wenig ein Büchergestell war, wie die Disothek ein Schallplattenständer ist. Die Bibliothek, von der ich spreche, ist der Ort, wo Texte und deren Organisation diskursiv und kollaborativ entwickelt werden. Diese Bibliothek ist der Ort des schriftlichen Dialoges.
PS: alles etwas ausführlicher in Schrift-Sprache - das wird ein Buch
[0 Kommentar]
Inhalt
Surfen (to surf the web) - Mai 7, 2015
Als Surfen bezeichne ich umgangssprachlich oder denglisch das Wellenreiten und metaphorisch das Durchbrowsen des Internets.
Beim Wellenreiten benutze ich das Umschlagen der Wellen auf der  Brandungszone (engl. surf) zum Gleiten auf dem abfallenden Wasser.
Beim Surfen im Internet "gleite ich - in diesem metaphorischen Sinn von einer Webseite zur andern. Die Anekdote sagt, dass die Bibliothekarin Jean Armour Polly den Ausdruck 1992 im Wilson Library Bulletin prägte, weil auf ihrem Mauspad ein Surfer abgebildet war. Das ist eine schöne Erklärung dafür, wie ein Wort in die Sprache aller Menschen kommt.
Die Metapher suggeriert, dass ich Internet von einem Dokument zum andern surfe, aber natürlich surfen allenfalls die Dokumente von einem S”e”rver zum andern und auf Bildschirm. "" ist insofern ein gutes Bild, als ich beim Surfen auf einer Welle - im Idealfall - am Ort bleibe, während sich die Welle - mit mir - durch die Brandung bewegt. Wenn ich im Internet surfe, bleibe ich am Bildschirm und lasse Signale sich durch das Netz bewegen und an meinem Bildschirm im Sinne einer Brandung zu Texten oder Bildern auflaufen.
Brandungszone (engl. surf) zum Gleiten auf dem abfallenden Wasser.
Beim Surfen im Internet "gleite ich - in diesem metaphorischen Sinn von einer Webseite zur andern. Die Anekdote sagt, dass die Bibliothekarin Jean Armour Polly den Ausdruck 1992 im Wilson Library Bulletin prägte, weil auf ihrem Mauspad ein Surfer abgebildet war. Das ist eine schöne Erklärung dafür, wie ein Wort in die Sprache aller Menschen kommt.
Die Metapher suggeriert, dass ich Internet von einem Dokument zum andern surfe, aber natürlich surfen allenfalls die Dokumente von einem S”e”rver zum andern und auf Bildschirm. "" ist insofern ein gutes Bild, als ich beim Surfen auf einer Welle - im Idealfall - am Ort bleibe, während sich die Welle - mit mir - durch die Brandung bewegt. Wenn ich im Internet surfe, bleibe ich am Bildschirm und lasse Signale sich durch das Netz bewegen und an meinem Bildschirm im Sinne einer Brandung zu Texten oder Bildern auflaufen.
PS: Während ich in meinem Blog Schrift-Sprache - das wird eine Buch schreibe, schreibe ich ich auch in meiner Hyperbiliothek, "surfen" ist ein aktuelles Beispiel dafür.
[0 Kommentar]
Inhalt
Hauswirtschaft als Schulfach - Mai 4, 2015
Hauswirtschaft zwischen Handwerk und Wirtschaftlehre
Die als Lehrplan 21 bezeichnete Hauswirtschaft-Diskussion, lässt mich nochmals darüber nachdenken, was ich mit Schule verbinde. Ich unterscheide Bildung und Ausbildung, ersteres schaft Wissen, das Zweite schaft Können. Die Schule verbinde ich mit Bildung, aber die Schule selbst reklamiert ein Schulfach, in welchem das Kochenkönnen gelehrt werden soll. Meine Zeitung schreibt: "... wir wollen nicht, dass die praktischen Fächer zugunsten der Kopflastigkeit noch mehr reduziert werden."
Ich habe bislang - in einer naiv-unbewussten Aussensicht - den Haushaltsunterricht gar nicht zu den Schulfächern gezählt, noch viel weniger als Zeichnen, Singen und Turnen. Dass die Mädchen auch Koch- , Putz- und Strick-Kurse besuchen müssen, rechnete ich einem erweiterten Religionsunterricht zu, der auf ein gesittetes Familienleben (KKK) vorbereiten soll.
Jetzt lese ich, das Kochen (wohl neben dem Flicken) als letztes Handwerk, das in der Schule unterrichtet werde, gesehen werden könnte. Ich schreibe gerade ein Buch über das Schreiben als Handwerk und reflektiere, dass das Schreiben - das ich auch ohne Schule gelernt hätte - das einzig Nützliche ist, was ich in der Schule gelernt habe. Als Knabe wurde mir in der Schule (damals noch) kein Kochen angeboten. Ich kann es trotzdem. Ich habe auch in der Schule statt Kochen das Fach Holz- und Metallbearbeitung besucht. Das war auch so praktisch, dass ich es nie als Schulfach gesehen habe.
Jetzt lese ich, dass "Wissen über Konsum oder Budgetplanung künftig wichtiger sei als Kochen". Das glaube ich mitnichten, aber ich glaube umso mehr, dass die Schule dem Erwerb von Wissen verpflichtet ist, dass also "Haushalt" - wie in der Politik - eine ökonomisch Wirtschaftslehre bezeichnen sollte, die mit Kochen rein gar nicht zu tun hat. Und klar: Das, was beim Schreiben noch als Handwerk aussieht, das Schönschreiben, soll auch endlich abgeschaft werden. Und die Argumente dagegen wiederholen buchstäblich die Argumente gegen das Abschaffen des Kochens (oder umgekehrt). Beim Schreiben aber gibt es Bestrebungen anstelle des Schönschreibens das copy-paste zu lehren, das Kochen-Schulfach könnte in diesem praktischen Sinn, das Bestellen von Kurier-Food oder das Aufwärmen von Fertigpizza unterrichten.
Die Diskussion reflektiert die Diskussion um die Informatik, bei welcher das Handwerk systematisch ausgeblendet wird, wohl weil auf Computern selten gekocht wird. Man könnte aber Informatik und Hauswirtschaft zusammenlegen, weil die Fertigpizza im Internet bestellt werden kann.
darüber nachdenken, was ich mit Schule verbinde. Ich unterscheide Bildung und Ausbildung, ersteres schaft Wissen, das Zweite schaft Können. Die Schule verbinde ich mit Bildung, aber die Schule selbst reklamiert ein Schulfach, in welchem das Kochenkönnen gelehrt werden soll. Meine Zeitung schreibt: "... wir wollen nicht, dass die praktischen Fächer zugunsten der Kopflastigkeit noch mehr reduziert werden."
Ich habe bislang - in einer naiv-unbewussten Aussensicht - den Haushaltsunterricht gar nicht zu den Schulfächern gezählt, noch viel weniger als Zeichnen, Singen und Turnen. Dass die Mädchen auch Koch- , Putz- und Strick-Kurse besuchen müssen, rechnete ich einem erweiterten Religionsunterricht zu, der auf ein gesittetes Familienleben (KKK) vorbereiten soll.
Jetzt lese ich, das Kochen (wohl neben dem Flicken) als letztes Handwerk, das in der Schule unterrichtet werde, gesehen werden könnte. Ich schreibe gerade ein Buch über das Schreiben als Handwerk und reflektiere, dass das Schreiben - das ich auch ohne Schule gelernt hätte - das einzig Nützliche ist, was ich in der Schule gelernt habe. Als Knabe wurde mir in der Schule (damals noch) kein Kochen angeboten. Ich kann es trotzdem. Ich habe auch in der Schule statt Kochen das Fach Holz- und Metallbearbeitung besucht. Das war auch so praktisch, dass ich es nie als Schulfach gesehen habe.
Jetzt lese ich, dass "Wissen über Konsum oder Budgetplanung künftig wichtiger sei als Kochen". Das glaube ich mitnichten, aber ich glaube umso mehr, dass die Schule dem Erwerb von Wissen verpflichtet ist, dass also "Haushalt" - wie in der Politik - eine ökonomisch Wirtschaftslehre bezeichnen sollte, die mit Kochen rein gar nicht zu tun hat. Und klar: Das, was beim Schreiben noch als Handwerk aussieht, das Schönschreiben, soll auch endlich abgeschaft werden. Und die Argumente dagegen wiederholen buchstäblich die Argumente gegen das Abschaffen des Kochens (oder umgekehrt). Beim Schreiben aber gibt es Bestrebungen anstelle des Schönschreibens das copy-paste zu lehren, das Kochen-Schulfach könnte in diesem praktischen Sinn, das Bestellen von Kurier-Food oder das Aufwärmen von Fertigpizza unterrichten.
Die Diskussion reflektiert die Diskussion um die Informatik, bei welcher das Handwerk systematisch ausgeblendet wird, wohl weil auf Computern selten gekocht wird. Man könnte aber Informatik und Hauswirtschaft zusammenlegen, weil die Fertigpizza im Internet bestellt werden kann.
[0 Kommentar]
Inhalt
Motive der Migrationsflüchtlinge - April 21, 2015
Ein Esel überredete einen zum Tod verurteilten Hahn zu einer gemeinsamen Flucht mit  Hund und Katze nach Bremen. Bekannterweise erreichten die tierischen Flüchtlinge Bremen nie, aber nicht, weil sie unterwegs verhungert oder gekentert wären, sondern weil sie sich schon unterwegs in einem reich gefüllten Haus niedergelassen haben, aus welchem sie die Räuber, die dort lebten, vertrieben haben.
Als Märchen wird die Geschichte gemeinhin mit Zuckerbrot und Peitsche erzählt. So soll der Esel gesagt haben, dass sie in Bremen als Stadtmusikanten ein gutes Leben führen könnten, er soll aber - seine Musikantengeschichte selbst nicht recht glaubend - dem Hahn auch gesagt haben: "Etwas Besseres als den Tod findest du überall".
Wenn man mir versprechen würde, ich könnte an einem anderen Ort ein gutes Leben führen, würde ich abwägen, wie viel besser das Leben am anderen Ort sein könnte. Vielleicht würde ich das Risiko und den Aufwand einer Migration auf mich nehmen. Schwer zu sagen. Wenn man mir dazu sagen würde, dass ich alles, was ich besitze, dafür hergeben und eine Reise in einem überfüllten Boot über das Meer in Kauf nehmen müsse, ich glaube nicht, dass ich dann auswandern würde.
Wenn man mir aber begründet sagen würde: "Etwas Besseres als den Tod findest du überall", weil mir zu hause der Tod ganz sicher wäre, dann würde ich vielleicht doch in ein überfülltes Boot steigen und auf Meer hinaus fahren.
Würde ich nun in einem überfüllten Boot ohne Geld und Papiere nach Italien kommen, würde ich vielleicht nochmals darüber nachdenken, ob es wirklich überall besser ist als zu sterben. Ich würde an die vielen Menschen denken, die in ganz Europa unter Bedingungen leben, dass sie den Tod durch Sterbehilfeorganisationen vorziehen oder ganz alleine den Tod wählen. Aber das wäre meine Sache und meine Entscheidung.
Ich würde aber sicher auch darüber nachdenken, wie die Italiener meine Geschichte erzählen würden. Würden sie mich lieber als Wirtschaftsflüchtling beschreiben, der nur ein besseres Leben sucht? Und was würden sie durch diese Erzählweise verdrängen (können).
Hund und Katze nach Bremen. Bekannterweise erreichten die tierischen Flüchtlinge Bremen nie, aber nicht, weil sie unterwegs verhungert oder gekentert wären, sondern weil sie sich schon unterwegs in einem reich gefüllten Haus niedergelassen haben, aus welchem sie die Räuber, die dort lebten, vertrieben haben.
Als Märchen wird die Geschichte gemeinhin mit Zuckerbrot und Peitsche erzählt. So soll der Esel gesagt haben, dass sie in Bremen als Stadtmusikanten ein gutes Leben führen könnten, er soll aber - seine Musikantengeschichte selbst nicht recht glaubend - dem Hahn auch gesagt haben: "Etwas Besseres als den Tod findest du überall".
Wenn man mir versprechen würde, ich könnte an einem anderen Ort ein gutes Leben führen, würde ich abwägen, wie viel besser das Leben am anderen Ort sein könnte. Vielleicht würde ich das Risiko und den Aufwand einer Migration auf mich nehmen. Schwer zu sagen. Wenn man mir dazu sagen würde, dass ich alles, was ich besitze, dafür hergeben und eine Reise in einem überfüllten Boot über das Meer in Kauf nehmen müsse, ich glaube nicht, dass ich dann auswandern würde.
Wenn man mir aber begründet sagen würde: "Etwas Besseres als den Tod findest du überall", weil mir zu hause der Tod ganz sicher wäre, dann würde ich vielleicht doch in ein überfülltes Boot steigen und auf Meer hinaus fahren.
Würde ich nun in einem überfüllten Boot ohne Geld und Papiere nach Italien kommen, würde ich vielleicht nochmals darüber nachdenken, ob es wirklich überall besser ist als zu sterben. Ich würde an die vielen Menschen denken, die in ganz Europa unter Bedingungen leben, dass sie den Tod durch Sterbehilfeorganisationen vorziehen oder ganz alleine den Tod wählen. Aber das wäre meine Sache und meine Entscheidung.
Ich würde aber sicher auch darüber nachdenken, wie die Italiener meine Geschichte erzählen würden. Würden sie mich lieber als Wirtschaftsflüchtling beschreiben, der nur ein besseres Leben sucht? Und was würden sie durch diese Erzählweise verdrängen (können).
[0 Kommentar]
Inhalt
Textproduktion - April 9, 2015
Als Textproduktion bezeichne ich tautologischerweise die Produktion von Text.
In der Alltagsprache hat sich der (un)sinnige Ausdruck "Textverarbeitung" eingebürgert, was ich als Ausdruck einer blanken Begriffslosigkeit zur Textproduktion interpretiere. Davon abgesehen:
Die Textproduktion ist eine Produktion, die ich selbst mit hochentwickelter Technik quasi im Privaten betreibe ohne dass meine Texte zu Waren werden. Mir fällt keine vergleichbare Produktion ein.
Was ich als Produktion bezeichne, folgt einem Zweck und einem Plan, ist Ausdruck davon, dass ich als Produzent etwas Bestimmtes erreichen will. Das, was ich mit Text erreichen will, kann ich unter verschiedenen Gesichtspunkten beobachten. Wenn ich Text produziere, mag ich eine von Menschen interpretierbare Aussage im Kopf haben und etwas mitteilen wollen, ab er sicher will ich zuerst, dass mein Text überhaupt gelesen werden kann. Wenn ich Text herstelle, produziere ich einen materiellen Gegenstand der sinnlich wahrgenommen werden kann und soll.
Wenn ich beispielsweise einen Hammer produziere, produziere ich auch einen Gegenstand mit einem bestimmten Zweck. Auch ein Hammer ist ein Gegenstand, den ich als geformtes Material sehen und sinnvoll verwenden kann. Texte verwende ich wie beispielsweise Signalflaggen oder Verkehrszeichen als Symbole, aber wenn ich ein Symbol herstelle, stelle ich eigentlich den Zeichenkörper her. Ich produziere beispielsweise eine dreidimensionale Graphitstruktur auf einem Papier.
Wenn ich einen Hammer produziere, folgt dessen Form seiner Funktion und meiner eigenen Beschaffenheit, da ich ihn die Hand nehmen können muss. Wenn ich Text produziere, mache ich das in einer Schrift, die mir vorgibt, wie ich die Textartefakte gestalte und in einer Sprache, die mir vorgibt, wie ich die Artefakte anordnen kann. Schrift und Sprache sind aber kein Dinge sondern Teil eines Handlungszusammenhangs. Ich stelle Text her, nicht Schrift oder Sprache.
Die quasi handwerkliche Produktion von Text bezeichne ich als Schreiben, womit ich eine Differenz zwischen schreiben und abschreiben bezeichne. Beim Abschreiben - wie es vor dem Buchdruck etwa in Klöstern gemacht wurde - ist die Herstellung von Text nicht mit irgendwelcher "geistiger" Autorenschaft verbunden, sondern eine Produktion von Artefakten, bei welcher ich Werkzeuge verwenden kann und die deshalb auch mechanisiert und automatisiert werden kann.
er sicher will ich zuerst, dass mein Text überhaupt gelesen werden kann. Wenn ich Text herstelle, produziere ich einen materiellen Gegenstand der sinnlich wahrgenommen werden kann und soll.
Wenn ich beispielsweise einen Hammer produziere, produziere ich auch einen Gegenstand mit einem bestimmten Zweck. Auch ein Hammer ist ein Gegenstand, den ich als geformtes Material sehen und sinnvoll verwenden kann. Texte verwende ich wie beispielsweise Signalflaggen oder Verkehrszeichen als Symbole, aber wenn ich ein Symbol herstelle, stelle ich eigentlich den Zeichenkörper her. Ich produziere beispielsweise eine dreidimensionale Graphitstruktur auf einem Papier.
Wenn ich einen Hammer produziere, folgt dessen Form seiner Funktion und meiner eigenen Beschaffenheit, da ich ihn die Hand nehmen können muss. Wenn ich Text produziere, mache ich das in einer Schrift, die mir vorgibt, wie ich die Textartefakte gestalte und in einer Sprache, die mir vorgibt, wie ich die Artefakte anordnen kann. Schrift und Sprache sind aber kein Dinge sondern Teil eines Handlungszusammenhangs. Ich stelle Text her, nicht Schrift oder Sprache.
Die quasi handwerkliche Produktion von Text bezeichne ich als Schreiben, womit ich eine Differenz zwischen schreiben und abschreiben bezeichne. Beim Abschreiben - wie es vor dem Buchdruck etwa in Klöstern gemacht wurde - ist die Herstellung von Text nicht mit irgendwelcher "geistiger" Autorenschaft verbunden, sondern eine Produktion von Artefakten, bei welcher ich Werkzeuge verwenden kann und die deshalb auch mechanisiert und automatisiert werden kann.
[0 Kommentar]
Inhalt
Verleger und das Verlagswesen - April 1, 2015
Ich wundere mich gerade über eine eigenartige Lücke in meinem Wissen, die ich im Internet nicht schliessen kann. Es gibt Unternehmen, die sich selbst als Verlage bezeichnen, obwohl das Verlagswesen gemeinhin als frühkapitalistisches Ausbeutungssystem übelster Sorte - für Textile und Texte - schlechthin gilt.
In einer etwas derben Analogie gibt es eine politische Partei, die sich als Piraten bezeichnet, obwohl Piraten gemeinhin als Verbrecher gelten, die vor gar nichts zurückschrecken. Die politischen Piraten meinen vielleicht, dass Piraterie unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen nicht nur kein Verbrechen, sondern sogar notwendig sei, das meinen wohl auch viele Terroristen, weil doch einige im Nachhinein zu Helden werden. Ich bin gespannt, wann die erste Partei mit dem Namen expliziten Terroristen antritt, also Terror nicht mehr mit "demokratisch" kaschiert wird.
Aber eigentlich interessiert mich, was heutige Verlage vom Verlagswesen halten. Viellleicht meinen sie, dass unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen das Verlagswesen nicht nur keine Ausbeutung repräsentiere, sondern eine notwendige Form der Warenproduktion darstelle.
PS 1: In der Wikipedia war urspünglich eine positive Verknüpfung zwischen Verlagswesen und Verlag, die aber bald total bereinigt, also ersatz- und kommentarlos gestrichen wurde. Ob das ein heutiger Verleger getan hat, ist nicht ersichtlich.
PS 2: Das Kapital vieler Verleger ist in den letzen Jahren durch das Internet in grosse Bedrängisse geraten. Viele Verleger, namentlich solche von grossen Zeitungen, rufen nach staatlichen Subventionen für ihre Verlagsmodelle, die jetzt als die jetzt "Medienkonzerne" die Demokratie sichern sollen. Es gibt sozusagen wie bei der Piraterie eine neue Deutung des Verlagswesen. Es hat ja auch früher schon gutmütige Piraten gegeben, was J. Deep eindeutig beweist. Vielleicht hat es früher ja auch gutmütige Verleger gegeben ...
Bildquelle Museum.BL
sich selbst als Verlage bezeichnen, obwohl das Verlagswesen gemeinhin als frühkapitalistisches Ausbeutungssystem übelster Sorte - für Textile und Texte - schlechthin gilt.
In einer etwas derben Analogie gibt es eine politische Partei, die sich als Piraten bezeichnet, obwohl Piraten gemeinhin als Verbrecher gelten, die vor gar nichts zurückschrecken. Die politischen Piraten meinen vielleicht, dass Piraterie unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen nicht nur kein Verbrechen, sondern sogar notwendig sei, das meinen wohl auch viele Terroristen, weil doch einige im Nachhinein zu Helden werden. Ich bin gespannt, wann die erste Partei mit dem Namen expliziten Terroristen antritt, also Terror nicht mehr mit "demokratisch" kaschiert wird.
Aber eigentlich interessiert mich, was heutige Verlage vom Verlagswesen halten. Viellleicht meinen sie, dass unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen das Verlagswesen nicht nur keine Ausbeutung repräsentiere, sondern eine notwendige Form der Warenproduktion darstelle.
PS 1: In der Wikipedia war urspünglich eine positive Verknüpfung zwischen Verlagswesen und Verlag, die aber bald total bereinigt, also ersatz- und kommentarlos gestrichen wurde. Ob das ein heutiger Verleger getan hat, ist nicht ersichtlich.
PS 2: Das Kapital vieler Verleger ist in den letzen Jahren durch das Internet in grosse Bedrängisse geraten. Viele Verleger, namentlich solche von grossen Zeitungen, rufen nach staatlichen Subventionen für ihre Verlagsmodelle, die jetzt als die jetzt "Medienkonzerne" die Demokratie sichern sollen. Es gibt sozusagen wie bei der Piraterie eine neue Deutung des Verlagswesen. Es hat ja auch früher schon gutmütige Piraten gegeben, was J. Deep eindeutig beweist. Vielleicht hat es früher ja auch gutmütige Verleger gegeben ...
Bildquelle Museum.BL
[0 Kommentar]
Inhalt
Tele- zu -skop und -graph - März 23, 2015
Ich befasse mich gerade wiedermal mit der Differenz Zeichen und Signal und damit verbunden mit Telekommunikation als industrialisierte Form der Differenz. "Tele" ist ein pseudogriechisches Präfix, das für "fern" steht. Im technischen Kontext wurde "tele" wohl zuerst in der Umgebung von J. Kepler in der Zusammensetzung Teleskop benutzt (nachweisbar als neulateinisches telescopium (seit 1609, bei Kepler 1613) und dann in verschiedenen Sprachen auch für andere analog neugeschaffene Wörter wie Telegraf, Telefon und Television verwendet, die auch für Geräte stehen, die "Ferne überwinden" helfen. In altgriechischen Texten gibt es den Ausdruck "teleskópos" für weit schauend und viele Mythen über "Fern"kommunikation mit Feuern und Rauch.
Unter dem Gesichtspunkt der Signalübermittlung ist das Teleskop - wie ein Hörrohr, das sich auch im 17. Jahrhundert verbreitete - ein Empfa ngsgerät, dem zunächst noch kein Sendegrät gegenüber steht. Während das Hörrohr wohl immer auf sprechende Menschen in der Nähe gerichtet wurde und deshalb nicht Tele-rohr heisst, wurde das Fernrohr auf alles gerichtet, was hinreichend fern war, auch wenn dort kein "Sender" sondern eine Sache gesehen wurde.
Das Teleskop wurde Teil des "Tele"graphen, den C. Chappe zunächst als Tachygraf entwickelt hat. Durch das Teleskop konnten die gut zehn Kilometer auseinanderliegenden Semaphoren gesehen werden, die als Sender von Depeschen fungierten. Zuvor Depesche als Eilbotschaften von Boten überbracht. Die telegrafischen Depeschen wurde dann Telegramm genannt.
J. Reis bezeichnete sein Gerät zur Übertragung von Tönen über elektrische Leitungen 1861 in Anlehnung an den Telegraphen Telephon: Ueber Telephonie durch den galvanischen Strom. Seine eigentliche Erfindung war die Modulation mittels eines Mikrofons, da der Telegraph ja schon existierte.
Dass das Telefon nach dem Telegraphen erfunden wurde, mag allerlei Gründe haben, aber es widerspiegelt auch, dass die Schrift dem Sprechen logisch vorangeht.
ngsgerät, dem zunächst noch kein Sendegrät gegenüber steht. Während das Hörrohr wohl immer auf sprechende Menschen in der Nähe gerichtet wurde und deshalb nicht Tele-rohr heisst, wurde das Fernrohr auf alles gerichtet, was hinreichend fern war, auch wenn dort kein "Sender" sondern eine Sache gesehen wurde.
Das Teleskop wurde Teil des "Tele"graphen, den C. Chappe zunächst als Tachygraf entwickelt hat. Durch das Teleskop konnten die gut zehn Kilometer auseinanderliegenden Semaphoren gesehen werden, die als Sender von Depeschen fungierten. Zuvor Depesche als Eilbotschaften von Boten überbracht. Die telegrafischen Depeschen wurde dann Telegramm genannt.
J. Reis bezeichnete sein Gerät zur Übertragung von Tönen über elektrische Leitungen 1861 in Anlehnung an den Telegraphen Telephon: Ueber Telephonie durch den galvanischen Strom. Seine eigentliche Erfindung war die Modulation mittels eines Mikrofons, da der Telegraph ja schon existierte.
Dass das Telefon nach dem Telegraphen erfunden wurde, mag allerlei Gründe haben, aber es widerspiegelt auch, dass die Schrift dem Sprechen logisch vorangeht.
[0 Kommentar]
Inhalt
Mein Unbehagen in der Lehr-Kultur - März 6, 2015
 Ich habe als Schüler, als Student, als Lehrer und als Dozent sehr lange verschiedene Schulen besucht. In all diesen Jahren plagte mich ein stehtes Unbehagen, das ich durch S. Freud auf Verdrängungen zurückzuführen lernte, ohne dabei zu begreifen, was ich verdrängte. Ich vermutete, dass es etwas mit der Lehre zu tun haben müsse, und die Schule erschien mir nur als Ort, wo die Lehre weitergegeben wird, nicht als der Ort, wo diese Lehre geschaffen wird. Ich habe sehr lange nicht verstanden, worin diese Lehre besteht. Ich glaubte naiverweise auch noch als Dozent an der Hochschule, dass irgendwelche Inhalte die Lehre seien und dass Lehrer als Pädagogen die Lehre nur zugänglich machten.
Ich habe als Schüler, als Student, als Lehrer und als Dozent sehr lange verschiedene Schulen besucht. In all diesen Jahren plagte mich ein stehtes Unbehagen, das ich durch S. Freud auf Verdrängungen zurückzuführen lernte, ohne dabei zu begreifen, was ich verdrängte. Ich vermutete, dass es etwas mit der Lehre zu tun haben müsse, und die Schule erschien mir nur als Ort, wo die Lehre weitergegeben wird, nicht als der Ort, wo diese Lehre geschaffen wird. Ich habe sehr lange nicht verstanden, worin diese Lehre besteht. Ich glaubte naiverweise auch noch als Dozent an der Hochschule, dass irgendwelche Inhalte die Lehre seien und dass Lehrer als Pädagogen die Lehre nur zugänglich machten.
Als ich dann in einem Buch von H. Maturana gelesen habe, dass alles, was gesagt wird, von einem Beobachter gesagt wird, habe ich in einer Art Erleuchtung  erkannt, was ich all die Jahre schon wusste, aber verdrängt habe. Es war bei weitem nicht, die von S. Freud beschworene Sexualität, die ich verdrängte, es war meine eigene Sprache, in welcher ich als ich vorkomme. Ich verdrängte meinen Wunsch über mich und über meine Erkenntnisse zu sprechen. Im Nachhinein kann ich mich an viele Situationen erinnern, wo ich das in der Schule ansatzweise versucht habe, aber die Institution Schule habe ich gerade darin erlebt, meine Erkenntnisse als nicht zur Lehre gehörend zurückzuweisen. Ich lernte früh, meine Sätze nie mit “ich” zu beginnen und das ich möglichst ganz zu vermeiden. Ich lernte , dass in wissenschaftlichen Dokumenten das ich gar nicht vorkommen kann. In der Wikipedia - die jenseits aller Wissenschaft als Konversation geschrieben wird - wird heute noch jede “ich-Formulierung”, die ich eintrage, augenblicklich gelöscht.
erkannt, was ich all die Jahre schon wusste, aber verdrängt habe. Es war bei weitem nicht, die von S. Freud beschworene Sexualität, die ich verdrängte, es war meine eigene Sprache, in welcher ich als ich vorkomme. Ich verdrängte meinen Wunsch über mich und über meine Erkenntnisse zu sprechen. Im Nachhinein kann ich mich an viele Situationen erinnern, wo ich das in der Schule ansatzweise versucht habe, aber die Institution Schule habe ich gerade darin erlebt, meine Erkenntnisse als nicht zur Lehre gehörend zurückzuweisen. Ich lernte früh, meine Sätze nie mit “ich” zu beginnen und das ich möglichst ganz zu vermeiden. Ich lernte , dass in wissenschaftlichen Dokumenten das ich gar nicht vorkommen kann. In der Wikipedia - die jenseits aller Wissenschaft als Konversation geschrieben wird - wird heute noch jede “ich-Formulierung”, die ich eintrage, augenblicklich gelöscht.
Durch das Buch von H. Maturana erkannte ich mich als Subjekt. Als Subjekt bestimme ich, was ich sage, aber meine je gewählte “Sprache” bestimmt, was ich sagen kann. Ich fing an, über meine Sprache nachzudenken und erkannte sofort das Tabu, das in der durchgesetzten Vorstellung besteht, dass ich keine eigene Sprache haben könne, dass die Sprache vor dem Menschen sei und dass jeder Mensch, also auch ich, die Sprache der Gesellschaft sprechen müsse.
Ich merkte, dass ich meine Muttersprache benutzte und keine Ahnung habe, wie ich dazu gekommen bin - ausser eben, dass meine Mutter mit mir gesprochen hat, schon bevor ich antworten konnte. Als ich zum ersten Mal in die Schule ging, konnte ich - so erinnere ich mich jedenfalls - ziemlich gut sprechen. Ich realisierte, dass ich in der Schule eine “Sprache” lernte, in welcher ich mein “ich” verdrängte. Die Schule ist der Ort, wo ich mein “ich” wegtrainiert bekommen habe. Als Schüler musste ich die ich-Losigkeit annehmen, die ich als Dozent weitergegeben habe.
In der Schule wurde ich nicht nur in der “Sprache” unterrichtet, die Lehrer beschrieben mir auch die Welt. Dazu sagten sie Sätze, die mit den Sätzen, die ich im Schreibunterricht schreiben musste, übereinstimmten. Ich schrieb also, obwohl es darum ging, schreiben zu lernen, Sätze darüber, wie die Welt ist und lernte wie sie sprachlich dargestellt wird. Diese Welt erschien mir als gegeben, und was darüber zu sagen ist, wurde mir vorgesagt. Schliesslich habe ich wieder beim libidofeindlichen S. Freud entdeckt, was ich in der Schule - wohl zum Wohle der Kultur - hätte lernen sollen. In einer perversen Inversion des Inhaltes meines Unbehagens hat S. Freud - auch - mein Unbehagen mit drei Kränkungen des gesunden Menschenverstandes erklärt. Als “gesunder Menschenverstand” bezeichnete er dabei, was durch die Lehre überwunden werden soll - was bei mir, wenn auch nicht so nachhaltig wie wohl gewünscht - erreicht wurde. Ich lernte - obwohl ich das heute nur bedingt als lernen bezeichnen würde - dass N. Kopernikus die Erde, auf der er lebte, aus planetdem Zentrum der Welt gezogen hat. Dass C. Darwin die Gestalt, in der er lebte, aus dem Zentrum der Schöpfung zog. Und dass S. Freud das Bewusstsein, in dem er lebte, aus dem Zentrum seines Handelns zog. Wirklich gelernt habe ich erst später, dass die drei Wissenschaftler über je sich selbst gesprochen haben. Der Mensch dieser Wissenschaften ist ein zufälliges Produkt einer zufälligen Evolution an einem zufälligen Ort auf einem Planeten der Sonne der Milchstrasse des Universums, wo er sich un- und unterbewusst, also ganz zufällig verhält. Als Nichts im Nirgendwo, das nur getrieben ist, hätte ich auch keinen Grund, ich zu sagen.
Mein Unbehagen hat damit eine neue Bezeichnung bekommen: Lehrer. Ich erkannte, dass meine Vorstellung, wonach Lehrer etwas für Schüler tun, nicht ohne weiteres dazu passt, dass sie den Schülern das ich abtrainieren. Als Schüler musste ich in die Schule, was schlimm genug war. Als Lehrer musste ich die Schüler nehmen, die mir zugewiesen wurden. Meister wählen ihre Lehrlinge aus und zwar unter solchen, die Lehrlinge werden wollen.
Als Lehrer wurde ich bezahlt und ich hatte einen – mir nicht bewussten – Auftrag, den ich nie von Schülern bekommen hatte. Ich habe aber von den Schülern natürlich auch Aufträge bekommen. Die Schüler verlangten von mir, dass ich sie gut durch ihre Prüfungen schleuse.
Wenn ich als Lehrer etwas für die Schüler mache, habe ich nicht verstanden, was was mein Auftrage ist. Lehrer arbeiten für die Gesellschaft, nicht für einzelne Mitglieder der Gesellschaft. Lehrer erziehen die Schüler, dass sie zu dieser Gesellschaft passen. Die unbehagliche Rationalisierung besteht darin, dass Schüler, denen die Anpassung gelingt, ein einfacheres Leben haben – was ich nicht bestreiten kann.
[0 Kommentar]
Inhalt
Handwerk - März 4, 2015
Als eigentlicher Schreibhandwerker fungiere ich typischerweise noch, wenn ich von Hand einen Liebesbrief schreibe und dabei sowohl die Adress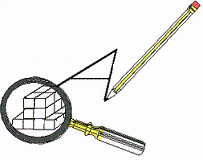 atin und den Zeitpunkt, aber auch die Farbe des Briefpapiers und sowie die Worte, die ich schreibe, nach bestem Wissen wähle und quasi berufsmässig – was heute professionell heisst – gestalte. Von Hand heisst dabei – nicht ganz selbstverständlich – dass ich beispielsweise einen Füllfederhalter verwende, den ich mit meiner Hand über das Papier führe und eben nicht mit dem Finger Tinte
atin und den Zeitpunkt, aber auch die Farbe des Briefpapiers und sowie die Worte, die ich schreibe, nach bestem Wissen wähle und quasi berufsmässig – was heute professionell heisst – gestalte. Von Hand heisst dabei – nicht ganz selbstverständlich – dass ich beispielsweise einen Füllfederhalter verwende, den ich mit meiner Hand über das Papier führe und eben nicht mit dem Finger Tinte
auftrage. Ich bin dann sozusagen Herr über meine Textproduktion, auch wenn ich Papier und Füllfederhalter mit Tinte erworben habe. Um dieses Handwerk auf einem bestimmten Niveau ausführen zu können, musste ich eine entsprechende Lehrzeit durchlaufen und auch danach, quasi als Gesell noch einiges hinzulernen.
Als Handwerker bezeichne ich jemanden, der seinen Körper so im Griff hat, dass er bezüglich der Herstellung seiner Produkte machen kann, was er plant. Das umschliesst, dass ich als Handwerker meine Produkte plane, also auch weiss, wozu ich sie herstelle. Im Falle des Liebesbriefes weiss ich natürlich wenig darüber, wie er von der Adressatin gelesen und interpretiert wird, aber ich habe schreibenderweise den Sinn des Briefes als Plan vor Augen. Und ich stelle meinen Text mit meinem Werkzeug her.
Man mag mir sagen, dass ich nur Wörter aus der Sprache verwenden kann und dass ich in diesem Sinne nicht frei sei. Darin erkenne ich – was Plato schon für jedes Handwerke erkannt hatte – dass ich mich meiner Absicht unterwerfe. Text ist wie jedes Artefakt Gebrauchsbedingungen unterworfen. Philosophen können dann erkennen, das ich eine “Sprache” verwende, die sie als etwas Soziales bezeichnen. Wenn ich als Handwerker schreibe, ist aber vollständig gleichgültig, was sich Philosophen als Sprache ausdenken und wie gesellschaftlich diese Sprache sein soll. Ich stelle ein Produkt her, das seinen Zweck erfüllen kann, 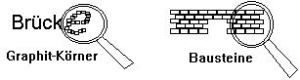 wenn sein Sinn gefragt wird. Wenn ich ein Brücke baue, können die Philosophen mir ihre naturwissenschaftliche Materie zugrunde legen, aber die Brücke baue ich zweckmässig aus Material, gleichgültig, was Physiker dazu sagen.
wenn sein Sinn gefragt wird. Wenn ich ein Brücke baue, können die Philosophen mir ihre naturwissenschaftliche Materie zugrunde legen, aber die Brücke baue ich zweckmässig aus Material, gleichgültig, was Physiker dazu sagen.
Die Auflösung des Handwerkes, die ich hier beschreiben will, passiert durch die Entwicklung der Werkzeuge, die einer gesellschaftlichen Entwicklung der Produktionsverhältnisse unterliegt. Ich erkenne aber eine damit verbundene ideologische Differenz, die ich als implizite Lehre der Schule bezeichnet habe. Diese Differenz erscheint zuerst als Philosofie, die sich später als Wissenschaft selbst legitimiert. Die Philosophen fragen nach den Bedingungen der Möglichkeit. Sie fragen sich beispielsweise, weshalb ich einen Brief schreiben kann und welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen. Das sind recht eigenartige Fragen, nachdem ich das Briefschreiben bereits praktiziere. Wozu sollte ich über die Bedingungen der Möglichkeit nachdenken?
Eigentliches Handwerk wurde beim Meister gelernt, während ich das Schreiben teilweise in der Schule lernen musste, und dort nur selten Meister erkannt habe. Ein Meister nimmt einen Lehrling, wenn der Lehrling in den Augen des Meisters passt. Als Schullehrer im instututionalisierten Sinn bin ich ein Lohnarbeiter, der Schüler zugewiesen bekommt, von welchen ich annehmen muss, dass ein grosser Teil nicht passen, sondern durch Zwang, der Erziehung genannt wird, angepasst werden. Diese Anpassung, die ich als Schüler und als Lehrer mit Unbehagen erlebte, besteht darin, das Handwerk aus dem Bewusstsein zu verdrängen und stattdessen philosphisch-wissenschaftliche Ideologien einzuüben, die den Menschverstand kränken. Dass die Erfindung der Schule mit dem Ende des Handwerkes zusammenfällt, scheint mir kein Zufall zu sein.
[0 Kommentar]
Inhalt
Schreiben - Schrift - Sprache - Februar 25, 2015
ich habe einen neuen Blog gestartet, in welchem ich mich mit Schreiben, Schrift und Sprache befasse:
Schrift-Sprache
Ich beobachte dabei das Schreiben als eigentliches Handwerk.
Ich verwende den Blog dabei etwas untypisch, indem ich an einem zusammenhängenden Text zu einem Thema schreibe, das keine Tagesakutalität hat und kaum Gemüter erregt. Vielleicht kopiere ich gelegentlich Abschnitt in diesen Blog, mal sehen.
[0 Kommentar]
Inhalt
Die Griechenland genannte Deutschland-Krise - Februar 21, 2015
Als Krisen bezeichne ich Situationen, die in Katastrophen münden oder eben nicht. Prototypisch (auch für das Wort in der deutschen Sprache) ist di e Phase, in welcher eine Infektionskrankeit um sich greift oder abklingt. Die Krise selbst – in welcher die Sache noch nicht entschieden ist – wird in einer Art re-entry negativ bewertet, weil ein Risiko eines schlechten Ausgangs beobachtet wird. Von Krise ist nur die Rede, wenn es vielleicht oder sogar vermutlich schlecht wird.
e Phase, in welcher eine Infektionskrankeit um sich greift oder abklingt. Die Krise selbst – in welcher die Sache noch nicht entschieden ist – wird in einer Art re-entry negativ bewertet, weil ein Risiko eines schlechten Ausgangs beobachtet wird. Von Krise ist nur die Rede, wenn es vielleicht oder sogar vermutlich schlecht wird.
Die sogenannte Griechenland-Krise, die auch mit einer sogenannten Euro-Krise verknüpft wird, besteht ganz ganz vordergründig darin, dass der Griechische Staat, wer immer das sei, in der noch nicht bekannten Zukunft seine Schulden nicht “bedient”. Schulden bedienen soll dabei heissen, Kredite zurück bezahlen und Zinsen und Zinseszinsen zu bezahlen.
Nun, die Griechen haben den Kredit schon ausgegeben. Für sie ist der Kredit und natürlich auch die damit verbundenen Zinsen alles andere als eine Krise. Im schlimmsten und im besten Fall bezahlen sie nichts, während in einer Krise ja gerade die beiden Fälle unterschieden werden.
Die Gläubiger der Griechen sind in einer Krise. Stellvertretend für die Gläubiger könnte man den Deutschen Staat bezeichnen, weil er der grösste, aber bei weitem nicht der ärmste Gläubiger ist. Die Deutsche Krise besteht darin, dass die Griechen vielleicht bezahlen oder eben nicht. Für Deutschland könnte die Sache gut oder schlecht ausgehen.
PS: Natürlich können immer viele Krisen beobachtet werden, die Griechen stecken sicher auch in vielen Krisen. Aber die Staatsverschuldung ist ganz sicher keine griechische Krise, wenn Krise Krise heissen soll.
[2 Kommentar]
Inhalt - weiter
 Bewegung gesetzt, bildet eine Maschine”.
Als Nähmaschine bezeichne ich - tautologischerweise - eine Maschine zum Nähen. Meine Nähmaschine hat einen Motor. Aber ist Grossmutters Tret-Nähmaschine (k)eine Maschine?
Zwar ist klar, dass die Tret-Nähmaschine, nur weil sie "Maschine" genannt wird, sowenig eine Maschine sein muss, wie die Erdbeere eine Beere ist. Aber verdrängen lässt sich die Frage, indem man auf den sprachlich-ausdrücklichen Aspekt des Einwandes verweist, nicht. Die Tret-Nähmaschine verweist auf ein tieferliegendes Problem. Definitionen implizieren durch ihre Begriffsbäume Verwandtschafts-oder Entwicklungstheorien. Zu unserer Einteilung der Tierwelt beispielsweise gehören implizite Evolutionstheorien. Die unterstellten Verwandtschaften können falsch oder bedingungsmässig unvollständig sein, wobei "falsch" hier weder logisch noch letztlich, sondern umgangssprachlich gemeint ist. Definitionen und die in ihnen steckenden "Theorien" sind umgangssprachlich falsch, wenn sie am praktischen Anliegen scheitern. Ein Wal ist in diesem Sinne kein Fisch, weil er nicht in einem unmittelbar über dem Wasser gedeckten Aquarium gehalten werden kann. In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr, dass es Theorien gibt, deren Gegenstände sich "bewusst" gegen die Theorie verhalten können. Naturwissenschaftliche Gegenstände haben kein Eigenleben, die Erde muss sich drehen, ein Magnet muss Strom induzieren, wenn er unter bestimmten Bedingungen steht. Es geht nicht darum, dass sich die letzten Gegenstände der Naturwissenschaften der Bestimmbarkeit auch entziehen, oder darum, dass konkrete Wissenschaft immer durch noch gründlichere Erkenntnis ersetzt wird. Hier geht es um die wissenschaftlichen Gegenstände selbst. Naturwissenschaften definieren sich über Gegenstände, die keinen Willen haben.
Sozialwissenschaftliche Theorien dagegen-davonabgesehen, dass sie in einem unmittelbaren Sinne falsch sein können - leiden immer auch darunter, dass sie einen Gegenstand haben, den die Menschen bewusst verändern können. Wenn wir also von Menschen hergestellte Gegenstände klassifizieren, können wir nicht verhindern, dass Menschen die postulierte Ordnung - begründet - brechen.
Die Tret-Nähmaschine ist eine ,Maschine‘, der die ,vernünftige‘ Energieversorgung fehlt. Sie ist eine typisch anachronistische Ingenieursleistung: Ein Werkzeug, das die Entwicklungsstufe der Maschine hat, aber - energiemässig - keine ist. Die Erfinder(ingenieure), die im Falle der ersten Nähmaschinen mehr technische Pioniere als Ingenieure waren, widersetzten sich unserer Definition nach dem Gebot der Praxis. Die Praxis (hier wohl der Markt) verlangte nach einem Werkzeug, das die relativ einfache, aber (für Handwerkerinnen) komplizierte Nähbewegung ersetzte, aber nicht zu teuer war. Was "teuer" damals geheissen hat, zeigen heute weniger die vollautomatischen Billigst-Nähmaschinen, als die fehlende Strominfrastruktur in den Entwicklungsländern. Die Tret-Nähmaschine erfüllt bestimmte Gebote des praktischen Lebens. Wer etwa, um Wasser zu schöpfen, einen lebenden Ochsen an den Ziehbrunnen spannt, macht dies wohl eher, weil er kein vernünftigeres Werkzeug, als weil er etwas gegen unsere Definition hat. Gleichwohl hat er, oder vielmehr macht er etwas gegen die Definition. Der Ochse am Ziehbrunnen ist dem Ochsenbesitzer, was der Sklave seinem Feudalherrn und was unser Schmidt seinem Taylor. Alle überbrücken eine vor-zeitige Idee. Sie stehen für antizipierte Werkzeuge, die noch nicht entwickelt sind. So gesehen verfolgen die Ingenieure eine antizipierte Wirklichkeit, sie ,ent-wickeln‘, packen aus oder entfalten, was dem Werkzeug immer schon innewohnt. Ingenieure entwickeln das Werkzeug im besten Sinne des Wortes. Sie entwickeln, wenn man so will, die Menschen aus ihrer viehischen Not, andere Lebewesen, insbesondere andere Menschen als Werkzeuge zu missbrauchen"
Bewegung gesetzt, bildet eine Maschine”.
Als Nähmaschine bezeichne ich - tautologischerweise - eine Maschine zum Nähen. Meine Nähmaschine hat einen Motor. Aber ist Grossmutters Tret-Nähmaschine (k)eine Maschine?
Zwar ist klar, dass die Tret-Nähmaschine, nur weil sie "Maschine" genannt wird, sowenig eine Maschine sein muss, wie die Erdbeere eine Beere ist. Aber verdrängen lässt sich die Frage, indem man auf den sprachlich-ausdrücklichen Aspekt des Einwandes verweist, nicht. Die Tret-Nähmaschine verweist auf ein tieferliegendes Problem. Definitionen implizieren durch ihre Begriffsbäume Verwandtschafts-oder Entwicklungstheorien. Zu unserer Einteilung der Tierwelt beispielsweise gehören implizite Evolutionstheorien. Die unterstellten Verwandtschaften können falsch oder bedingungsmässig unvollständig sein, wobei "falsch" hier weder logisch noch letztlich, sondern umgangssprachlich gemeint ist. Definitionen und die in ihnen steckenden "Theorien" sind umgangssprachlich falsch, wenn sie am praktischen Anliegen scheitern. Ein Wal ist in diesem Sinne kein Fisch, weil er nicht in einem unmittelbar über dem Wasser gedeckten Aquarium gehalten werden kann. In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr, dass es Theorien gibt, deren Gegenstände sich "bewusst" gegen die Theorie verhalten können. Naturwissenschaftliche Gegenstände haben kein Eigenleben, die Erde muss sich drehen, ein Magnet muss Strom induzieren, wenn er unter bestimmten Bedingungen steht. Es geht nicht darum, dass sich die letzten Gegenstände der Naturwissenschaften der Bestimmbarkeit auch entziehen, oder darum, dass konkrete Wissenschaft immer durch noch gründlichere Erkenntnis ersetzt wird. Hier geht es um die wissenschaftlichen Gegenstände selbst. Naturwissenschaften definieren sich über Gegenstände, die keinen Willen haben.
Sozialwissenschaftliche Theorien dagegen-davonabgesehen, dass sie in einem unmittelbaren Sinne falsch sein können - leiden immer auch darunter, dass sie einen Gegenstand haben, den die Menschen bewusst verändern können. Wenn wir also von Menschen hergestellte Gegenstände klassifizieren, können wir nicht verhindern, dass Menschen die postulierte Ordnung - begründet - brechen.
Die Tret-Nähmaschine ist eine ,Maschine‘, der die ,vernünftige‘ Energieversorgung fehlt. Sie ist eine typisch anachronistische Ingenieursleistung: Ein Werkzeug, das die Entwicklungsstufe der Maschine hat, aber - energiemässig - keine ist. Die Erfinder(ingenieure), die im Falle der ersten Nähmaschinen mehr technische Pioniere als Ingenieure waren, widersetzten sich unserer Definition nach dem Gebot der Praxis. Die Praxis (hier wohl der Markt) verlangte nach einem Werkzeug, das die relativ einfache, aber (für Handwerkerinnen) komplizierte Nähbewegung ersetzte, aber nicht zu teuer war. Was "teuer" damals geheissen hat, zeigen heute weniger die vollautomatischen Billigst-Nähmaschinen, als die fehlende Strominfrastruktur in den Entwicklungsländern. Die Tret-Nähmaschine erfüllt bestimmte Gebote des praktischen Lebens. Wer etwa, um Wasser zu schöpfen, einen lebenden Ochsen an den Ziehbrunnen spannt, macht dies wohl eher, weil er kein vernünftigeres Werkzeug, als weil er etwas gegen unsere Definition hat. Gleichwohl hat er, oder vielmehr macht er etwas gegen die Definition. Der Ochse am Ziehbrunnen ist dem Ochsenbesitzer, was der Sklave seinem Feudalherrn und was unser Schmidt seinem Taylor. Alle überbrücken eine vor-zeitige Idee. Sie stehen für antizipierte Werkzeuge, die noch nicht entwickelt sind. So gesehen verfolgen die Ingenieure eine antizipierte Wirklichkeit, sie ,ent-wickeln‘, packen aus oder entfalten, was dem Werkzeug immer schon innewohnt. Ingenieure entwickeln das Werkzeug im besten Sinne des Wortes. Sie entwickeln, wenn man so will, die Menschen aus ihrer viehischen Not, andere Lebewesen, insbesondere andere Menschen als Werkzeuge zu missbrauchen" e jemand erzählt, dass er einen Hund gesehen hat, dann könnte er mir stattdessen auch erzählen, das er einen Pudel oder ein Tier gesehen hat. Diese Unterscheidung beziehe ich nicht darauf, was er gesehen hat, sondern auf die Beschreibung von dem, was er gesehen hat. Seine Wahrnehmung ist dafür unerheblich, ich höre ja nur, was gesagt, also beobachtet wird.
Ich unterscheide "Hund" und "Tier" als verschiedene Beobachtungen. Wenn ich selbst etwas wahrnehme, was ich als Hund oder als Tier bezeichnen kann, muss ich mich für eine der Beobachtungen entscheiden. Wann also sage ich - im gegebenen Fall - Hund und wann sage ich Tier? Das ist nicht vom Wahrnehmungsgegenstand abhängig, sondern davon, worüber ich sprechen will.
Von Tieren spreche ich etwa, wenn ich die Sonderstellung des Menschen hervorheben will, während ich von Hunden spreche, wenn ich bestimmte Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren beobachte. Der Unterschied,
den ich zwischen Hund und Tier mache, zeigt sich begrifflich, also wenn ich diese Begriffe durch
e jemand erzählt, dass er einen Hund gesehen hat, dann könnte er mir stattdessen auch erzählen, das er einen Pudel oder ein Tier gesehen hat. Diese Unterscheidung beziehe ich nicht darauf, was er gesehen hat, sondern auf die Beschreibung von dem, was er gesehen hat. Seine Wahrnehmung ist dafür unerheblich, ich höre ja nur, was gesagt, also beobachtet wird.
Ich unterscheide "Hund" und "Tier" als verschiedene Beobachtungen. Wenn ich selbst etwas wahrnehme, was ich als Hund oder als Tier bezeichnen kann, muss ich mich für eine der Beobachtungen entscheiden. Wann also sage ich - im gegebenen Fall - Hund und wann sage ich Tier? Das ist nicht vom Wahrnehmungsgegenstand abhängig, sondern davon, worüber ich sprechen will.
Von Tieren spreche ich etwa, wenn ich die Sonderstellung des Menschen hervorheben will, während ich von Hunden spreche, wenn ich bestimmte Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren beobachte. Der Unterschied,
den ich zwischen Hund und Tier mache, zeigt sich begrifflich, also wenn ich diese Begriffe durch 
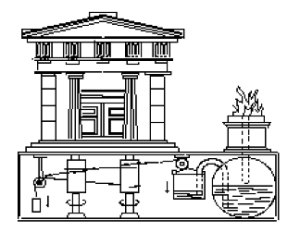 ch eigentlich, dass ich seine Erfindung nicht oder eben nur im Prinzip in Betracht ziehe, weil sie - im Prinzip - keine relevanten Beitrag zur aktuellen Technik darstellt. Welche Beiträge ich für relevant halte, ist von einem Kriterium abhängig, das mir aber auch keineswegs bewusst sein muss. In vielen gängigen Geschichten wird J. Watt als Erfinder der Dampfmaschine genannt, weil seine Dampfmaschine als relevant beobachtet wird. In diesen Geschichten wird nicht nur Heron "vergessen".
In Bezug auf die Zeittafel muss ich mich natürlich entscheiden, welche Erfindung ich als "Dampfmaschine" bezeichne und welche eben noch nicht, aber nachdem ich den Gegenstand bestimmt habe, steht fest, wo er in der Geschichte erscheint. Die Dampfmaschine von J. Watt erscheint 1769. Kritisch ist nur, was im erwähnten Fall als Dampfmaschine gelten soll. Das ist aber eine technische, nicht eine historische Frage. Interessanterweise wurde die erste eigentliche Technikgeschichte der Dampfmaschine gewidmet. Sie wurde vom Ingenieur C. Matschoss, also von einem Techniker, nicht von einem Historiker geschrieben.
Die "Geschichte" wird etwas komplizierter, wenn ich die Zeitleiste weglasse. Einerseits mache ich mir damit einfach das Naturwüchsige der Zeittafel bewusst, habe dann andrerseits aber das Problem, wie ich die Ereignisse (anders) auswählen und sortieren soll. Indem ich die Zeitleiste weglasse, wird nicht nur das Sortieren der Ereignisse zu einer neuen Aufgabe, sondern vor allem auch, welche Ereignisse ich wie sortiere. Ich setze Ereignisse, die ich als technisch erachte, in eine Beziehung, was zuvor durch die naturwüchsige Zeitreihe
aufgehoben war.
Ich beobachte die Technik als Resultat einer Entwicklung, in welcher sich mein Verhalten dadurch verändert, dass ich effizientere Verfahren entwickle und verwende. Die alten Griechen haben viele effiziente Verfahren entwickelt, sie aber nicht angewendet. Wenn ich sachliche Entwicklungen oder Differenzierungen von Verfahrensweisen darstelle, impliziere ich natürlich auch "Zeit", weil Entwicklungen tautologischerweise in der Zeit stattfinden. Dabei handelt es sich aber um eine Systemzeit, nicht um historische Zeitpunkte. Damit J. Watt die Dampfmaschine verbessern konnte, musste die Dampfmaschine bereits existieren, aber es spielt für die Verbesserung keine Rolle, wie lange sie schon existierte und wann sie erfunden wurde. Ich beobachte die technische Entwicklung also in diesem historischen Sinn unabhängig von der Zeit.
Ich komme aber natürlich nicht umhin, effiziente Verfahren auszuwählen. Der Ansatz,
ch eigentlich, dass ich seine Erfindung nicht oder eben nur im Prinzip in Betracht ziehe, weil sie - im Prinzip - keine relevanten Beitrag zur aktuellen Technik darstellt. Welche Beiträge ich für relevant halte, ist von einem Kriterium abhängig, das mir aber auch keineswegs bewusst sein muss. In vielen gängigen Geschichten wird J. Watt als Erfinder der Dampfmaschine genannt, weil seine Dampfmaschine als relevant beobachtet wird. In diesen Geschichten wird nicht nur Heron "vergessen".
In Bezug auf die Zeittafel muss ich mich natürlich entscheiden, welche Erfindung ich als "Dampfmaschine" bezeichne und welche eben noch nicht, aber nachdem ich den Gegenstand bestimmt habe, steht fest, wo er in der Geschichte erscheint. Die Dampfmaschine von J. Watt erscheint 1769. Kritisch ist nur, was im erwähnten Fall als Dampfmaschine gelten soll. Das ist aber eine technische, nicht eine historische Frage. Interessanterweise wurde die erste eigentliche Technikgeschichte der Dampfmaschine gewidmet. Sie wurde vom Ingenieur C. Matschoss, also von einem Techniker, nicht von einem Historiker geschrieben.
Die "Geschichte" wird etwas komplizierter, wenn ich die Zeitleiste weglasse. Einerseits mache ich mir damit einfach das Naturwüchsige der Zeittafel bewusst, habe dann andrerseits aber das Problem, wie ich die Ereignisse (anders) auswählen und sortieren soll. Indem ich die Zeitleiste weglasse, wird nicht nur das Sortieren der Ereignisse zu einer neuen Aufgabe, sondern vor allem auch, welche Ereignisse ich wie sortiere. Ich setze Ereignisse, die ich als technisch erachte, in eine Beziehung, was zuvor durch die naturwüchsige Zeitreihe
aufgehoben war.
Ich beobachte die Technik als Resultat einer Entwicklung, in welcher sich mein Verhalten dadurch verändert, dass ich effizientere Verfahren entwickle und verwende. Die alten Griechen haben viele effiziente Verfahren entwickelt, sie aber nicht angewendet. Wenn ich sachliche Entwicklungen oder Differenzierungen von Verfahrensweisen darstelle, impliziere ich natürlich auch "Zeit", weil Entwicklungen tautologischerweise in der Zeit stattfinden. Dabei handelt es sich aber um eine Systemzeit, nicht um historische Zeitpunkte. Damit J. Watt die Dampfmaschine verbessern konnte, musste die Dampfmaschine bereits existieren, aber es spielt für die Verbesserung keine Rolle, wie lange sie schon existierte und wann sie erfunden wurde. Ich beobachte die technische Entwicklung also in diesem historischen Sinn unabhängig von der Zeit.
Ich komme aber natürlich nicht umhin, effiziente Verfahren auszuwählen. Der Ansatz, 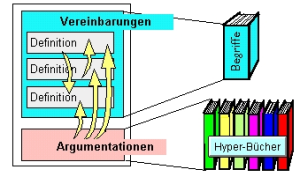
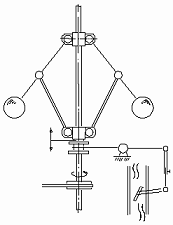 Pflug ziehen. Ein energetisch entwickeltes Werkzeug bezeichne ich als Maschine.
Die sogenannte Dampfmaschine ist keine Maschine, sondern ein Motor. Motoren lassen sich nicht nur für Werkzeuge sondern auch für Geräte verwenden. Und Motoren revolutionieren auch den Anbau und den Bau.
Die Dampfmaschine von Watt gilt gemeinhin als Energieträger, ihr Erfolg beruht aber unter anderem auch darauf, dass sie eine Regelung hat. Geregelte Maschinen bezeichne ich als Automaten. Die Regelung, die Watt verwendet, ist technisch primitiv, weshalb ich von Halbautomaten spreche. Die entwickeltste Regelung erscheint in Prozessoren, die für Computer verwendet werden. Entwickelte Regelungen haben einen eigenen Energiekreis. Die Energie, die der Regelung dient, bezeichne ich als Information.
Auf der entwickelsten Stufe des Werkzeuges wird die Widerspiegelung zum Programm. Im Programm beschreibe ich, was die Maschine oder genauer, was die Steuerung "macht", und die Steuerung macht dann, was sie macht, weil ich sie beschrieben habe.
Die Programmierung beobachte ich als die letzte Stufe der Technik. Beim Programmieren mache ich nur noch Beschreibungen, aber die bekommen ihren Sinn natürlich nur durch die Technik insgesamt. Vorläufig bauen Menschen Getreide an, damit andere Gebäude bauen, in welchen andere Geräte und Werkzeuge herstellen, die ich dann noch programmieren kann.
Pflug ziehen. Ein energetisch entwickeltes Werkzeug bezeichne ich als Maschine.
Die sogenannte Dampfmaschine ist keine Maschine, sondern ein Motor. Motoren lassen sich nicht nur für Werkzeuge sondern auch für Geräte verwenden. Und Motoren revolutionieren auch den Anbau und den Bau.
Die Dampfmaschine von Watt gilt gemeinhin als Energieträger, ihr Erfolg beruht aber unter anderem auch darauf, dass sie eine Regelung hat. Geregelte Maschinen bezeichne ich als Automaten. Die Regelung, die Watt verwendet, ist technisch primitiv, weshalb ich von Halbautomaten spreche. Die entwickeltste Regelung erscheint in Prozessoren, die für Computer verwendet werden. Entwickelte Regelungen haben einen eigenen Energiekreis. Die Energie, die der Regelung dient, bezeichne ich als Information.
Auf der entwickelsten Stufe des Werkzeuges wird die Widerspiegelung zum Programm. Im Programm beschreibe ich, was die Maschine oder genauer, was die Steuerung "macht", und die Steuerung macht dann, was sie macht, weil ich sie beschrieben habe.
Die Programmierung beobachte ich als die letzte Stufe der Technik. Beim Programmieren mache ich nur noch Beschreibungen, aber die bekommen ihren Sinn natürlich nur durch die Technik insgesamt. Vorläufig bauen Menschen Getreide an, damit andere Gebäude bauen, in welchen andere Geräte und Werkzeuge herstellen, die ich dann noch programmieren kann.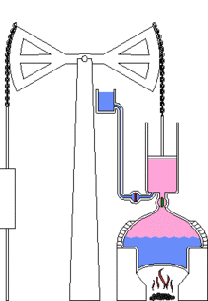
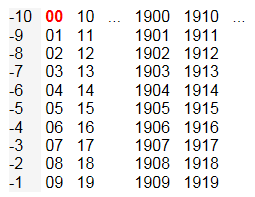 Geburt als Nullpunkt, der als Zeitpunkt mitten in ein Jahr fällt, also wie jede weitere Geburt eines Menschen in den Kalender eingetragen wird, während Christi Geburt - in diesen Kalender - nicht eingetragen werden kann.
In meinen Geschichten verwende ich einen Kalender, in welchem das Jahr Null nicht vorkommt, weil ich das erste Jahr als 1. Jahr bezeichne, und die Jahre davor in einem analogen Sinn zähle.
Die Differenz beruht darauf, ob ich Ereignisse - wie meine Geburt oder jene von Christus - in einen Kalender eintrage, oder einem von mir gezähltem Jahr zurechne. Biographisch zähle ich meine Lebensjahre, indem ich dem ersten Jahr - unabhängig von jedem Kalender - die Ziffer 1 zuordne.
Diese Zählweise verwende ich generell, wenn ich Zeitintervalle vor und nach einem bestimmten Ereigniszeitpunkt zähle. Ich sage etwa, dass der Schnee erst in der letzten Minute vor dem Anpfiff des Spieles weggeräumt werden konnte und dass bereits in der ersten Minute nach dem Anpfiff ein Tor gefallen ist.“ Das Ereignis Spielanfang ist ein Zeitpunkt zwischen zwei Intervallen, dem kein Intervall zugeordnet ist. Im gleichen Sinn ist die Geburt Christi ein Ereignis, das im Kalender keinem Intervall entspricht
Für die Zeitrechnung spielt es natürlich eine Rolle, ob ich ein Jahr weglasse oder nicht, aber umgekehrt haben wir ja auch 300 Jahre wegegelassen und können nur schlecht wissen, wie oft man sich sonst verzählt hat. Für die Geschichte(n) spielt es keine Rolle, weil dort Jahreszahlen nur als Primärschlüssel fungieren, die Reihenfolgen festlegen.
Geburt als Nullpunkt, der als Zeitpunkt mitten in ein Jahr fällt, also wie jede weitere Geburt eines Menschen in den Kalender eingetragen wird, während Christi Geburt - in diesen Kalender - nicht eingetragen werden kann.
In meinen Geschichten verwende ich einen Kalender, in welchem das Jahr Null nicht vorkommt, weil ich das erste Jahr als 1. Jahr bezeichne, und die Jahre davor in einem analogen Sinn zähle.
Die Differenz beruht darauf, ob ich Ereignisse - wie meine Geburt oder jene von Christus - in einen Kalender eintrage, oder einem von mir gezähltem Jahr zurechne. Biographisch zähle ich meine Lebensjahre, indem ich dem ersten Jahr - unabhängig von jedem Kalender - die Ziffer 1 zuordne.
Diese Zählweise verwende ich generell, wenn ich Zeitintervalle vor und nach einem bestimmten Ereigniszeitpunkt zähle. Ich sage etwa, dass der Schnee erst in der letzten Minute vor dem Anpfiff des Spieles weggeräumt werden konnte und dass bereits in der ersten Minute nach dem Anpfiff ein Tor gefallen ist.“ Das Ereignis Spielanfang ist ein Zeitpunkt zwischen zwei Intervallen, dem kein Intervall zugeordnet ist. Im gleichen Sinn ist die Geburt Christi ein Ereignis, das im Kalender keinem Intervall entspricht
Für die Zeitrechnung spielt es natürlich eine Rolle, ob ich ein Jahr weglasse oder nicht, aber umgekehrt haben wir ja auch 300 Jahre wegegelassen und können nur schlecht wissen, wie oft man sich sonst verzählt hat. Für die Geschichte(n) spielt es keine Rolle, weil dort Jahreszahlen nur als Primärschlüssel fungieren, die Reihenfolgen festlegen.
 nde Idioten in ihrer Konfusion immer erzählen, wie sie ihre Worte verwenden. Ich kann mir aber auch ein gewöhnliches wissenschaftliches Stück Literatur vorstellen, bei welchem - wie bei einem easy-rider-Chopper - alles weggeschnitten wurde, was über Definitionen hinausgeht.
Einen Teil dessen, was mit der fehlenden Narration verloren geht, wurden in der Encyclopedia Britannica (1. Auflage 1768–1771) als alternative Darstellungen zur bis dahin üblichen Prosa-Chronik durch sogenannte Zeittafeln ersetzt.
Ich lese Zeittafeln als eine spezielle Form von Erzählungen, sie beruhen auf einer zurückblickenden Auswahl, die überdies oft Kategorien verwendet, die nur in der Rückschau möglich sind. Die Epochenbezeichnung "Renaissance" beispielsweise stammt aus dem 19. Jhd. und meint eine Zeit im 16. Jhd., in welcher die Epoche als solche und auch die vermeintliche Wiedergeburt wohl (noch) nicht erlebt wurde. Wenn ich also die Renaissance in einer Zeittafel der Jahreszahl 1600 zuordne, erzähle ich - mehr oder weniger bewusst - dass um 1900 gesehen wurde, dass um 1500 im damaligen Italien vieles wieder so gesehen wurde wie es 400 vor Christus im damaligen Griechenland gesehen wurde. Das ist ein zeit-typischer Anfang einer Geschichte, in welcher Beobachtungen beobachtet werden (können).
Eine mögliche Beobachtung besteht in einer Inversion: Im 19. Jhd. wurde anhand des Wissens über das 16. Jhd. das 4. Jhd. vor Christus rekonstruiert. Die Kategorien stammen in dieser Perspektive nicht aus dem 16. Jhd. und schon gar nicht aus dem 4. Jhd. vor Christus, sondern sind Projektionen, die ich durch den Epochenbegriff auch heute aktivieren kann - aber nicht muss.
In meinem
nde Idioten in ihrer Konfusion immer erzählen, wie sie ihre Worte verwenden. Ich kann mir aber auch ein gewöhnliches wissenschaftliches Stück Literatur vorstellen, bei welchem - wie bei einem easy-rider-Chopper - alles weggeschnitten wurde, was über Definitionen hinausgeht.
Einen Teil dessen, was mit der fehlenden Narration verloren geht, wurden in der Encyclopedia Britannica (1. Auflage 1768–1771) als alternative Darstellungen zur bis dahin üblichen Prosa-Chronik durch sogenannte Zeittafeln ersetzt.
Ich lese Zeittafeln als eine spezielle Form von Erzählungen, sie beruhen auf einer zurückblickenden Auswahl, die überdies oft Kategorien verwendet, die nur in der Rückschau möglich sind. Die Epochenbezeichnung "Renaissance" beispielsweise stammt aus dem 19. Jhd. und meint eine Zeit im 16. Jhd., in welcher die Epoche als solche und auch die vermeintliche Wiedergeburt wohl (noch) nicht erlebt wurde. Wenn ich also die Renaissance in einer Zeittafel der Jahreszahl 1600 zuordne, erzähle ich - mehr oder weniger bewusst - dass um 1900 gesehen wurde, dass um 1500 im damaligen Italien vieles wieder so gesehen wurde wie es 400 vor Christus im damaligen Griechenland gesehen wurde. Das ist ein zeit-typischer Anfang einer Geschichte, in welcher Beobachtungen beobachtet werden (können).
Eine mögliche Beobachtung besteht in einer Inversion: Im 19. Jhd. wurde anhand des Wissens über das 16. Jhd. das 4. Jhd. vor Christus rekonstruiert. Die Kategorien stammen in dieser Perspektive nicht aus dem 16. Jhd. und schon gar nicht aus dem 4. Jhd. vor Christus, sondern sind Projektionen, die ich durch den Epochenbegriff auch heute aktivieren kann - aber nicht muss.
In meinem 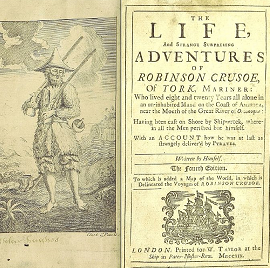 Die namengebende Welt des Robinson Crusoe war eine Insel, auf welcher er als Schiffbrüchiger alleine leben musste. Robinson erzählte, wie er um sein Überleben zu sichern zahlreiche Tätigkeiten wie Ackerbau, Zimmermannshandwerk, Schneidern usw., die mir als gesellschaftliche Kulturtechniken bekannt sind, selbst ausführen musste. Robinson ist allerdings nicht vom Himmer gefallen, er wusste aus seinem vormaligen Leben in der Gesellschaft, wie er seine Welt einrichten musste und er hat auch Werkzeuge, Kleider und Waffen, die er nicht erst erfinden musste. Er wusste insbesondere auch, wie er mit dann doch erscheinenden Menschen umzugehen hatte, was er überdies auf die Moral bezog, die er in seiner Bibel, die er auch nicht selbst geschrieben hat, gefunden hat.
Der Witz der Robinsonade besteht darin, als Individuum zu leben und aus den darin erkannten Bedürfnissen eine Gesellschaftsform herzuleiten.
Ich unterscheide zwei zwei Formen, mit "Robinsonaden" umzugehen:
- ich kann eine Robinsonade erfinden und erzählen oder
- ich kann die Robinsonade als bürgerliche Ideologie kritisieren.
Ersteres hat auch
Die namengebende Welt des Robinson Crusoe war eine Insel, auf welcher er als Schiffbrüchiger alleine leben musste. Robinson erzählte, wie er um sein Überleben zu sichern zahlreiche Tätigkeiten wie Ackerbau, Zimmermannshandwerk, Schneidern usw., die mir als gesellschaftliche Kulturtechniken bekannt sind, selbst ausführen musste. Robinson ist allerdings nicht vom Himmer gefallen, er wusste aus seinem vormaligen Leben in der Gesellschaft, wie er seine Welt einrichten musste und er hat auch Werkzeuge, Kleider und Waffen, die er nicht erst erfinden musste. Er wusste insbesondere auch, wie er mit dann doch erscheinenden Menschen umzugehen hatte, was er überdies auf die Moral bezog, die er in seiner Bibel, die er auch nicht selbst geschrieben hat, gefunden hat.
Der Witz der Robinsonade besteht darin, als Individuum zu leben und aus den darin erkannten Bedürfnissen eine Gesellschaftsform herzuleiten.
Ich unterscheide zwei zwei Formen, mit "Robinsonaden" umzugehen:
- ich kann eine Robinsonade erfinden und erzählen oder
- ich kann die Robinsonade als bürgerliche Ideologie kritisieren.
Ersteres hat auch 

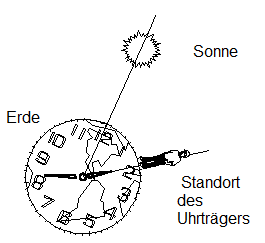


 Brandungszone (engl. surf) zum Gleiten auf dem abfallenden Wasser.
Beim Surfen im Internet "gleite ich - in diesem metaphorischen Sinn von einer Webseite zur andern. Die Anekdote sagt, dass die Bibliothekarin Jean Armour Polly den Ausdruck 1992 im Wilson Library Bulletin prägte, weil auf ihrem Mauspad ein Surfer abgebildet war. Das ist eine schöne Erklärung dafür, wie ein Wort in die Sprache aller Menschen kommt.
Die Metapher suggeriert, dass ich Internet von einem Dokument zum andern surfe, aber natürlich surfen allenfalls die Dokumente von einem S”e”rver zum andern und auf Bildschirm. "" ist insofern ein gutes Bild, als ich beim Surfen auf einer Welle - im Idealfall - am Ort bleibe, während sich die Welle - mit mir - durch die Brandung bewegt. Wenn ich im Internet surfe, bleibe ich am Bildschirm und lasse Signale sich durch das Netz bewegen und an meinem Bildschirm im Sinne einer Brandung zu Texten oder Bildern auflaufen.
Brandungszone (engl. surf) zum Gleiten auf dem abfallenden Wasser.
Beim Surfen im Internet "gleite ich - in diesem metaphorischen Sinn von einer Webseite zur andern. Die Anekdote sagt, dass die Bibliothekarin Jean Armour Polly den Ausdruck 1992 im Wilson Library Bulletin prägte, weil auf ihrem Mauspad ein Surfer abgebildet war. Das ist eine schöne Erklärung dafür, wie ein Wort in die Sprache aller Menschen kommt.
Die Metapher suggeriert, dass ich Internet von einem Dokument zum andern surfe, aber natürlich surfen allenfalls die Dokumente von einem S”e”rver zum andern und auf Bildschirm. "" ist insofern ein gutes Bild, als ich beim Surfen auf einer Welle - im Idealfall - am Ort bleibe, während sich die Welle - mit mir - durch die Brandung bewegt. Wenn ich im Internet surfe, bleibe ich am Bildschirm und lasse Signale sich durch das Netz bewegen und an meinem Bildschirm im Sinne einer Brandung zu Texten oder Bildern auflaufen.



 sich selbst als Verlage bezeichnen, obwohl das Verlagswesen gemeinhin als frühkapitalistisches Ausbeutungssystem übelster Sorte - für
sich selbst als Verlage bezeichnen, obwohl das Verlagswesen gemeinhin als frühkapitalistisches Ausbeutungssystem übelster Sorte - für  ngsgerät, dem zunächst noch kein Sendegrät gegenüber steht. Während das Hörrohr wohl immer auf sprechende Menschen in der Nähe gerichtet wurde und deshalb nicht Tele-rohr heisst, wurde das Fernrohr auf alles gerichtet, was hinreichend fern war, auch wenn dort kein "Sender" sondern eine Sache gesehen wurde.
Das Teleskop wurde Teil des "Tele"graphen, den C. Chappe zunächst als Tachygraf entwickelt hat. Durch das Teleskop konnten die gut zehn Kilometer auseinanderliegenden Semaphoren gesehen werden, die als Sender von Depeschen fungierten. Zuvor Depesche als Eilbotschaften von Boten überbracht. Die telegrafischen Depeschen wurde dann Telegramm genannt.
J. Reis bezeichnete sein Gerät zur Übertragung von Tönen über elektrische Leitungen 1861 in Anlehnung an den Telegraphen Telephon: Ueber Telephonie durch den galvanischen Strom. Seine eigentliche Erfindung war die Modulation mittels eines Mikrofons, da der Telegraph ja schon existierte.
Dass das Telefon nach dem Telegraphen erfunden wurde, mag allerlei Gründe haben, aber es widerspiegelt auch, dass die
ngsgerät, dem zunächst noch kein Sendegrät gegenüber steht. Während das Hörrohr wohl immer auf sprechende Menschen in der Nähe gerichtet wurde und deshalb nicht Tele-rohr heisst, wurde das Fernrohr auf alles gerichtet, was hinreichend fern war, auch wenn dort kein "Sender" sondern eine Sache gesehen wurde.
Das Teleskop wurde Teil des "Tele"graphen, den C. Chappe zunächst als Tachygraf entwickelt hat. Durch das Teleskop konnten die gut zehn Kilometer auseinanderliegenden Semaphoren gesehen werden, die als Sender von Depeschen fungierten. Zuvor Depesche als Eilbotschaften von Boten überbracht. Die telegrafischen Depeschen wurde dann Telegramm genannt.
J. Reis bezeichnete sein Gerät zur Übertragung von Tönen über elektrische Leitungen 1861 in Anlehnung an den Telegraphen Telephon: Ueber Telephonie durch den galvanischen Strom. Seine eigentliche Erfindung war die Modulation mittels eines Mikrofons, da der Telegraph ja schon existierte.
Dass das Telefon nach dem Telegraphen erfunden wurde, mag allerlei Gründe haben, aber es widerspiegelt auch, dass die