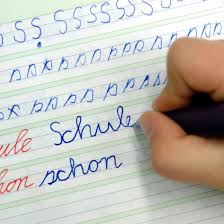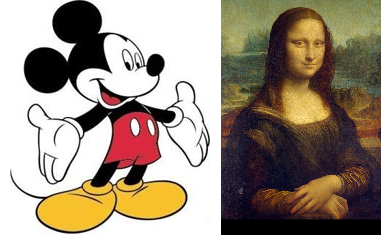Grammatologie-Projekt
[ zurück ]
[ Stichworte ]
[ Die Hyper-Bibliothek ]
[ Systemtheorie ]
[ Meine Bücher ]
![bild]()
|
Als Grammatologie bezeichne ich - halb tautologischerweise - die Lehre von der Grammatik. In meiner Wortverwendung ist Grammatologie eine Tautologie, aber in der Literatur wird der Ausdruck fast durchgehend anders oder für etwas anderes verwendet, sehr oft auf Sprache bezogen, obwohl dann nicht von "Sprachologie" gesprochen wird. J. Derrida spricht in seiner Grammatologie von écriture.
Das Grammatologie-Projekt ist quasi komplementärer Teil des Projektes Schrift-Sprache, das ich im Blog Schrift-Sprache entwickle. Hier wähle ich einen anderen Einstieg, ich beginne mit der Grammatik und deren Voraussetzungen.
|
Projekt-Programm
In diesem Text gehe ich davon aus, dass Sprache vom Himmel gefallen ist, wie die Menschen selbst. Dazu, woher die Menschen kommen, gibt es Geschichten in der Bibel und in den biologischen Evolutionsgeschichten, die aber die Sprache weitgehend verdrängen, obwohl diese Geschichten erzählt werden.
"Im Anfang war das Wort“ sind die ersten Worte des Johannesevangeliums. Faust ersetzt Wort durch Sinn, dann durch Kraft und erkennt schliesslich: Im Anfang war die Tat, weil er keine Ahnung hatte, was Wort, das oft durch Logos ersetzt wird, bedeuten soll.
Menschen tun etwas, was ich als sprechen bezeichne. Als Grammatologie bezeichne ich meine "Logie" darüber, was Menschen beim Sprechen tun. Ich beginne deshalb mit der einfachsten Form des Sprechens, wobei ich insbesondere explizit auch mache, was ich als Sprechen bezeichne [ nochmals schauen: ich glaube das fehlt bei S. Krämer, obwohl sie Sprache und Sprechen unterscheidet, und bei allen Autoren, die sie bespricht, auch weil sie Pragmatik weglässt ]
Noch bevor ich über das Sprechen schreibe, schreibe ich über das Tun, weil ich sprechen als eine Tätigkeit auffasse. Ich setze hier vorerst - wie Faust - voraus, wie ich die Wörter tun und sprechen verwende. Ich schreibe in einem naiven Sinn, was ich beobachte. Ich beobachte Menschen, die etwas tun, und verwende dabei viele Wörter wie meine Mutter, die sie wohl wie ihrer Mutter verwendet. Ich werden später auf meine Art des Beobachtens zurückkommen.
Zur Phänographie der Tätigkeit
Als Phänographie bezeichne ich definitorische Bestimmungen, in welchen nicht die Sache selbst zur Kenntnis gebracht wird, sondern mit welchen als bekannt vorausgesetzten Wörtern die Sache schliesslich behandelt werden soll. Sie dienen in einem noch nicht begrifflichen Sinn der Verdeutlichungen, worum es hier überhaupt gehen soll, und was später durch schärfere Abgrenzungen, Ordnungen und Klassifikationen genauer bestimmt werden soll. Phänographische Auseinanderlegungen gehören zu den definitorischen Bemühungen in einem weiteren Sinn, es geht also nicht, wie in eigentlichen Definitionen, um möglichst präzise Bestimmungen des genus proximum und der differentia specifica zu Klassifikationszwecken, sondern zunächst nur um Heraushebungen relevanter Züge dessen, wovon die Rede sein soll, wobei sich aber erste Abgrenzungen zwangsläufig mitergeben. Das phänographische Verfahren hat nichts zu tun mit der Phänomenologie von E. Husserl, in welcher durch schrittweises Absehen von den alltäglichen Gegebenheiten philosophische Ursprungsaussagen möglich sein sollen. Die Phänographie dient nur der deskriptiven Verdeutlichung der je verwendeten Sprache (vgl. Holzkamp 1966, 1972).
In der folgenden phänographischen Kennzeichnung der menschlichen Tätigkeit stelle ich das alltägliche Vorwissen einer geringfügig expliziteren Form seiner selbst gegenüber. Bestimmte Züge dessen, was jeder eigentlich ohnehin über seine Tätigkeit weiss, soll damit durch umgangssprachliche Umschreibung besser besprechbar werden.
Handlung und Tätigkeit - Deutungszusammenhang
|
Als Tätigkeit bezeichne ich ein jeweils bestimmtes Tun jenseits von konkreten Handlungen. Das Ausüben einer Tätigkeit mit einem Ziel bezeichne ich als Handlung. Schreiben ist die Tätigkeit, einen Brief schreiben, ist eine Handlung. Ich schreibe eigentlich nie, ich schreibe immer etwas. In der Volksschule lerne ich schreiben quasi unabhängig davon, wozu ich es brauchen kann. Dabei geht es um die Tätigkeit, aber in einem sehr spezifischen Sinn, den ich als üben oder lernen bezeichne. Der Sinn liegt dabei nicht im Aufgeschriebenen. In höheren Schulen lerne ich dann, wie man einen Brief schreibt. Dabei wird vorausgesetzt, dass ich schreiben kann. Der Sinn liegt dann in der rethorischen Anordnung des Aufgeschriebenen.
Ich nehme wahr, dass jemand schreibt, weil ich sein Verhalten als schreiben deute. Das kann ich nur, wenn ich weiss, was schreiben ist. Ich muss Schrift erkennen und wissen, wozu man etwas schreibt. Dieses Wissen bezeichne ich als Deutungszusammenhang. Wenn ich das Handeln des Schreibenden nicht als Handlung deute, kann ich Operationen erkennen, durch welche beispielsweise Tinte auf einem Papier so verteilt wird, dass bestimmte Figuren entstehen. Auch in diesem Fall kann ich erkennen, dass der Schreibende etwas tut, auch wenn ich nicht erkennen kann, welches Ziel er damit verfolgt.
|
![bild]()
|
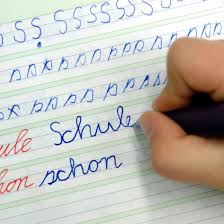
Bildquelle: Wikipedia
|
Herstellende Tätigkeit
Ich unterscheide Tätigkeiten mit einem unmittelbareren von solchen mit einem mittelbaren Sinn. Ich esse und trinke. Ich kann sammeln und jagen. Das machen viele Tiere auch. Sie machen es mir in dem Sinne vor, dass sie damit - wie ich - ihren leiblichen Stoffwechsel organisieren. Die Teile dieser Tätigkeiten, die ich nicht selbst ausführen muss, bezeichne ich als Arbeit, die anderen als Konsumption. Zur Konsumption rechne ich auch Tätigkeiten wie Schwimmen, Wandern oder Lesen, die sich selbst genügen.
|
Tätigkeiten mit einem mittelbaren Sinn beziehen sich auf anschliessende Tätigkeiten, ohne die sie keinen Sinn hätten. Das Anbauen von Korn wäre sinnlos, wenn das Korn nicht konsumiert würde. Zu den mittelbaren Tätigkeiten gehören insbesondere auch die herstellenden Tätigkeiten. Als herstellende Tätigkeit bezeichne ich Tätigkeiten, bei welchen ein materieller Gegenstand hergestellt wird. Es geht dabei also nicht darum, gedankliche Beziehungen oder mentale Pläne im umgangssprachlichen Sinn herzustellen, sondern darum, Material zu formen, wodurch ein Artefakt entsteht.
Exemplarisch für mittelbare Tätigkeiten ist das Herstellen von Werkzeugen, die immer als Mittel verwendet werden. Jedes Herstellen entwickelt sich zu einem Herstellen mittels Werkzeugen. Bei hergestellten Gegenständen unterscheide ich Arbeits- und Konsumtionsmittel. Mit einem Messer kann ich arbeiten, mit einer Brücke oder einem Haus nicht. Arbeitsmittel bezeichne ich als Werkzeuge. In der Produktion verwende ich Produktionsmittel, wozu ich auch Konsumptionsmittel rechne, die nicht unmittelbar konsumiert werden.
Jedes Mittel steht für etwas anderes. Eine Brücke stelle ich her, weil ich auf die andere Seite will, ein Messer, weil ich etwas schneiden will. Eigentliche Werkzeuge sind in diesem Sinne aber Mittel, die für andere Mittel stehen. Und soweit sie Gegenstände sind, sind sie Gegenstände, die für etwas stehen. Dass ein Gegenstand für etwas steht, liegt in dessen Zweck, den er für mich hat. Ich bezeichne den Zweck als Gegenstandsbedeutung, die ich dem Gegenstand gebe, wenn ich ihn herstelle. Wenn ich etwas herstelle, weiss ich, wozu ich es tue. Wenn ich bei einer Ausgrabung ein Artefakt finde, kann ich vielleicht nicht erkenne, wozu es ist, ich muss es deuten, aber ich stelle keine Artefakte her, sondern Gegenstände mit einer Bedeutung.
Ich kann einen Hammer zum Schmieden einer Sichel verwenden. Ich kann einen Hammer auch als Briefbeschwerer verwenden. Dann erfüllt der Hammer eine Funktion, die nichts mit seinem Zweck zu tun hat. in beiden Fällen dient er mir als Mittel. In einem gewissen Sinn verweist der Hammer durch seinen Zweck auf eine Sichel. Wenn ich einen Hammer sehe, sehr ich, was ich mit dem Hammer machen kann, wozu er hergestellt wurde, was seine Bedeutung ist. Warum oder wie ich das erkennen kann, weiss ich nicht, das ist Teil meiner Natur.
|
![bild]()
|

Bildquelle: Wikipedia
|
Dass Gegenstände, insbesondere Werkzeug, auf etwas verweisen, macht sie nicht zu Symbolen. Sie werden nicht dazu hergestellt, auf etwas zu verweisen. Ich kann die Bedeutung eines Werkzeuges aber nicht erkennen, ohne zu erkennen, worauf es verweist. Ein Werkzeug fungiert in diesem Sinn auch als externes Gedächtnis. Es erinnert mich immer auch an die Tätigkeiten, für die ich es verwenden kann.
Wenn ich ein Werkzeug herstelle, weiss ich auch, dass es als Gedächtnis fungiert, dass ich dessen Bedeutung jederzeit wiedererkennen kann. Es gibt viele Mensch-Tier-Vergleiche, in welchen problematisiert wird, dass Tiere, die gegenständliche Mittel herstellen, diese nur ad hoc benutzen, so wie ich etwa in einer gegebenen Situation einen Stein oder einen Stock benutze, ohne ihn dann aufzubewahren. Hier spielt aber keine Rolle, was Tiere machen oder können und was nicht. Hier geht es darum, dass ich erkenne, dass ich hergestellte Bedeutungen wiedererkennen und dass ich künftige Gebrauchssituationen antizipieren kann.
Ich kann insbesondere auch Gegenstände herstellen, die keinen anderen Zweck haben, als als Verweise zu dienen. Solche Gegenstände bezeichne ich als Symbol.
Zeichnung und Zeichen
Warum ein Hammer wie ein Hammer aussieht, rechne ich der Natur zu. Natürlich kann man in der Entdeckung des Hebels und im Stil des Hammers Erfindungen sehen. E. Kapp begründete seine, und damit die Technikphilosophie insgesamt mit einer skurilen Organprojektion, in welcher der Hammer (er spricht von der Axt) die Form des menschlichen Armes hat. Im Film Space Odyssey zeigt S. Kubrik einen Oberschenkelknochen mit dem Kopf an einem Ende als ersten Hammer, der von einem Noch-Tier verwendet wird.
Als Hammer bezeichne ich ein Werkzeug, bei welchem zwei Teile so verbunden sind, dass das eine als Stiel und das andere als Kopf, mit welchen aufgeschlagen wird, dient. Die Verbindung zwischen Kopf und Stiel ist dabei das technische Problem, das gelöst werden muss. Es gibt sehr viele Varianten, einige sind aktuell rezent, das heisst noch in Gebrauch, andere haben sich nicht sehr bewährt. Bei Menschen, die in technisch unentwickelten Gebieten leben, gibt es noch sehr einfache Verbindungen zwischen den Stiel und Kopf. Aber die eigentliche Form des Hammers liegt auf der Hand. Sie als Erfindung zu bezeichnen, ist Teil einer erfundenen Geschichte, die hier keine Rolle spielt. Im Kontext dieser Phänographie ist sinnenklar, was ein Hammer ist und wie ein Hammer aussieht - auch wenn kein Mensch weiss, wie der erste Hammer gemacht wurde und warum der Gegenstand Hammer heisst.
Ich kann einen Hammer herstellen oder einen Hammer zeichnen - wenn ich es kann. Beides ist Gattungsvermögen, unabhängig davon, ob ich gerade diese Fähigkeiten nicht oder nicht sehr entwickelt habe. In beiden Fällen stelle ich einen Gegenstand her, indem ich Material forme. Die Formen sind in gewisser Hinsicht analog. Der gezeichnete Hammer sieht in dieser Hinsicht wie der hergestellte Hammer aus. Die Zeichnung des Hammers verweist durch die analoge Form auf den Hammer. Ein Hammer, der wie ein anderer Hammer aussieht, ist in diesem Sinne kein Verweis, sonder ein Hammer. Die Zeichnung dagegen kann ich nicht nur nicht als Hammer verwenden, ich erkenne auch, dass sie kein Hammer ist, also für etwas anderes hergestellt wurde. Ceci n‘ est pas un marteau.
So wie ich den Zweck des Hammers erkenne, erkenne ich auch den Zweck der Zeichnung. Sie verweist auf den Hammer. Und so, wie ich den Hammer jenseits seines Zweckes, beispielsweise als Briefbeschwerer verwenden kann, kann ich auch die Zeichnung jenseits ihres Zweckes deuten. Ich kann sie beispielsweise als Kunstwerk betrachten und ihr so eine Funktion zuschreiben, die mit dem Zweck des Abbildens nichts zu tun hat.
Wenn ich eine Zeichung als Mittel zum Verweis herstelle, stelle ich ein Symbol her. Das Symbol ist ein Mittel zum Verweisen. Es steht für etwas anderes, und ich kann erkennen, wofür es steht, wofür es hergestellt wurde, was seine Bedeutung ist. Dass ich eine Zeichnung als Verweis betrachte, betrachte ich als naturgegeben. Ich erkenne durch Rauch ein für mich nicht sichtbares Feuer, durch Spuren im Schnee meinen Vorgänger und durch dunkle Wolken, dass es regnen wird. Natürlich kann ich mich im Einzelfall irren, hier geht es aber darum, dass ich die Zusammenhänge erkenn, und allenfalls auf Erfahrungen zurückführe, wenn ich eine vermeintliche Erklärung dafür will.
Eine Wolke ist kein Symbol, weil sie nicht hergestellt wird, ich bezeichne sie als Anzeichen und sage durch die Vorsilbe, dass sie kein eigentliches Zeichen ist. Spuren und Rauchzeichen können absichtlich produziert werden, darauf werde ich später zurückkommen.
Die Zeichnung bezeichne ich als ikonisches Symbol, weil ich förmlich sehe, wofür sie steht, auch wenn ich nicht weiss, was mir mit der Zeichnung mitgeteilt werden soll. Dass Zeichnungen als Kommunikationsmittel dienen können, ist zunächst sekundär. Ich kann gut für mich zeichnen, und weil ich kein Künstler bin, tue ich es gelegentlich sogar. Die Zeichnung ist nur eine - sehr anschauliche - Form des gegenständlichen Verweisens. Ich kann die Zeichnung auf ein Zeichen reduzieren, das nicht mehr zeigt, worauf es verweist, sondern nur noch zeigt, dass es verweist. Eigentliche Symbole sind vereinbart. Worauf die Buchstabenkette "Tisch" verweist, muss ich lernen. Ich muss die Vereinbarung kennen.
Ich stelle Symbole für mich als externe Gedächtnisse her. Wenn ich beispielsweise einen Einkaufszettel schreibe, muss nur ich wissen, welche Zeichen wofür stehen, aber ich muss es im Lebensmittelgeschäft immer noch wissen. Wenn ich ein X für Nudeln verwende, erinnert mich das X beim Einkaufen daran, dass ich Nudeln kaufen will, aber wofür, dass das X steht, mache ich in hinreichend einfachen Fällen keinen weiteren Zettel. Ich weiss aber, dass es Wörterbücher gibt, die als Zettel für Zettel fungieren.
Der wohl typische oder ursprüngliche Fall von Symbolen sind Markierungen wie Kerben oder Gravuren, beispielsweise ein Anzahl Striche, die für eine Anzahl von Gegenständen steht. Kerben auf einem Pfeilbogen können unter anderem etwa auf eine Anzahl erlegter Opfer oder auf einen bestimmten Besitzer verweisen. Es sind Symbole, die der Hersteller quasi mit sich selbst vereinbart.
Der Zweck der Symbole verlangt, dass verschiedene Symbole auf verschiedene Referenzobjekte verweisen und dass ich entsprechend viele verschiedene Sybole herstellen und unterscheiden kann. Ich kann Symbole so kombinieren, dass weitere Symbole entstehen. Ich kann dabei - wie es etwa die Chinesen tun - elementare Symbole zusammensetzen. Ich kann Symbole aber auch aus "Zeichenkörper" zusammensetzen, die für sich keine Symbole sind. Das Symbol "Tisch" besteht aus einer Aufreihung von Buchstaben. Bestimmte Symbolfolgen bezeichne ich als Texte, die Symbole, die ich in Texten verwende, bezeichne ich als Schriftzeichen, sie sind Elemente von Schriften. Das, was ich als Schrift überhaupt bezeichne, ist - wie Sprache - keine Erfindung sondern ein Deutungszusammenhang, durch den ich das Schreiben als solches, also als Textherstellung erkenne. Schrift ist typografieabstrakt generalisiert, sie differenziert die Schriftzeichen ohne deren konkrete Form (Glyphe) festzulegen, was für Handschriften zwingend ist und die Typografie, die sich mit der Form von konkreten Schriftzeichen befasst, möglich macht.
Reflexion der Phänographie
|
Den Ausdruck Reflexion verwende ich homonym auch für das Abprallen einer Welle an der Grenzfläche zwischen zwei Medien, etwa an einem Spiegel, in der Art, dass die Welle in jenem Medium zurückläuft, in welchem sie gekommen ist. Der Spiegel zeigt mir dadurch ein Bild von mir. Eine Fotografie, die mich zeigt, oder ein entsprechendes Gemälde erfüllt dieselbe Funktion als hergestellter Gegenstand ohne diese physikalisch gesehene Reflexion. In all diesen Fällen sehe ich nicht mich, sondern meinen Körper zu einer je bestimmten Zeit. Die Metapher, die nicht die Lichtwelle bezeichnet, reflektiert, dass ich mich selbst durch die Verwendung eines hergestellten Gegenstandes wie eines Spiegel oder eines Bildes wahrnehmen kann.
Wenn ich in einen Spiegel schaue, sehe ich normalerweise den Spiegel nicht. Ich sage, dass ich in den Spiegel schaue. Physiologisch nehme ich dabei das zurückgeworfene Licht wahr. Ich kann aber natürlich auch den Spiegel betrachten. Wenn ich ein Zeichnung von mir betrachte, sehe ich das Papier so wenig, wie ich einen Spiegel sehe. Ich sehe mich. Bei der Zeichnung sehe ich aber immer auch, dass gezeichnet wurde. Der Spiegel und das Papier sind hergestellte Gegenstände. Das Spiegelbild ist aber im Unterschied zur Zeichnung kein Gegenstand. Das Spiegelbild ist wie gesprochene Wörter flüchtig. Ich kann mich und andere auch sprechen hören. Aber die Reflexion ist dann auf eine auch flüchtige Erinnerung angewiesen. In der Zeichnung ist die Reflexion durch die Herstellung vermittelt.
|
![bild]()
|

Bildquelle: Wikipedia
|
In der hier gemeinten Reflexion beobachte ich auch nicht mich selbst, sondern das, was ich schreibend hergestellt habe. Ich lese dabei nicht meinen Text, den ich ja kenne, sondern beobachte die im Text verwendeten Unterscheidungen, deren jeweilige Einheit ich als Kategorie bezeichne. Mit Kategorie beschreibe ich die Anschauung (theorein), nicht das Angeschaute. Ein Auto beispielsweise ist rot oder hat die Farbe rot. Rot ist eine Eigenschaft des Autos. Dass ich die Farbe des Autos beobachte, beruht auf meiner Wahl der Kategorie. In diesem Fall könnte ich vergleichsweise auch zwischen einem Schwarzweiss- und einem Farbfilm wählen. Eigenschaftsdomäne und Kategorie werden oft verwechselt oder gleichgesetzt. Die Eigenschaftsdomäne bezeichnet den Wertebereich der Eigenschaft. Die Kategorie bezeichnet, dass in der Beobachtung beispielsweise Eigenschaften oder Domänen unterschieden werden.
Ein Text kann beschreiben, wie ich aussehe. Er zeigt dann dasselbe wie eine Zeichnung, auf welcher ich zu sehen bin, einfach auf eine andere Art. Die Zeichnung ist analog, der Text digital. Zeichnungen, die ich herstelle, sagen etwas über mich. Und Texte, die ich schreibe, sagen sehr viel über mich, vor allem auch, wenn sie gar nicht mich beschreiben. Sie implizieren die Kategorien, die ich verwende. Sie zeigen - auch mir - wie ich die Welt wahrnehme.
Das Beobachten von Kategorien bezeichne ich als Beobachten 2. Ordnung. Ich kann meinen Text beobachten, indem ich wieder einen Text herstelle, einen Text über den beobachteten Text, den ich im Prinzip wieder beobachten könnte. Hier will ich aber meine Phänographie der Tätigkeit beobachten.
Ich will dazu noch eine Anmerkung zu Wissenschaft und Philosophie machen. Von P. Feierabend gibt es den Spruch "anything goes", der oft - etwas blödsinnig - für "die wissenschaftliche Methode gebe es nicht" gelesen wird.
Ich habe keine Ahnung, was P. Feierabend sagen wollte, aber Wissenschaft unterscheide ich von Philosophie dadurch, dass in der eigentlichen Wissenschaft gemessen wird. Was wie gemessen wird, mag im Sinne von anything goes gleichgültig sein, aber ich kenne kein Messen, das ohne hergestellte Gegenstände geht. Durch das Messgerät ist immer auch eine Methode gegeben.
Die Philosophen sprechen auch von Methoden, wo sie Rhetorik meinen, also bestimmte Weisen des Argumentierens, die sich in ihren Texten zeigen. Eigentliche Wissenschaften argumentieren nicht, aber viele Wissenschaftler argumentieren. Ihre wesentlichste Argumentation - gegen die wohl anything goes gerichtet ist - betrifft die pragmatische Wahl der Messoperationen. Dabei wird immer eine Weltanschauung impliziert, jenseits derer kein Messen einen Sinn hätte.
Den Ausdruck Phänographie hat K. Holzkamp als Wissenschaftler in einer ablehnenden Anlehnung an E. Husserls philosophische Phänomenologie eingeführt. E. Husserl hat die Beobachtung der Sprache, die er als Begriffsexplikation bezeichnete, als Mittel jeder Erkenntnis gesehen und hat damit die Philosophie zwar kritisiert, aber nicht hinter sich gelassen, weil er immer noch einer Erkenntnislehre verhaftet blieb. K. Holzkamp hat erkannt, dass auch jede Wissenschaft Sprache voraussetzt, also ihren Gegenstand nur mittels Sprache bestimmen kann. Seine Wahrnehmungslehre hat er aber nicht durch seine Sprache begründet, sondern durch eine naturgeschichtliche Lehre, in welcher Sprache gerade keine Rolle spielt, obwohl sie erzählt wird. Für beide ist Sprache ein unverstandenes Phänomen geblieben. Ich schreibe hier vom Schreiben, nicht von Sprache, ich werde dafür aber explizit sagen, was ich als Sprache bezeichne. Ich unterscheide Sprache und Sprachen als zwei ganz verschiedene Sachen, sprechen kann ich nur eine Sprache, nicht die Sprache oder Sprache überhaupt.
Kategorien
In der vorliegenden Phänographie beschreibe ich, wie ich Symbole herstelle. Um das zu beschreiben, verwende ich Symbole, die ich als materielle Gegenstände herstelle, die also eine Gegenstandsbedeutung haben und auf ein Referenzobjekt verweisen. Ich beobachte das, was ich beobachte, als herstellende Tätigkeit, durch die ich in diesem Fall ein kompliziertes Symbol, einen Text, hervorbringe, das aus einfachen Symbolen besteht.
In der Reflexion beobachte ich, dass ich das Herstellen beobachte. Ich könnte auch etwas anderes beobachten, etwa was die Symbole bedeuten, aber ich beginne mit dem Herstellen. Ich bezeichne das Herstellen als meine primäre Kategorie. Als Kategorie bezeichne ich das Herstellen, weil ich es von etwas anderem unterscheide. Vorerst, im Sinne der Phänographie unterscheide ich das Herstellen von allen anderen Sachen, die ich auch beobachten könnte. Indem ich hier Herstellen als Kategorie bezeichne, verwende ich den Ausdruck sowohl für die Einheit der Unterscheidung als auch für die eine Seite dieser Unterscheidung. Das bezeichne ich in einer invertierten Anlehnung an N. Luhmann als re-entry, weil ich die Bezeichnung auf einer anderen Ebene wiederhole und so noch einmal einbringe.
Das Bestimmen von Kategorien unterliegt dem gleichen Problem wie das Definieren von Begriffen, weil ich in beiden Fällen Unterscheidungen einführe, die eine übergeordnete Einheit implizieren. Im Falle der Definition spreche ich von Genus proximum und Differentia specifica, also von Oberbegriff und Kriterium. Ich definiere etwa, dass eine Maschine ein bestimmtes Werkzeug sei, nämlich eines, das mit einem Motor angetrieben werde, wobei ich Werkzeug als Oberbegriff einführe. Aber für das Werkzeug habe ich dann keinen Oberbegriff mehr. Ich komme nicht umhin, phänographisch zu umschreiben, wovon die Rede ist.
Die Reflexion der Phänographie impliziert selbst eine Phänographie, in welcher ich beschreibe, was ich nicht beobachte, wenn ich das Herstellen beobachte. Ich beziehe mich dabei auf vorfindbare Beobachtungen, die ich als Weltanschauungen bezeichne. Viele Beschreibungen beginnen - der Bibel folgend - mit einer Beobachtung der Natur, die oft - von der Bibel etwas abweichend - als Universum mit Gestirnen aus Atomem gesehen wird. Zu solcher Natur gehört, dass es auf bestimmten Gestirnen Lebewesen gibt, die ihre Bedürfnisse befriedigen (müssen). Dass einige dieser Lebewesen sprechen oder etwas herstellen, kommt in solchen Geschichten erst weit hinten vor und dass sie sprechen, erscheint oft als Mittel des Überlebens. Die Menschen tun auch in solchen Geschichten allerlei, aber was sie wie tun, ist reaktiv auf Naturverhältnisse, die jenseits von Menschen gegeben sind. Als primäre Kategorie dient dann die universielle Natur, die auch nicht von etwas anderem unterschieden werden kann.
In meiner hier vorliegenden Phänographie spielt die Natur keine Rolle. Die Menschen tun, was sie tun, nicht weil eine oder ihre Natur das von ihnen verlangt. Diese Geschichte beginnt damit, dass Menschen etwas tun. Natur erscheint in dieser Darstellung allenfalls als Erklärungsprinzip.
Schliesslich könnte ich mich selbst auch in einer Art Solipsismus aufheben, also davon ausgehen, dass hinter allen Beobachtungen nichts ist, dass die Welt insgesamt aus Beobachtungen besteht, von welchen unerheblich ist, wer sie gemacht hat, die aber das einzige sind, was empirisch relevant vorhanden ist. Die Atome der Natur sind ja auch einfach da. So, wie ich beobachten kann, welche Atome sich wie wozu verbinden, kann ich auch beobachten, welche Wörter wo in der Welt vorkommen. N. Luhmann beispielsweise beobachtet ausschliesslich Kommunikationen, so wie eigentliche Mathematiker sich nur mit formalen Gebilden befassen, die nicht hergestellt wurden.
Formale Beschreibungen brauchen keine Phänographie. Problematisch werden sie nur, wo sie als Beschreibungen von etwas missverstanden werden. Schach beispielsweise wird sehr selten als Beschreibung von etwas aufgefasst. Mathematisch gemeinte Aussagen dagegen werden sehr oft auf Gegenstände bezogen, die in der Mathematik nicht vorkommen. Man spricht dann oft von einer Anwendung. Der Gegenstand, der von solchen Anwendungen betroffen sein soll, muss aber jenseits von Mathematik beschrieben werden. In einem typischen Fall sind das physikalische Gegenstände, die durch die Wahl einer primären Kategorie wie etwa Natur bestimmt sind.
Wenn formale Philosophien wie jene von N. Luhmann nicht als Glasperlenspiel wie Schach gelesen werden, muss phänographisch geklärt werden, worauf sie bezogen werden, im Falle der luhmannschen Systemtheorie etwa, was Kommunikationen sein sollen. Ich führe diese Beispiele an, um zu zeigen, wie beliebig die Wahl der primären Kategorie ist. Die Beobachtung 2. Ordnung beobachtet die je gewählte Anschauung durch Explikation der verwendeten Kategorien.
Referenzierung
|
Ich unterscheide verschiedene Arten der symbolischen Referenzierung. Wenn ich ein Bild male, stelle ich einen Gegenstand her. Jedes Herstellen hat einen Anfang und ein Ende. Wenn ich ein Bild male, das einer Fotographie oder einem Spiegelbild entspricht, fange ich natürlich auch irgendwo an. Aber der Anfang spielt keine Rolle, das fertige Bild ist davon nicht betroffen, es hat keinen Anfang. Das gemalte Bild hat aber nicht nur keinen Anfang, es repräsentiert auch keine gegenständliche Unterscheidungen. Es zeigt, was der Betrachter von einem gegeben Standpunkt aus sehen kann, und mithin etwas über den Standpunkt, den der Betrachter einnehmen müsste, um das zu sehen, was er auf dem Bild sieht. Wenn ich auf die Rückseite eines Hauses oder in das Haus hinein gehe, sehe ich in dem Sinne Verschiedenes, als ich verschiedene Bilder malen würde. Verschiedene Gegenstände zeigt ein Gemälde aber nicht, der Betrachter muss sie selbst unterscheiden. Das Gemälde repräsentiert eine Menge von farbigen Pixeln, die einer Retinafunktion entsprechen.
Eine eigentliche Zeichnung zeigt die Form eines Gegenstandes in einer gegebenen Perspektive. Als Zeichner kann ich wie als Maler verschiedene Beobachtungsstandpunkte einnehmen, aber ich zeichne immer die Form eines von mir vorab gewählten und isolierten Gegenstandes. Als Form bezeichne ich genau das, was ich zeichne. Beim Zeichnen stelle ich einen Gegenstand her, der in gewisser Hinsicht die gleiche Form hat, wie der durch die Zeichnung referenzierte Gegenstand.
|
![bild]()
|
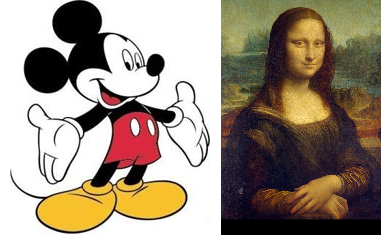
|
Das Formen von Material ist keine Erfindung, es ist den Menschen naturwüchsig zugefallen, dass sie Material formen. Wie ich was forme beruht dagegen auf einer kulturellen Entwicklung, die ich als Technik bezeichne. Wenn ich zeichne, forme ich Material. Ich gebe beispielsweise dem Graphit, das ich mit dem Bleistift auf ein Papier auftrage, eine von mir intendierte Form.
Als Malen und Zeichnen bezeichne ich das Auftragen von Farbe auf einen Farbträger. Ich spreche hier vom Malen von Bildern, nicht vom Streichen von Gebrauchsgegenständen. Und ich meine auch nicht das Ausmalen von Zeichnungen, sondern das, was unter anderen Kunstmaler tun. Malen und Zeichnen sind zwei verwandte, aber sehr verschiedene Tätigkeiten, weshalb ich auch zwei verschiedene Bezeichnungen verwende. Beide dabei hergestellen Artefakte referenzieren ohne explizite Vereinbarungen, weshalb ich in beiden Fällen von einem Bild sprechen kann. Ich kann erkennen, was gezeichnet oder gemalt wurde. Umgekehrt ist es mir nicht möglich, in oder durch Zeichnungen und Gemälden solcher Art eine Beobachtung zu erkennen, die ich durch Kategorien reflektieren könnte. P. Weiss beispielsweise zeigt in seiner Ästhetik des Widerstandes exemplarisch, dass und wie Gemälde als Kunstwerke interpretiert werden können, das macht er aber sprachlich.
Wenn ich einen Text schreibe, forme ich Buchstaben, ich stelle sie als Gegensstände her, indem ich sie zeichne. Die Buchstaben sind keine Symbole, sie haben - von sehr speziellen Fällen abgesehen - kein Referenzobjekt. Ich verwende die Buchstaben als Bausteine für Wörter und Wörter als Bausteine für Sätze. Bestimmte Wörter sind Symbole. Ich werde später auf ausführlicher die Wortarten zurückkommen. Hier geht es vorerst darum, was ich mit Substantiven, die ich nicht als Eigennamen verwende, referenziere. Was ich mit einem Substantiv bezeichne, kann ich nicht sehen. Substantive zeigen aber nur nicht, wofür sie stehen, sie stehen für etwas, was ich nicht zeigen und deshalb inbesondere weder zeichnen noch malen kann. Ich werde später beschreiben, wie ich dieses Problem pragmatisch aufheben kann, vorerst geht es darum, dass dem Wort Werkzeug beispielsweise kein konkreter Gegenstand entspricht. Ich kann jeden konkreten Gegenstand zeichnen, aber nicht den abstrakten Gegenstand, den ich mit einem Wort bezeichne. Die Maschine oder das Werkzeug gibt es nicht in der Weise, dass ich ein Bild davon machen könnte. Man kann sagen, dass das Wort Werkzeug für eine mentale Repräsentation aller möglichen Werkzeug stehe, aber auch diese Repräsentation kann niemand zeichnen oder sich in einem wörtlichen Sinn vorstellen. Wenn ich jemandem erläutern will, wie ich das Wort Werkzeug oder irgendein anderes Wort verwende, zeige ich ihm praktisch nie eine Sache und ganz sicher gar nie eine mentale Repräsentation einer Sache, ich erläutere das Wort, indem ich andere Worte dafür sage. Jedes bezeichnende Wort ist in diesem Sinn ein Er-Satz für einen Satz.
Mit Wörtern kann ich Gegenstände be-zeichnen. Ich kann ohne weiteres von Maschinen sprechen und wissen, was ich damit meine. Mit Substantiven referenziere ich in einer bestimmten Hinsicht, die sich etwa in Wörterbüchern zeigt, Sätze. Substantive sind in dem Sinne Er-Sätze, als ich sie durch Sätze ersetzen kann. Das ist das Verfahren, das ich in Wörterbüchern erkenne, in welchen es sozusagen ausschliesslich um genau solche Erläuterungen geht. Eine spezielle Variante solcher Erläuterungen bezeichne ich als Definition. Ich definiere, wie ich ein Wort verwende, indem ich einen Oberbegriff und ein Kriterium angebe.
Meine Definitionen betreffen keine Dinge, sondern zeigen, wie ich Wörter verwende. Wörter, für die ich eine Definition habe, bezeichne ich als Begriffe. Ich bemühe mich, sie immer so zu verwenden, dass ich sie duch meine Definition ersetzen könnte. Wie Wörter von andere Menschen verwendet werden, kann ich beobachten, was andere wissen, ist für mich unerheblich oder transzendent. Ich kann es nicht wissen, ich kann nur sehen, was sie schreiben.
Meine Begriffe bilden ein Netzwerk, weil die Wörter in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder vorkommen. Meine Wortverwendungen sind viabel, solange das Netzwerk für mich kohärent ist, also solange ich einen Begriff immer durch den gleichen Er-Satz ersetzen kann. Meine Erläuterungen haben in diesem Sinn kybernetische Beschränkungen, die festlegen, was ich mit je bestimmten Wörtern - ohne mir zu widersprechen - sagen und mithin referenzieren kann.
Sprache als Handlungszusammenhang
Es gibt ganz viele Sprachen. Leicht erkennen kann ich, dass Menschen, die an anderen Orten leben, sehr oft ganz andere Wörter verwenden als ich. Ich erkenne aber auch, dass sie sprechen, obwohl ich nicht verstehe, was sie sagen.
Als Symbole beruhen Wörter auf Vereinbarungen, die ich lernen muss.
Als Sprechen bezeichne ich hier eine Vertonung von Schrift. Ich gehe davon aus, dass Menschen zuerst geschrieben und erst später gesprochen haben. Auch das will ich hier nicht erläutern. Hier geht es mir darum, dass Schreiben eine herstellende Tätigkeit ist, während ich mit Sprechen normalerweise keine Gegenstände herstelle. Was ich hier sage, habe ich davor - beobachtbar und anfassbar - aufgeschrieben. Ich habe Text hergestellt, den ich hier quasi vertone. Dass ich diese Musik auch ohne Notenblatt spielen könnte, rechne ich der Natur zu.
Text muss als hergestellter Gegenstandwie jedes Artefakt einen Zweck erfüllen, der seine Bedeutung ausmacht. Ich kann dessen Teile, also Buchstaben und Wörter nicht beliebig formen und nicht beliebig anordnen. Ich muss es hinreichend richtig tun. In der Technik erscheint dieses Richtigsein von Text beispielsweise in Form von Computerprogrammen, wo umgangssprachlich von Programmier-"Sprachen" gesprochen wird - obwohl kein Mensch eine Programmiersprache spircht.
Ein für mich hier wichtiger Punkt ist, dass ich nicht verstehen muss, was ich mache, wenn ich spreche. Ich kann es einfach tun. Ich brauche keinerlei Wissenschaft dazu. Dass ich durch Schallwellen irgendwelche Nerven in den Ohren von anderen anrege, mag richtig und wahr sein, aber es ist für mich hier ohne jede Relevanz, es ist Natur. Dass man mit Sprechen Denken und Bewusstheit verbinden kann, spielt hier auch keine Rolle.
Wenn ich schreibe, stelle ich anfassbare Gegenstände her. Schreiben ist eine körperliche Tätigkeit, die ich - euphemistisch gesprochen - "lernen" musste. Ich wurde zum Schön- und Richtigschreiben wie ein Hund trainiert. Dabei ging es nicht darum, was ich schreibe, sondern um das herstellende Handwerk, das spezifischen Kriterien unterliegt. Ich musste lernen, materielle Gegenstände zu formen, wie es in der Syntax vorgeschrieben wird.
Schreiben ist ein spezielles Handwerk. Beim Schreiben stelle ich Symbole her, also materielle Artefakte, die für etwas anderes stehen. Das, worauf ich verweise, bezeichne ich als Referenzobjekt. Ich unterscheide zwei verschiedene Arten der symbolischen Referenzierung, ich kann zeichnen oder bezeichnen. Ich kann jeden Tisch zeichnen, aber ich kann den Tisch nicht zeichnen.
======